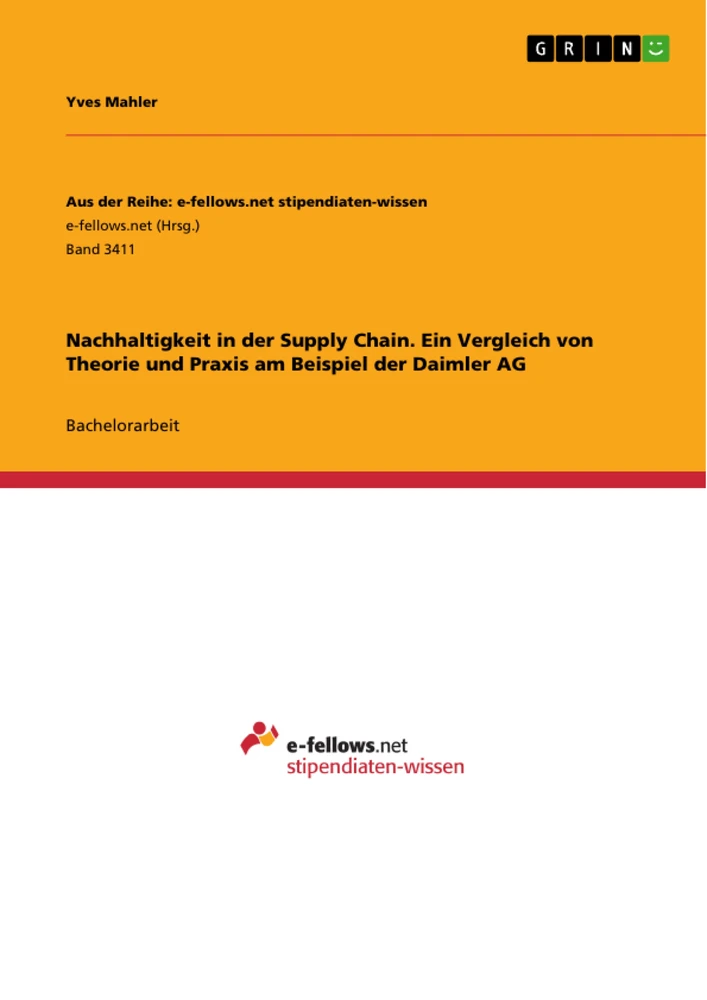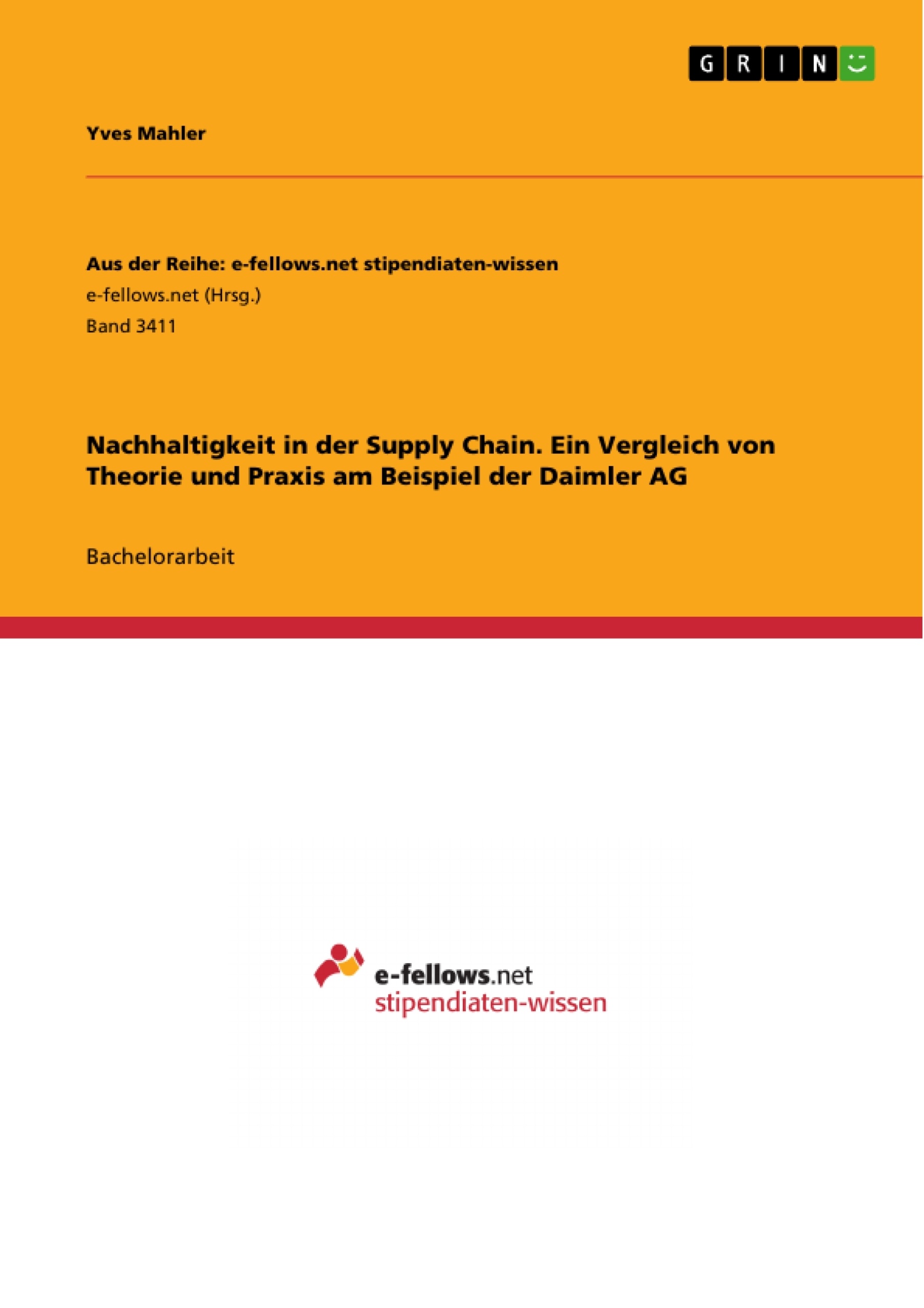In dieser Arbeit soll den folgenden Forschungsfragen nachgegangen werden: Welche theoretischen Konzepte existieren zum Thema Nachhaltigkeit in der Supply Chain bzw. was ist der wissenschaftliche Status quo zu diesem Thema? Deckt sich die theoretische Konzeption mit der Praxis und wie ist die Praxis letztlich zu bewerten?
Dazu sollen zunächst die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit gelegt werden. In einem ersten Schritt wird sich dem Begriff der Nachhaltigkeit gewidmet. Einem Abriss über die Historie der Nachhaltigkeit folgen die begriffliche Definition von Nachhaltigkeit, verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle sowie die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Corporate Social Responsiblity (CSR).
In einem zweiten Schritt folgt ein historischer Abriss über die Organisation der Fertigung im Wandel sowie die Definition des Begriffs Supply Chain Management und die Abgrenzung von ähnlichen Konzepten wie beispielsweise der Logistik. Anschließend wird auf Basis einer breiten Literaturrecherche der Stand der Forschung zum Thema Nachhaltigkeit in der Supply Chain wiedergegeben. Es wird sich zeigen, dass dieses Thema in der wissenschaftlichen Literatur vor allem unter dem Begriff Sustainable Supply Chain Management (SSCM) zu finden ist, auch wenn es noch recht spärlich erforscht ist. Dennoch wird ein möglichst umfassender Status quo der Forschung diesbezüglich dargelegt.
In Kapitel 4 wird dann in einem evaluativen Teil auf Basis des Kapitels 3 ein Abgleich zwischen Theorie und Praxis vollzogen. Hierzu werden exemplarisch die Aktivitäten der Daimler AG im Bereich Nachhaltigkeit in der Supply Chain mit der theoretischen Konzeption aus dem vorherigen Kapitel verglichen. Diesem Abgleich geht eine kurze Einführung in die deutsche Automobilindustrie, deren die Supply Chain betreffenden Spezifika sowie allgemeine Informationen über die Daimler AG voraus. Dem Abgleich lässt sich entnehmen, dass obwohl die Daimler AG an keiner Stelle explizit von SSCM spricht, sie doch fast alle Punkte, die im wissenschaftlichen Diskurs angeführt werden, erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Theoretische Grundlagen zur Nachhaltigkeit
- 2.1.1 Von der Forstwirtschaft zum globalen Leitgedanken
- 2.1.2 Nachhaltigkeit - Definition, Modelle und Abgrenzung
- 2.2 Theoretische Grundlagen zum Supply Chain Management
- 2.2.1 Die Organisation der Fertigung im Wandel
- 2.2.2 Supply Chain Management - Definition und Abgrenzung
- 3 Nachhaltigkeit in der Supply Chain
- 3.1 Sustainable Supply Chain Management - Definition, Ziele und Gründe
- 3.2 Die Chancen und Risiken eines Sustainable Supply Chain Managements
- 3.3 Die Entwicklung einer Sustainable Supply Chain Strategie
- 3.3.1 Der Zusammenhang zwischen Unternehmensstrategie, Supply Chain und Nachhaltigkeit
- 3.3.2 Die Faktoren einer nachhaltigen Supply Chain Strategie
- 3.3.3 Die Implementierung der nachhaltigen Supply Chain Strategie
- 3.4 Kritik am Sustainable Supply Chain Management
- 4 Sustainable Supply Chain Management in der Praxis am Beispiel der Daimler AG
- 4.1 Die Automobilindustrie als Untersuchungsgegenstand
- 4.1.1 Allgemeine Fakten sowie Supply Chain Spezifika
- 4.1.2 Die Daimler AG im Überblick
- 4.2 Nachhaltigkeit in der Supply Chain der Daimler AG
- 4.3 Kritische Würdigung des Theorie-Praxis-Abgleichs
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Supply Chain und untersucht den Praxisbezug am Beispiel der Daimler AG. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der Nachhaltigkeit und des Supply Chain Managements, um anschließend die Herausforderungen und Chancen eines nachhaltigen Supply Chain Managements zu erörtern. Die Arbeit zeigt außerdem die Implementierung einer nachhaltigen Supply Chain Strategie auf und beleuchtet kritische Aspekte des Sustainable Supply Chain Managements.
- Theoretische Grundlagen der Nachhaltigkeit und des Supply Chain Managements
- Chancen und Risiken eines nachhaltigen Supply Chain Managements
- Entwicklung und Implementierung einer nachhaltigen Supply Chain Strategie
- Praxisbezug am Beispiel der Daimler AG
- Kritische Würdigung des Theorie-Praxis-Abgleichs
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 liefert eine Einleitung in das Thema Nachhaltigkeit in der Supply Chain und stellt den Kontext der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Nachhaltigkeit und des Supply Chain Managements. Kapitel 3 befasst sich mit den Chancen und Risiken eines nachhaltigen Supply Chain Managements und zeigt die Entwicklung einer nachhaltigen Supply Chain Strategie auf. Kapitel 4 untersucht die Praxis des Sustainable Supply Chain Managements am Beispiel der Daimler AG.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Supply Chain Management, Sustainable Supply Chain Management, Daimler AG, Automobilindustrie, Unternehmensstrategie, Theorie-Praxis-Transfer, Chancen und Risiken.
- Arbeit zitieren
- Yves Mahler (Autor:in), 2016, Nachhaltigkeit in der Supply Chain. Ein Vergleich von Theorie und Praxis am Beispiel der Daimler AG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/771079