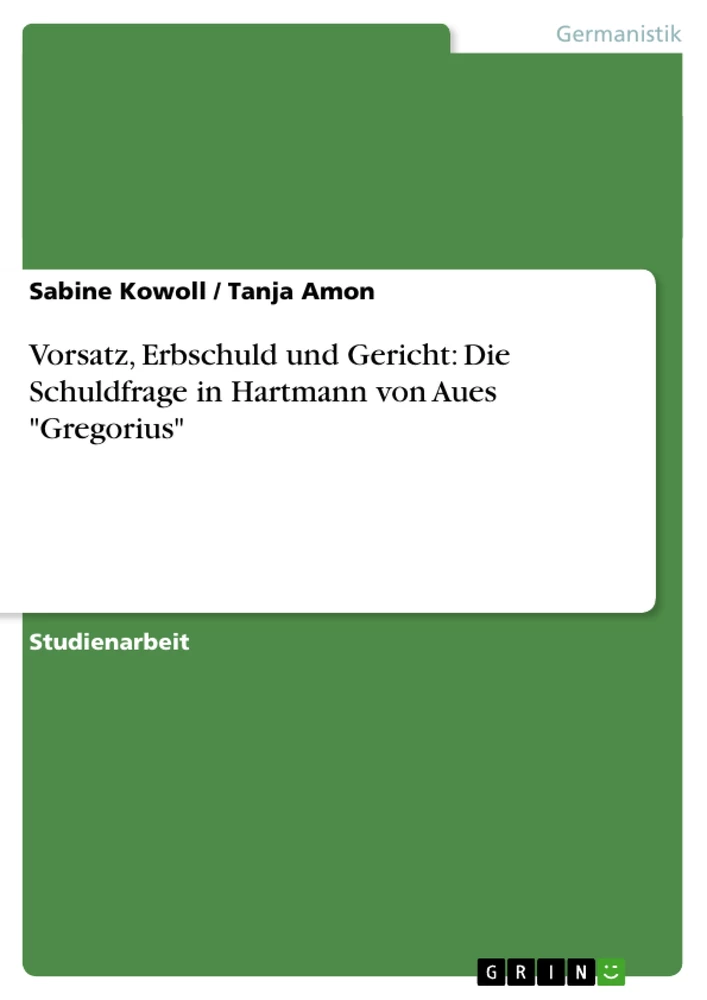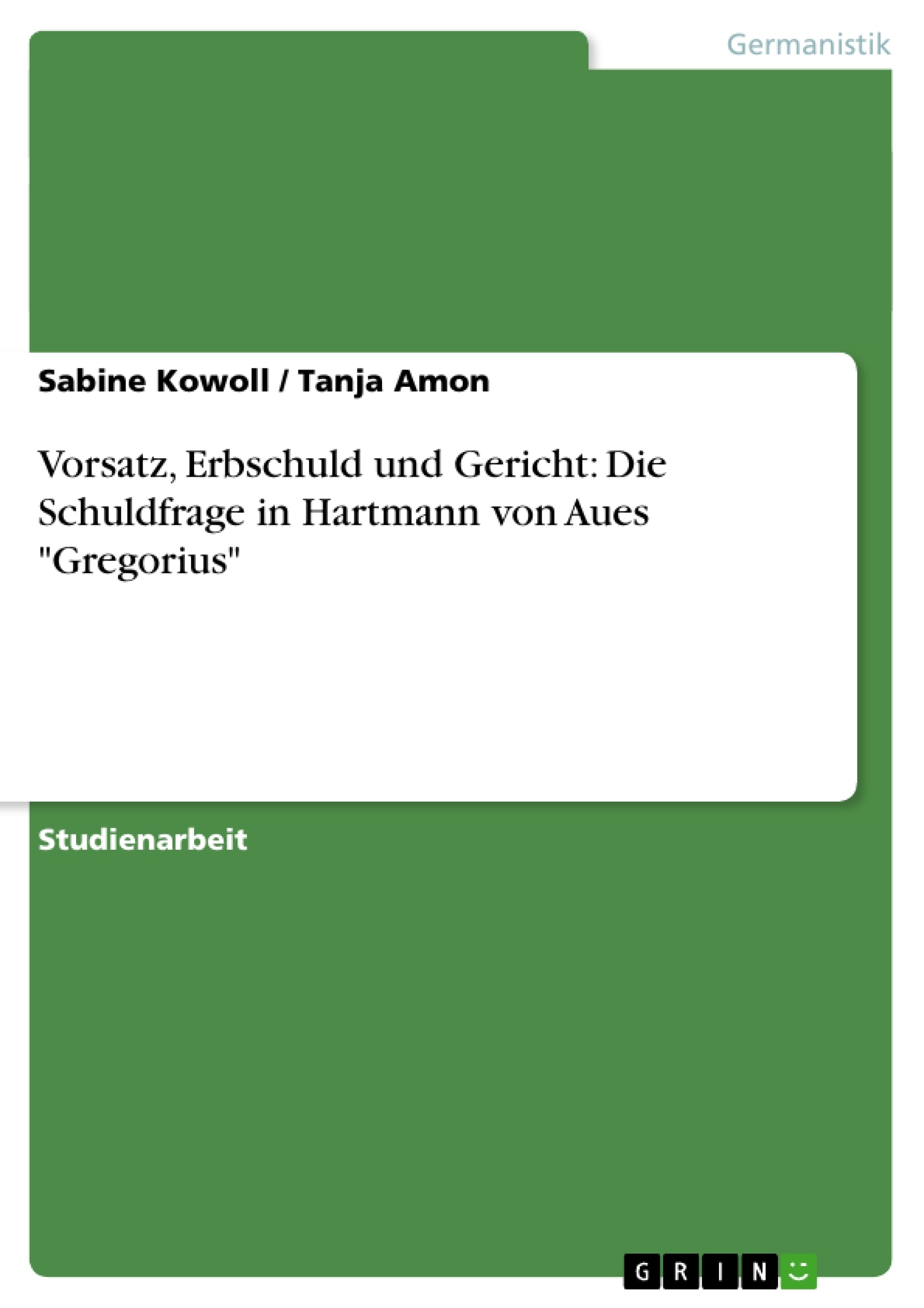Gemäß E. Gössmann lassen sich die vielen Erörterungen des in Hartmanns „Gregorius“ enthaltenen Schuldproblems in vier Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfasst die theologisierenden Interpretationen, welche den literarischen Text als zweitrangig einstufen, indem sie ihn als Propagandamittel für zeitgenössische theologische Anschauungen werten. Sie konstruieren eine persönliche Schuld des Gregorius; eine Schuld, die dessen 17-jährige Buße auf dem „wilden Felsen" begründet. Zur zweiten Gruppe zählen die literaturwissenschaftlich orientierten Arbeiten, die theologische Argumentationen beinhalten. Diese Interpretationen berücksichtigen die Eigengesetzlichkeit des Literarischen und suchen zu erforschen, inwieweit der theologisch-geistliche Hintergrund in die Dichtung eingegangen ist. Sie lehnen die Annahme der persönlichen Schuld des Gregorius ab. Als dritte Gruppe sind die komparativistisch angelegten Interpretationen zu nennen. Sie untersuchen den stoffgeschichtlichen Zusammenhang von Hartmanns „Gregorius“ mit dem antiken Ödipus-Motiv oder mit anderen Legenden des Mittelalters und verwerfen die These der persönlichen Schuld. Der letzten Gruppe lassen sich die sozialgeschichtlich orientierten Arbeiten zurechnen.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich weitestgehend an den theologisierenden Interpretationen und sucht drei entscheidende Fragen zu beantworten:
1. Ist Gregorius bereits durch seine Geburt mit einer Schuld behaftet oder hat diese für ihn irgendwelche unheilvollen Konsequenzen?
2. Sind Gregorius und seine Mutter durch ihre Ehe, die unbewusste Blutschande, schuldig geworden?
3. Falls die ersten beiden Fragen zu verneinen sind, ist Folgendes zu erörtern: Um welch sonderliche Gnade Gottes handelt es sich, durch die Gregorius nach siebzehnjähriger Bußzeit seine subjektiv nicht vorhandene Schuld endlich vergeben wird?
Inhaltsverzeichnis
- Interpretationsmöglichkeiten zum Schuldproblem
- Geschwisterinzest im Lichte der damaligen Theologie
- Beziehung zwischen Bruder und Schwester
- Geburt des Gregorius als Folge des Inzests
- Inzestehe im Lichte der damaligen Theologie
- Rolle der Mutter
- Rolle des Gregorius
- Subjektives Sündenbewusstsein
- Persönliche Schuld des Gregorius
- Nichtübernahme der Buße für die Eltern
- Austritt aus dem Kloster
- Streben nach Ritterschaft
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schuldfrage in Hartmanns „Gregorius“ im Kontext der mittelalterlichen Theologie. Sie analysiert, ob Gregorius aufgrund seiner sündigen Abstammung bereits bei seiner Geburt mit einer Schuld behaftet ist und welche Konsequenzen dies für ihn hat. Des Weiteren wird die Schuld der Eltern durch ihre Inzestbeziehung untersucht, sowie die Frage, ob Gregorius für deren Sünden verantwortlich gemacht werden kann.
- Die Rolle der Schuld in Hartmanns „Gregorius“
- Die Interpretation des Inzestmotivs im mittelalterlichen Kontext
- Die Rolle des freien Willens in der Sünde
- Die Auswirkungen der „infamia“ auf Gregorius' Leben
- Die Frage der subjektiven und objektiven Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Interpretationen des Schuldproblems in Hartmanns „Gregorius“ und stellt die vier Hauptgruppen der Interpretationen vor. Anschließend werden die zentralen Fragen der Arbeit vorgestellt.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Thema des Geschwisterinzests im Lichte der damaligen Theologie. Es wird untersucht, ob die Beziehung zwischen Bruder und Schwester als sündhaft zu betrachten ist und welche Rolle die Schönheit der Schwester in der Versuchung des Bruders spielt. Auch die Frage nach der Schuld der Schwester beim Inzest wird in diesem Kapitel erörtert.
Kapitel drei untersucht die Frage, ob die Geburt des Gregorius als Folge des Inzests ihn mit einer Schuld belastet. Es wird die damalige kirchliche Lehre zur Geburt aus dem Inzest und die damit verbundenen Folgen wie die „infamia“ beleuchtet. Zudem wird die Sorge der Mutter um das Seelenheil ihres Sohnes im Kontext der Inzestgeburt analysiert.
Kapitel vier behandelt das Thema des subjektiven Sündenbewusstseins und untersucht, ob Gregorius sich seiner Schuld bewusst ist. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob Gregorius die Schuld seiner Eltern übernimmt oder ob er eine eigene Schuld empfindet.
Kapitel fünf erörtert die Frage der persönlichen Schuld des Gregorius. Es werden die drei Hauptaspekte der Schuld des Gregorius - die Nichtübernahme der Buße für seine Eltern, der Austritt aus dem Kloster und das Streben nach Ritterschaft - untersucht und analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Schuld, Inzest, Sündhaftigkeit und Buße im Kontext des mittelalterlichen Weltbildes und der Theologie. Dabei stehen die Figuren Gregorius, seine Eltern und die Frage nach ihrer persönlichen und kollektiven Schuld im Vordergrund. Die Analyse der „infamia“ als Folge der Inzestgeburt und die unterschiedlichen Interpretationen des „Gregorius“-Stoffes, insbesondere die theologischen und literaturwissenschaftlichen Ansätze, bilden weitere wichtige Aspekte der Arbeit.
- Citar trabajo
- Sabine Kowoll (Autor), Tanja Amon (Autor), 2006, Vorsatz, Erbschuld und Gericht: Die Schuldfrage in Hartmann von Aues "Gregorius", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77300