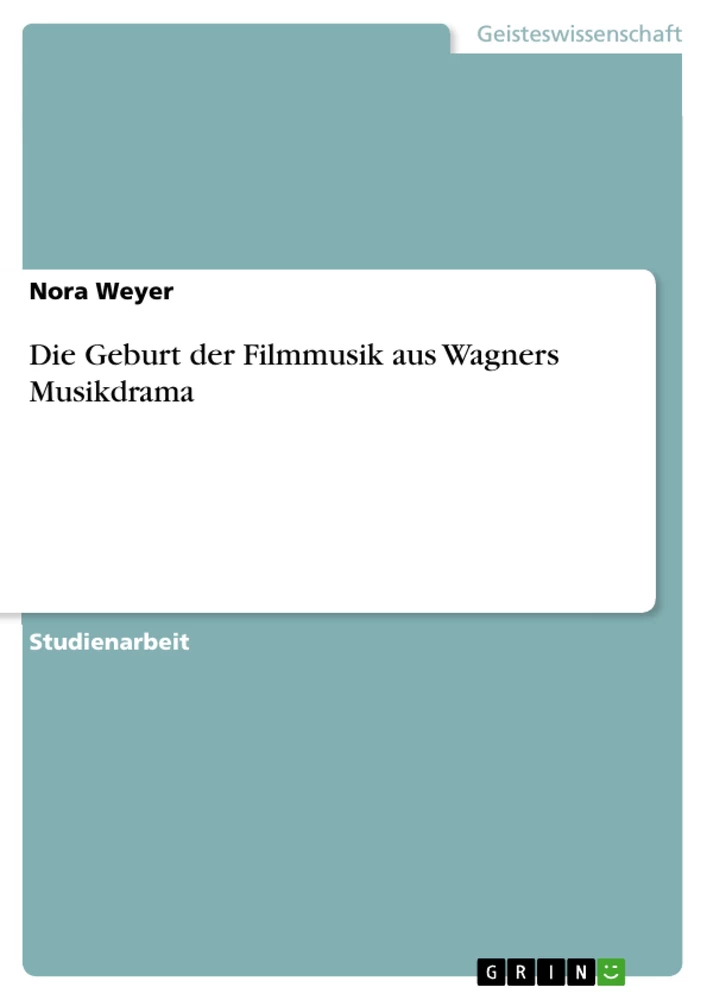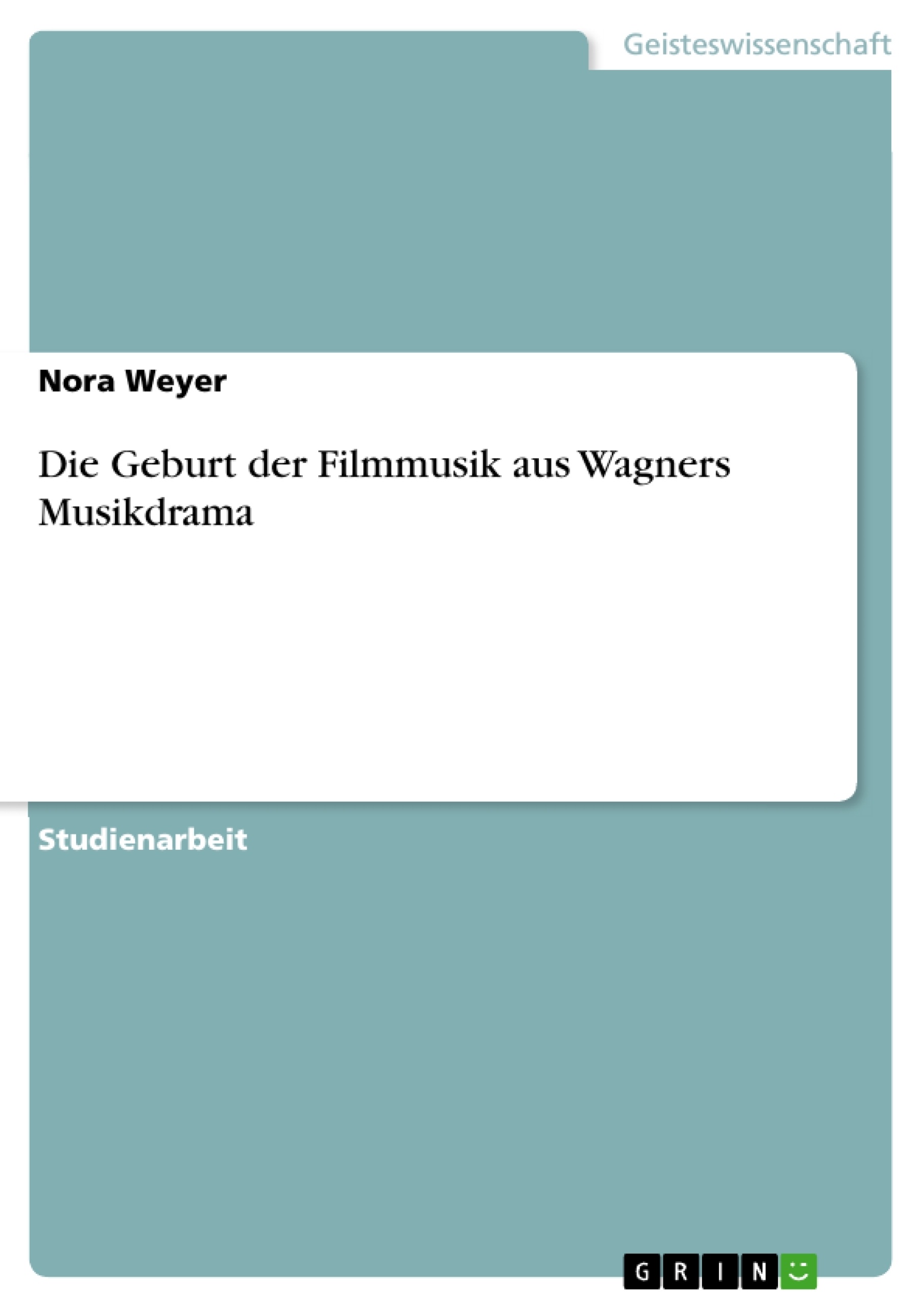„Das große Gesammtkunstwerk, das alle Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten zu Gunsten der Erreichung des Gesammtzweckes aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur, – dieses große Gesammtkunstwerk erkennt er nicht als die willkürlich mögliche That des Einzelnen, sondern als das nothwendig denkbare gemeinsame Werk der Menschen der Zukunft.“
So lässt sich Richard Wagners romantische Idee des Gesamtkunstwerkes auf ein Phänomen übertragen, was schon bald nach seinem Tod im Jahre 1883 seine Vollendung finden sollte: in der Entsheung des Films. Schon früh war sich der Komponist darüber im Klaren, dass das bisherige Theater innerhalb des gegebenen Rahmens am Ende seiner Entwicklung angelangt war. Die griechische Tragödie, sowie die französische Grand opéra nahm er als Vorbild, in seinen Musikdramen verschiedenartige Kunstarten zu einem einheitlichen Kunstwerk zu vereinen.
Der Film verwirklicht letztlich weit radikaler Wagners Idee von der Gleichheit und Zweckmäßigkeit aller Künste. In verschiedene Parameter aufgespaltet stehen neben Gestik, Mimik, Geräuschen, Wortsprache, Licht, Musik und visuellem Rhythmus auch sämtliche filmtechnischen Ausdrucksmittel, wie Schnitt, Perspektive und Tiefenschärfe, welche mit in das „Gesamtkunstwerk“ Film hineinfließen.
Zwei Hauptkomponenten werden im Folgenden beleuchtet: Einerseits das Festspielhaus zu Bayreuth, in welchem mit seiner einzigartigen Bauweise zum ersten Mal in der Geschichte der Opernhäuser das Orchester soweit in den Orchestergraben versenkt wurde, dass es vom Zuschauerraum nicht mehr sichtbar war. Ein ausgeklügeltes akustisches System, wonach der nun „unsichtbare“ Klang nach außen in den Saal dringt, ermöglicht dem Publikum eine volle Konzentration und totale Fokussierung auf die Bühne.
Zum anderen das kompositorische System der Leitmotivik, welches als Raster in Form der später entstandenen Leitmotivtafeln eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem 1927 entwickelten Skalenregister für Kinokapellmeister des italienischen Filmkomponisten Giuseppe Becce auf.
Eine generelle thematische Überschneidung von Oper zu Film lässt sich aber nicht nur beim Wagner´schen Musikdrama finden: In zahlreichen romantischen Opern des 19. Jahrhunderts hat die Hollywoodformel „sex-war-crime-history“ bereits ihre Gültigkeit und bis heute im Film nichts an Aktualität eingebüßt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Festspielhaus zu Bayreuth
- Ästhetik und Illusionismus
- Das Festspielhaus - ein Kinosaal der Zukunft?
- Filmmusik & Wagner
- Die Anfänge der Filmmusik
- Schnittpunkte in der Leitmotivik
- Das thematische Skalenregister nach Becce
- Illustration von Bewegung, Tiefe und Raum
- Wagner im Film
- Weiterentwicklung der Filmmusik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die These, dass die Entwicklung der Filmmusik stark von Richard Wagners Musikdrama beeinflusst wurde. Der Text analysiert, inwiefern Wagners Gesamtkunstwerk-Idee und seine innovativen kompositorischen Ansätze, insbesondere die Leitmotivik, auf die Entstehung und Entwicklung der Filmmusik Einfluss hatten.
- Wagners Einfluss auf die Entwicklung der Filmmusik
- Das Festspielhaus zu Bayreuth und seine Bedeutung für die Musikdramaturgie
- Die Leitmotivik als kompositorisches Prinzip in Wagners Musikdrama und in der Filmmusik
- Die Übertragung von Wagners Ideen auf das filmische Medium
- Die ästhetischen und technischen Parallelen zwischen Musikdrama und Film
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die These, dass die Filmmusik als eine Art „Geburt der Bildsymphonie aus dem Geiste der Musik“ verstanden werden kann. Es wird erläutert, dass Wagners Idee des Gesamtkunstwerks auf den Film übertragen werden kann und wie die Musik im Film die verschiedenen Kunstformen integriert.
Das Kapitel über das Festspielhaus zu Bayreuth analysiert die Bedeutung der Architektur und Akustik für die Inszenierung von Wagners Musikdramen. Es wird dargestellt, wie die versunkene Orchesterposition im Festspielhaus die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Bühne lenkt und den Klang erlebbar macht.
Im Kapitel über Filmmusik und Wagner werden die Anfänge der Filmmusik sowie die Schnittpunkte mit Wagners kompositorischem System der Leitmotivik untersucht. Es wird das thematische Skalenregister von Giuseppe Becce vorgestellt, das Parallelen zur Leitmotivik aufweist, und wie die Musik im Film Bewegung, Tiefe und Raum darstellt.
Das Kapitel über Wagner im Film befasst sich mit der Rezeption von Wagners Musik in Filmen und die Verwendung von Wagner-Motiven. Es wird die Entwicklung der Filmmusik im Kontext von Wagners Musikdrama beleuchtet.
Schlüsselwörter
Filmmusik, Richard Wagner, Gesamtkunstwerk, Leitmotivik, Festspielhaus Bayreuth, Musikdrama, Film, Kunst, Ästhetik, Komposition, Musikgeschichte, Romantik, Schopenhauer, Nietzsche, Becce, Thematisches Skalenregister, Bewegung, Tiefe, Raum.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Richard Wagner die Entstehung der Filmmusik?
Wagners Idee des „Gesamtkunstwerks“ und seine innovative Nutzung der Leitmotivik lieferten die ästhetische und strukturelle Basis für die spätere dramaturgische Rolle der Musik im Film.
Was hat das Bayreuther Festspielhaus mit dem Kino gemeinsam?
Durch den versenkten, unsichtbaren Orchestergraben ermöglichte Bayreuth erstmals eine totale Fokussierung auf das Geschehen auf der Bühne, ähnlich wie die Dunkelheit und der Fokus im modernen Kinosaal.
Was ist das „Thematische Skalenregister“ nach Giuseppe Becce?
Es ist ein 1927 entwickeltes Verzeichnis für Kinokapellmeister, das musikalische Motive bestimmten Stimmungen oder Charakteren zuordnet – eine direkte Weiterentwicklung der Wagner’schen Leitmotivtafeln.
Gilt Wagners „Gesamtkunstwerk“ auch für den modernen Film?
Ja, der Film vereint noch radikaler als die Oper verschiedene Künste wie Licht, Musik, Mimik, Schnitt und visuelle Rhythmen zu einer einheitlichen künstlerischen Darstellung.
Welche Opernthemen finden sich heute in Hollywood wieder?
Die Hollywood-Formel „sex-war-crime-history“ war bereits in den romantischen Opern des 19. Jahrhunderts präsent und bestimmt bis heute die narrativen Strukturen vieler Blockbuster.
- Citation du texte
- Nora Weyer (Auteur), 2007, Die Geburt der Filmmusik aus Wagners Musikdrama, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77416