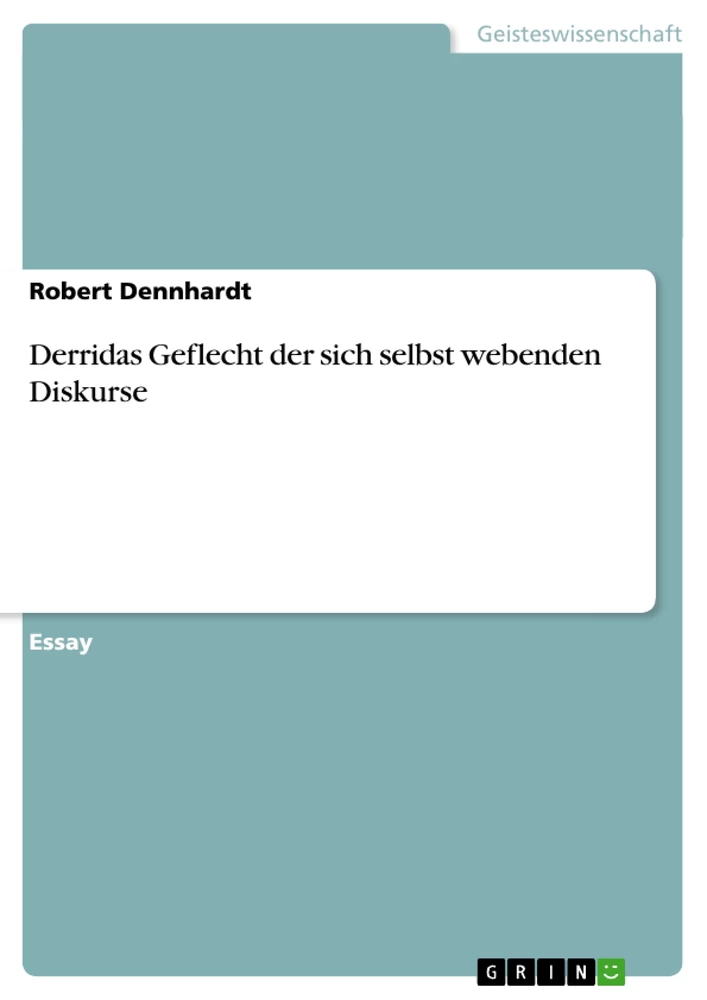Dramatisch offenbart Derrida die Strategie seines Denkens mit der Programmschrift "Die différance" als Versuch, sein unübersichtliches Gedankengeflecht mit dem zentrierenden Griff einer Rede immer wieder neu zu bündeln, da es einen eindeutigen philosophisch argumentativen Anfang innerhalb seiner Aussagen oder gar ein Zentrum aller sich einschreibenden Diskurse nicht geben kann.
Derrida greift in das Netzwerk all seiner Gedanken hinein und erzeugt kein diskursives Zentrum, sondern eine künstlich flottierende Textur, ein Bündel, das „den Charakter eines Einflechtens, eines Webens, eines Bindens hat, welches die unterschiedlichen Linien des Sinns wieder auseinanderlaufen läßt,” (Derrida 1988, 30.) d. h. der Text Die différance.
Zeichensysteme und Schriftkonzepte sind nach Derrida keine Instrumente der Darstellung oder des Ausdrucks, sondern Kulturtechniken, welche die religiösen, politischen, philosophischen und gesellschaftlichen Tendenzen einer Epoche von außen her programmieren. Ob Zeichensysteme nicht wiederum auch relativ epochendeterminert sind, darüber schweigt Derrida. Hieraus ergibt sich die Stellung und Zielsetzung seiner Grammatologie: „Die Grammatologie muß alles, was den Begriff und den Phonologismus verbindet, dekonstruieren.” (Derrida, 1968, 80f.) Es geht der Grammatologie also nicht einfach darum, die für die logozentristischen Wissenschaften nicht erst seit Saussure und die moderne Philosophie symptomatischen Prätentionen von Wahrheit, Vollständigkeit und Präsenz diskursiver Zentren zu negieren, was wiederum ein Paradox ins Zentrum setzen würde, nämlich den Satz: Die einzige Wahrheit ist, daß es keine Wahrheit gibt. Stattdessen fordert Derrida ein Zurückgehen in die metaphysische Epoche als Rekonstruktion der Geschichte und Freudsches Durcharbeiten, d. h. in die dekonstruktivistische Relektüre, die weiß, daß der Logozentrismus nicht einfach suspendiert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Derridas Geflecht der sich selbst webenden Diskurse
- Die différance
- Derrida und die Geschlossenheit
- Derrida und die Struktur des Diskurses
- Derrida und die Sprache
- Derridas Kritik der Metaphysik
- Derrida und die Bastelei
- Derrida und die Dekonstruktion
- Derridas Kritik des Zentrums
- Derridas Konzept der Schrift
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Derridas Denken und die Kritik der abendländischen Metaphysik, insbesondere im Kontext von Sprache, Schrift, Diskurs und Zentrum. Derrida dekonstruiert die traditionellen Konzepte von Zentrum, Ursprung und Präsenz und stellt die Frage nach der Selbstorganisation von Zeichensystemen und Diskursen in den Vordergrund.
- Dekonstruktion der abendländischen Metaphysik
- Kritik des Zentrums und der Präsenz
- Die Rolle der Schrift und der Sprache im Diskurs
- Die Selbstorganisation von Zeichensystemen
- Das Konzept der errance (Umherirren)
Zusammenfassung der Kapitel
- Derridas Geflecht der sich selbst webenden Diskurse: Dieses Kapitel führt in Derridas Denkweise ein und beleuchtet seine Kritik an der traditionellen philosophischen Herangehensweise. Er argumentiert, dass es kein zentrales Zentrum im Diskurs gibt und dass die Schrift als eine Spur, die uns aus sich selbst entlässt, betrachtet werden muss.
- Die différance: Dieses Kapitel analysiert Derridas Konzept der différance, welches die grundlegende Logik des westlichen Denkens in Frage stellt. Die différance bezieht sich auf eine Differenz, die gleichzeitig den Ursprung und das Ende der Unterscheidung beinhaltet, und die somit die Möglichkeit einer eindeutigen Begriffsbildung in Frage stellt.
- Derrida und die Geschlossenheit: Hier diskutiert Derrida die Rolle der Geschlossenheit in der Geschichte des Denkens. Er argumentiert, dass es keine Möglichkeit gibt, aus der geschlossenen Struktur der abendländischen Metaphysik auszubrechen, da alle Denker immer schon von ihr geprägt sind.
- Derrida und die Struktur des Diskurses: Dieses Kapitel fokussiert auf Derridas Analyse der Struktur des philosophischen Diskurses. Er argumentiert, dass die traditionelle Suche nach einem Zentrum oder Ursprung innerhalb des Diskurses zu einem paradoxen Ergebnis führt, da das Zentrum immer schon außerhalb des Diskurses liegt.
- Derrida und die Sprache: Derrida sieht Sprache nicht als Werkzeug der Darstellung oder des Ausdrucks, sondern als eine Kulturtechnik, die die Tendenzen einer Epoche von außen her programmiert. Er hinterfragt die Annahme einer objektiven Bedeutung und betont die Rolle der Schrift und der Sprache in der Konstitution von Bedeutung.
- Derridas Kritik der Metaphysik: Derrida dekonstruiert die zentrale Rolle der Metaphysik in der abendländischen Philosophie. Er argumentiert, dass die Metaphysik von der Annahme eines präsenten Zentrums oder Ursprungs ausgeht, welches jedoch in Wahrheit nie existiert hat.
- Derrida und die Bastelei: In diesem Kapitel wird Derridas Bild der Bastelei (bricolage) vorgestellt, das seine Kritik an der Sprache und der philosophischen Praxis repräsentiert. Derrida argumentiert, dass die Bastelei eine kreative und dekonstruierende Herangehensweise an Sprache und Denken erfordert.
- Derrida und die Dekonstruktion: Derrida entwickelt die Methode der Dekonstruktion als eine kritische Analyse von Texten und Diskursen. Die Dekonstruktion zielt darauf ab, die verborgenen Strukturen und Annahmen von Texten zu enthüllen und ihre vermeintliche Einheit zu hinterfragen.
- Derridas Kritik des Zentrums: Derrida dekonstruiert das Konzept des Zentrums in der Philosophie und in der Kultur. Er argumentiert, dass das Zentrum immer nur ein illusionärer Punkt ist, der durch eine endlose Kette von Substituten ersetzt werden kann.
- Derridas Konzept der Schrift: Dieses Kapitel behandelt Derridas Ansicht der Schrift als einer prägenden Kraft in der Geschichte des Denkens. Er argumentiert, dass die Schrift die Sprache dominiert und die traditionelle hierarchische Beziehung zwischen Sprache und Schrift umkehrt.
Schlüsselwörter
Derrida, Dekonstruktion, Metaphysik, Zentrum, Präsenz, Schrift, Sprache, Diskurs, différance, errance (Umherirren), Bastelei (bricolage), Geschlossenheit (clôture), Logozentrismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Jacques Derrida unter "différance"?
Ein Kunstwort, das sowohl das "Aufschieben" von Bedeutung als auch das "Unterscheiden" beschreibt und die Logik der Präsenz infrage stellt.
Was ist Logozentrismus?
Die Bevorzugung des gesprochenen Wortes (Logos) gegenüber der Schrift in der abendländischen Metaphysik.
Was bedeutet Dekonstruktion bei Derrida?
Es ist keine Zerstörung, sondern eine Analyse, die verborgene Widersprüche und Hierarchien in Texten aufdeckt.
Was meint Derrida mit dem Begriff "Bricolage" (Bastelei)?
Die Verwendung vorhandener Begriffe und Werkzeuge, um neue Bedeutungen zu schaffen, ohne an einen festen Ursprung zu glauben.
Gibt es laut Derrida eine absolute Wahrheit?
Nein, er lehnt die Idee eines festen Zentrums oder einer endgültigen Wahrheit ab, da Bedeutung immer im Fluss ist.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2003, Derridas Geflecht der sich selbst webenden Diskurse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79015