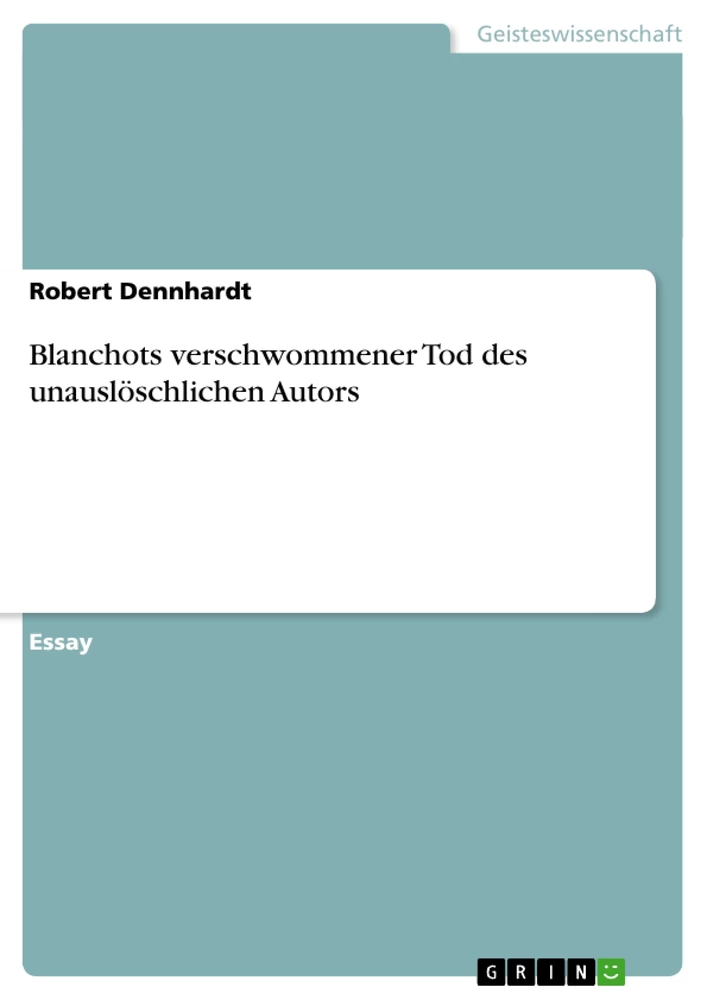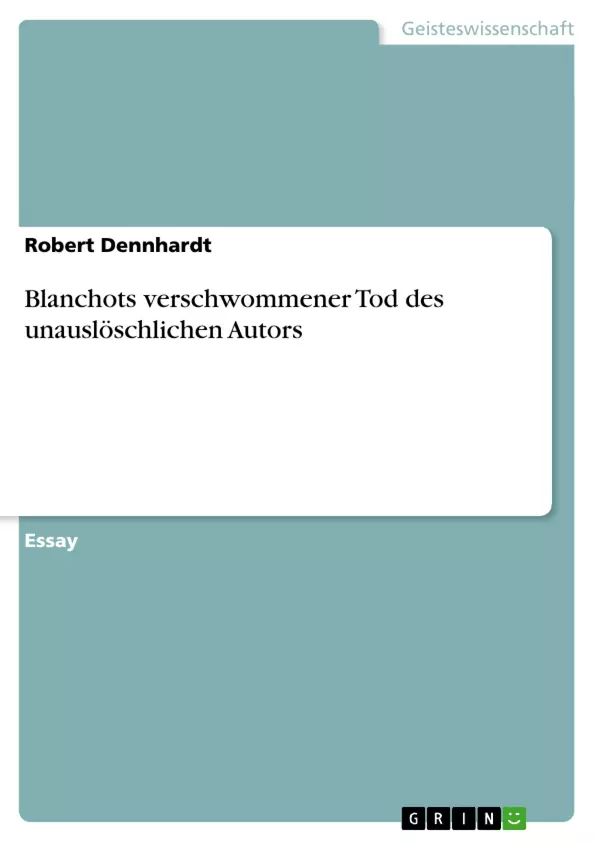Nach dem Erscheinen von Wahnsinn und Gesellschaft und den darin beschriebenen Grenzerfahrungen tragischer Helden erkannte der Literaturtheoretiker und Philosoph Maurice Blanchot in Foucault „einen verwandten Geist, dem er höchstes lob zollte.“ (Miller 1995, 172.) Ähnlich wie Thomas Pynchon in den USA, ist Blanchot seit den fünfziger Jahren einer der bekanntesten unsichtbaren Denker Frankreichs. Sein Werk stellt vor allem eine Auseinandersetzung mit der Negativitätsphilosophie Sartres und den verschiedenen Strömungen der literarischen Moderne dar. Seine eigenen Romane entstanden im Umfeld der französischen experimentellen Literaturform des Nouveau roman, die anfänglich von Samuel Becketts Roman Der Namenlose (1953) vorbereitet wurde.
In seinem einflußreichsten Aufsatz Die Literatur und das Recht auf den Tod gilt Blanchots Interesse einmal mehr dem Akt des Schreibens selbst. Das sinnvolle Anreichern des Gelesenen durch den Leser wird verstärkt durch seine Ablehnung, auf einen geneigten Leser hin zu schreiben. Diese Erfahrung sieht er anfänglich verwirklicht in Kafkas Werk, dessen Texte Blanchot nicht als Leser erklären will, sondern ihnen zuhört, damit „Wörter aufhören, Waffen [identische Begriffe] zu sein [… oder gar] Heilsmöglichkeiten.“ (Blanchot 1993, 6, vgl. 267. Dasselbe meint Philip Roth: „Ein Gespräch ist nicht bloß ein Kreuzfeuer […]. Worte sind nicht bloß Kugeln und Granaten – nein, sie sind kleine Geschenke, die einen Sinn enthalten. (Portnoys Beschwerden, Berlin 1988, S. 224). Ähnliches sagt dagegen H. D. Thoreau: „Die Kugel des Gedankens muß ihre seitliche und ihre Prallbewegung erst überwinden und ihre eigentliche Flugbahn [Sinn] getreten sein, ehe sie das Ohr des Hörers erreicht. (Walden, Zürich 1979, S. 144f).)
Durch seinen Text verschiebt sich immer dieselbe Frage. Warum schreibe ich und wie ist Schreiben überhaupt möglich? Um die Untiefen der Identifikation eines schreibenden Subjekts zu umschiffen, macht Blanchot aus dem Ich des schreibenden Schriftstellers das Du der zeichnenden Feder. Das, was Derrida diesbezüglich den unbeschreiblichen Strich der Schrift oder die nicht darstellbare Bewegung nennt, also das, was ich das Diskursive an sich nenne, befragt Blanchot. Die augenblicklichen Paradoxien stehen fest...
Inhaltsverzeichnis
- Nach dem Erscheinen von Wahnsinn und Gesellschaft
- Gestalten [ziehen] vorüber: substanzlose Gespenster
- Am Anfang von Blanchots Roman Thomas der Dunkle (1941/50)
- Zielgerichteten oder wohlbekannten Pfaden dialektischer oder identischer Präsenz
- In seinem einflußreichsten Aufsatz Die Literatur und das Recht auf den Tod
- Siehst du [zeichnende Schreibfeder] denn nicht, daß deine Tinte keine Spuren hinterläßt
- Schon hier wird der Tod offenbar als unauslöschlicher Gefährte des Schreibens
- Unweigerlich bedeutet dann Schreiben Nietzscheanisch
- Weil im Sprechen über die Dinge nur etwas über ihr Nicht-Sein gesagt werden kann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert Maurice Blanchots Werk im Kontext der französischen Literatur und Philosophie. Insbesondere wird die Beziehung zwischen Schreiben, Tod und dem Wesen des Subjekts untersucht.
- Die Rolle des Schreibens in Blanchots Werk
- Die Bedeutung des Todes als Motiv in Blanchots Literatur
- Die Auseinandersetzung mit der Negativität und dem Unsagbaren
- Die Verbindung von Literatur und Philosophie
- Die Rezeption von Blanchots Werk im Kontext der Postmoderne
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Einführung in Blanchots Werk und seiner Verbindung zu Foucault und Sartre.
- Es wird die Rolle des Schreibens in Blanchots Roman "Thomas der Dunkle" diskutiert, wobei die Unmöglichkeit, das Wesen des Subjekts zu begreifen, im Vordergrund steht.
- Das Kapitel behandelt Blanchots Auseinandersetzung mit dem Konzept der "getrennten Präsenz" und seinen Einfluss auf die Postmoderne.
- Der Text analysiert Blanchots Aufsatz "Die Literatur und das Recht auf den Tod" und sein Interesse am Akt des Schreibens selbst.
- Es wird die Verbindung zwischen Blanchots Schreiben und dem Tod als unauslöschlichen Gefährten des Schreibens untersucht.
- Blanchots Nietzscheanisches Verständnis des Schreibens als ein "Ereignis des Todes" wird diskutiert.
- Der Text untersucht die Bedeutung der Sprache und des Sprechens in Blanchots Werk und die Rolle des Todes im Ausdruck des Seins.
Schlüsselwörter
Maurice Blanchot, Literatur, Tod, Schreiben, Negativität, Postmoderne, Unsagbares, "getrennte Präsenz", Thanatologie, Freiheit, Subjekt, Sprache, Sinn, Signifikant, Signifikat, Saussure.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2003, Blanchots verschwommener Tod des unauslöschlichen Autors, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79021