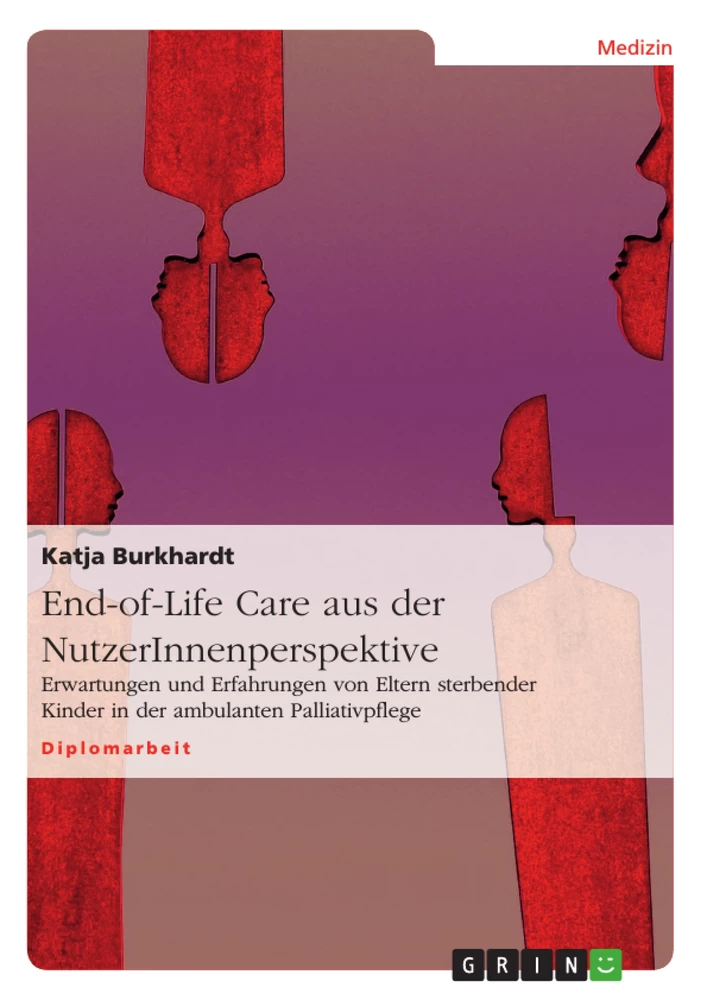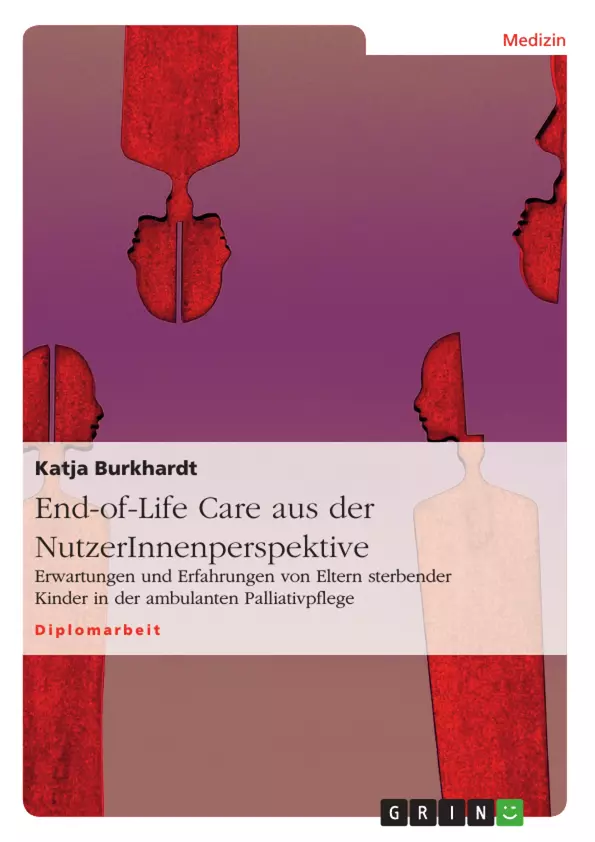Viele sterbende oder schwerstkranke Menschen fühlen sich nicht nach ihren Wünschen versorgt, obwohl die so genannte Palliativversorgung in Deutschland in den letzten Jahren an Relevanz und Interesse gewonnen hat (Vollmann 2001). Gerade in der ambulanten Versorgung sterbender Kinder werden immer wieder Defizite, besonders in der Pflege, diagnostiziert (Wingenfeld 2005). Deswegen ist es wichtig zu erfahren, welche Versorgungsangebote werden wirklich benötigt, sind effektiv wie auch effizient und von den NutzerInnen gewünscht.
Diese Arbeit soll die Sichtweisen, Interessen, Erwartungen und Erfahrungen von Angehörigen sterbender Kinder als NutzerInnen ambulanter gesundheitsbezogener Dienstleistungen besonders der ambulanten Kinderkrankenpflegedienste zum Gegenstand haben.
Das Ziel der Arbeit ist es, zu ermitteln, aufgrund welcher Erwartungen und Erfahrungen welche Hilfsangebote der ambulanten Versorgung, unter spezieller Berücksichtigung der Pflege von Angehörigen/Eltern sterbender Kinder als wirksam, hilfreich und sinnvoll wahrgenommen werden, sodass auch Aussagen zur NutzerInnenzufriedenheit abgeleitet werden können. Daraus können zum einen bestehende Versorgungsbedarfe aus der Sicht der NutzerInnen analysiert und reflektiert und zum anderen Pflegende ihr berufliches Handeln als professionelles Handeln besser begründen sowie umsetzen, wenn sie wissen, welche Erwartungen von NutzerInnen an ihre Dienstleistungen gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- NutzerInnenperspektive und NutzerInnenzufriedenheit
- NutzerInnenperspektive
- NutzerInnenzufriedenheit
- Zur Situation sterbender Kinder und ihrer Eltern
- Epidemiologische und statistische Daten
- Todesursachen
- Lebenslimitierende Erkrankungen im Kindesalter
- Auswirkung der lebenslimitierenden Erkrankung eines Kindes auf die Familie
- End-of-Life Care and Palliative Care
- End-of-Life Care
- Palliative Care
- Palliative Care im Kindesalter
- Das ambulante Versorgungssystem für sterbende Kinder
- Stationäre Versorgung sterbender Kinder und Jugendlicher
- Die ambulante Versorgung sterbender Kinder
- Ambulante Kinderkrankenpflegedienste
- Beratung in der Pflege
- Das methodische Vorgehen
- Die Methode der Grounded Theory
- Die Untersuchung
- Das Forschungsproblem
- Das Ziel und die Fragestellung
- Die Literaturanalyse
- Die Interviews
- Die StudienteilnehmerInnen
- Themenbezogene Instrumente zur Datenerhebung
- Der Interviewleitfaden
- Die Evaluation
- Die Auswertung
- Die Reflexion
- Die fallimmanente Auswertung: Die Fallportraits
- Fallportrait 1 (F1): Familie B.
- Fallverlauf
- Falldiskussion
- Fazit
- Memo 1
- Fallportrait 2 (F2): Frau B.
- Fallverlauf
- Falldiskussion
- Fazit
- Memo 2
- Fallportrait 3 (F3): Herr und Frau F.
- Fallverlauf
- Falldiskussion
- Fazit
- Memo
- Weitere Fallbeispiele
- Fall 4: Frau C.
- Fall 5: Frau D.
- Fall 6: Frau E.
- Memo 4
- Die fallübergreifende Auswertung
- Auswertung der Fragen
- Die Auswirkungen der lebenslimitierenden/tödlichen Erkrankung des Kindes auf das Leben der Eltern (und der Familie)
- Die Kontaktaufnahme zu ambulanten Dienstleistungsangebote
- Der Kontakt zur ambulanten Kinderkrankenpflege
- Wünsche und Erwartungen der Eltern anhand ihrer Erfahrungen
- Die Erwartungen der Eltern als Prozess
- Die Entwicklung des Kategoriesystems
- Die Reflexion
- Vergleich der Auswertungsergebnisse mit der Literaturanalyse
- Folgerungen aus den Auswertungsergebnissen für die ambulante Pflege sterbender Kinder und ihrer Eltern
- Die berufspädagogische Reflexion
- Das deutsche Krankenpflegegesetz
- Analyse von Literatur- und Curriculumsinhalten
- Berufspädagogische Fachliteratur
- Curricula der Pflegegrundausbildung
- Curricula der Fachweiterbildung
- Curricula der Hochschulbildung
- Resümee
- Abschluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Erwartungen und Erfahrungen von Eltern sterbender Kinder in der ambulanten Palliativpflege. Ziel der Arbeit ist es, die Sichtweisen, Interessen und Bedürfnisse dieser Nutzergruppe im Kontext der ambulanten Gesundheitsversorgung zu erforschen. Hierbei liegt der Fokus auf der Analyse von Hilfsangeboten und deren Wirksamkeit aus der Perspektive der Eltern. Die Arbeit strebt nach einer besseren Verständlichkeit der individuellen Bedürfnisse und Erwartungen von Eltern sterbender Kinder, um die Qualität der ambulanten Palliativpflege zu verbessern.
- NutzerInnenperspektive und Zufriedenheit in der ambulanten Palliativpflege für Kinder
- Erfahrungen und Erwartungen von Eltern sterbender Kinder im Kontext der ambulanten Kinderkrankenpflege
- Analyse der Wirksamkeit von Hilfsangeboten aus Sicht der Eltern
- Identifizierung von Versorgungsbedarfen und Verbesserungspotenzialen
- Bedeutung der professionellen Handlungskompetenz in der ambulanten Palliativpflege für Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der ambulanten Palliativpflege für sterbende Kinder ein und beleuchtet die aktuelle Situation und die Bedeutung der NutzerInnenperspektive. Kapitel 1 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen, insbesondere der NutzerInnenperspektive, der NutzerInnenzufriedenheit und der Herausforderungen in der Versorgung von Kindern mit lebenslimitierenden Erkrankungen. Kapitel 2 beschreibt die Methode der Grounded Theory und die Durchführung der Untersuchung. Die Interviews mit Eltern sterbender Kinder stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels. Kapitel 3 präsentiert die fallimmanente Auswertung der Interviews in Form von Fallportraits, die die individuellen Erfahrungen und Erwartungen der Eltern aufzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema End-of-Life Care, insbesondere der ambulanten Palliativpflege für Kinder. Zentrale Themen sind die NutzerInnenperspektive, die NutzerInnenzufriedenheit, die Erwartungen und Erfahrungen von Eltern sterbender Kinder, die Analyse von Hilfsangeboten und deren Wirksamkeit aus Sicht der Eltern, sowie die Identifizierung von Versorgungsbedarfen und Verbesserungspotenzialen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit?
Das Ziel ist es, die Erwartungen und Erfahrungen von Eltern sterbender Kinder in der ambulanten Palliativpflege zu ermitteln und die Nutzerzufriedenheit zu analysieren.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung genutzt?
Die Arbeit nutzt die Methodik der Grounded Theory und führt qualitative Interviews mit betroffenen Eltern durch.
Warum wird die Nutzerperspektive besonders betont?
Weil viele Familien sich trotz des Ausbaus der Palliativversorgung nicht ausreichend nach ihren Wünschen versorgt fühlen und Defizite in der Pflege bestehen.
Welche Rolle spielen ambulante Kinderkrankenpflegedienste?
Sie stehen im Fokus der Untersuchung als zentrale Dienstleister für die häusliche Versorgung schwerstkranker Kinder.
Wie können Pflegende von den Ergebnissen profitieren?
Indem sie die spezifischen Erwartungen der Nutzer kennen, können sie ihr berufliches Handeln besser begründen und professioneller umsetzen.
Was wird unter "End-of-Life Care" verstanden?
Es bezeichnet die umfassende Versorgung und Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase.
- Quote paper
- Diplom-Berufspädagogin für Pflegewissenschaft Katja Burkhardt (Author), 2006, End-of-Life Care aus der NutzerInnenperspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79126