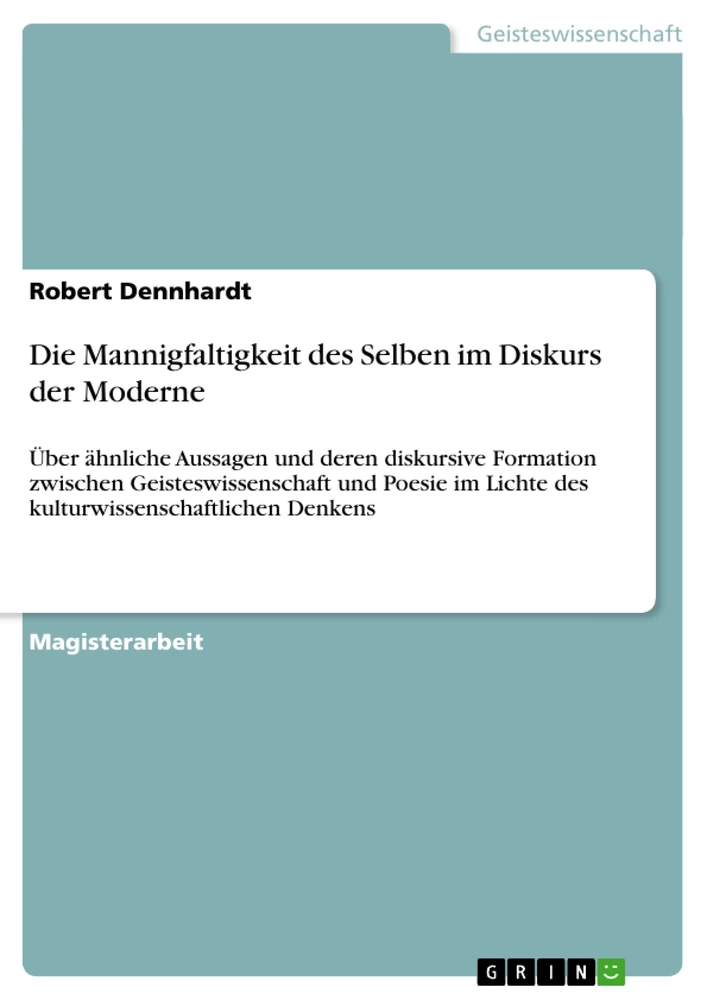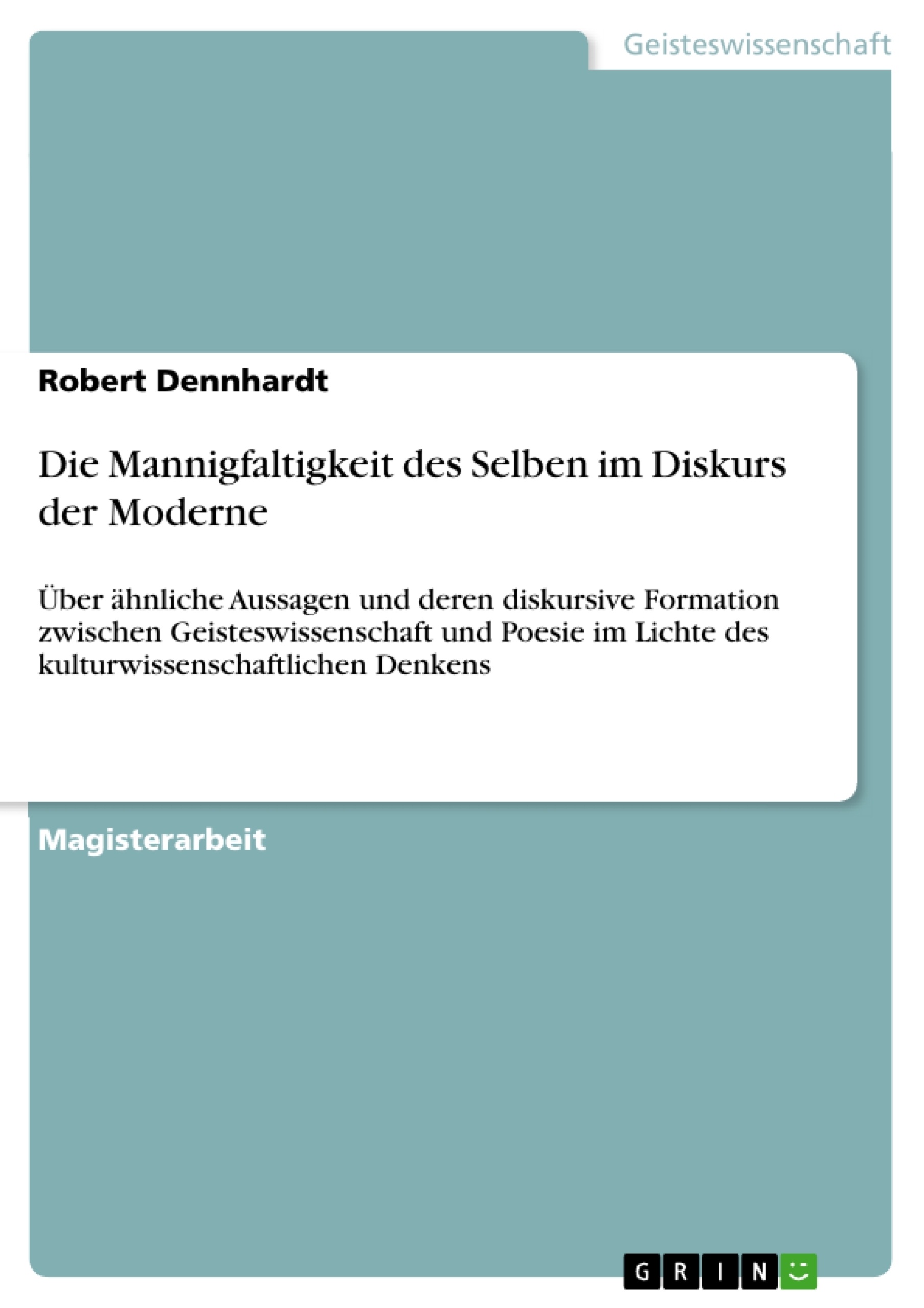Auf die Frage „Was ist ein Diskurs und was wollen uns die Dichter und Denker sagen?“ kann mit vorliegender Arbeit nicht geantwortet werden. Meine Frage lautet „Wie macht sich das Sagen zwischen Aussagen des geisteswissenschaftlichen Diskurses und metaphorischen Konstellationen der Poesie bemerkbar?“ Wie läßt es sich kulturwissenschaftlich denken und analysieren? Eines der wichtigsten Eingeständnisse der modernen Geisteswissenschaften ist, daß epistemologische Zentren wie ein kognitives Selbst, zu vervollkommnende Erfahrung und das Suchen nach letzten Wahrheiten an Bedeutung verlieren. Ein literatur- und diskurstheoretisch reformuliertes Interesse am Text will also nicht Interpretieren und Dekonstruieren. (Vgl. Silverman 1994, 246 und 256.) Vielmehr will ein solches Interesse abendländische Denktraditionen perforieren, indem es diskursive Zentren zum einen identifiziert und zum anderen Formationen ähnlicher Aussagen ihrer Struktur nach differenziert und analysiert. Hierbei erweist sich der topologische Diskurs als sinnvolles epistemologisches Werkzeug, das der Gefahr einer begrifflichen Beliebigkeit bzw. interpretativer Willkür vorbeugt.
Die Kapitel sind historisch geordnet nach Autoren der Sprach-, Kultur- und Literaturphilosophie des zwanzigsten Jahrhunderts. (Saussure, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Deleuze, Serres, Eco, Bachelard, Blanchot, Jabès, Baudrillard). Eine zentrale Aussage der verbalinspirierten Existenzphilosophie Heideggers lieferte hierzu die Initiation. So unmöglich es ist, das Sein des Selben zu identifizieren, offenbaren sich dennoch erkennbare Strukturen der Wiederholung im diskursiven Sprechen der Sprache, d. h. im Sagen des Denkens an sich.
“Darum sagen die wesentlichen Denker stets das Selbe. Das heißt aber nicht: das Gleiche. Freilich sagen sie dies nur dem, der sich darauf einläßt, ihnen nachzudenken. […] In das Gleiche flüchten ist ungefährlich. Sich in die Zwietracht wagen, um das Selbe zu sagen, ist die Gefahr.” (Heidegger 1981, 53.)
Topologische Begriffe wie Ort, relative Lage, Rand, Dimension, Faltung und Mannigfaltigkeit sowie Hier und Anderswo bilden die terminologische Grundlage meiner Analyse. Die danach zu befragenden Begriffspaare sind beispielsweise Aussage – Gedanke, das Selbe – das Andere, der Diskurs – das Diskursive und das Innen – das Außen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Initiation
- Lagebericht über Moderne und Diskursivität
- a Saussures Außen der Schrift und die identische Differenz
- b Wittgensteins Orientierung im Netz
- c Heideggers Glaube an die rettende Gefahr des Selben
- d Derridas Geflecht der webenden Diskurse
- e Foucaults ordentliche Unterwerfung des Diskurses
- f Deleuze' denkende Mannigfaltigkeit des Rhizoms
- g Serres' Selbstorganisation der komplexen Archive
- h Ecos Labyrinthe ähnlicher Texte und Enzyklopädien
- i Bachelards poetischer Raum der Episteme
- j Blanchots verschwommener Tod des Autors
- k Jabès' endloses Buch der Wüstenschrift
- l Baudrillards medialer Rest im anderen Selben
- AnSchluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie sich das "Sagen" zwischen geisteswissenschaftlichen Diskursen und poetischen Metaphern bemerkbar macht und wie dies kulturwissenschaftlich gedacht und analysiert werden kann. Sie hinterfragt die epistemologischen Zentren der Moderne und analysiert die Formationen ähnlicher Aussagen in verschiedenen Denkschulen.
- Die Dekonstruktion epistemologischer Zentren der Moderne
- Analyse diskursiver Formationen ähnlicher Aussagen
- Anwendung topologischer Begriffe zur Diskursanalyse
- Vergleich verschiedener Denkansätze der Sprach-, Kultur- und Literaturphilosophie des 20. Jahrhunderts
- Das Konzept des "Selben" im Diskurs der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort und Initiation: Das Vorwort erläutert die Forschungsfrage, die sich mit der Beziehung zwischen geisteswissenschaftlichem Diskurs und poetischen Metaphern beschäftigt. Es wird betont, dass die Arbeit nicht auf eine definitive Antwort abzielt, sondern die strukturellen Ähnlichkeiten in verschiedenen Aussagen untersucht. Der Bezug auf Cantor's Mannigfaltigkeitslehre unterstreicht die theoretische Grundlage der Analyse, die sich mit der Vielheit des "Selben" auseinandersetzt. Die Auswahl der behandelten Autoren des 20. Jahrhunderts wird als methodisch notwendig dargestellt, um ein breites Spektrum einflussreicher Denkrichtungen zu erfassen. Heideggers Konzept des "Selben" wird als zentrale Inspiration vorgestellt, das trotz der Unmöglichkeit, das Sein zu identifizieren, erkennbare Strukturen der Wiederholung im Diskurs aufzeigt.
Lagebericht über Moderne und Diskursivität: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Begriffs "Moderne" und dessen Bedeutung im Kontext der Literatur und Geisteswissenschaften. Es analysiert den Aufsatz von Eugen Wolff "Die Moderne", der die Abkehr von der Antike und die Betonung des "Lebens als Leben" betont. Die Beschreibung eines fiktiven Herrenabends verdeutlicht die damaligen Debatten über das Wesen der Dichtung und die Rolle der Wissenschaft. Wolffs Definition der Moderne als ein Ideal der Sehnsucht wird in Verbindung mit Hermann Bahrs "Überwindung des Naturalismus" diskutiert. Das Kapitel zeigt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft im Kontext der entstehenden Moderne auf. Die Frage nach dem Wesen der Dichtung wird als zentrales Thema der Epoche präsentiert.
Schlüsselwörter
Moderne, Diskurs, Poesie, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaft, Topologie, Mannigfaltigkeit, das Selbe, das Andere, Heidegger, Saussure, Wittgenstein, Derrida, Foucault, Deleuze, Serres, Eco, Bachelard, Blanchot, Jabès, Baudrillard, Aussage, Gedanke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Lagebericht über Moderne und Diskursivität"
Was ist der Gegenstand des Texts?
Der Text untersucht die Beziehung zwischen geisteswissenschaftlichen Diskursen und poetischen Metaphern in der Moderne. Er analysiert, wie sich "Sagen" in verschiedenen Denkschulen manifestiert und welche strukturellen Ähnlichkeiten in unterschiedlichen Aussagen zu finden sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Dekonstruktion epistemologischer Zentren der Moderne und die Analyse diskursiver Formationen.
Welche Autoren werden behandelt?
Der Text analysiert die Werke und Konzepte folgender Autoren des 20. Jahrhunderts: Saussure, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Deleuze, Serres, Eco, Bachelard, Blanchot, Jabès und Baudrillard. Die Auswahl dient dazu, ein breites Spektrum einflussreicher Denkrichtungen der Sprach-, Kultur- und Literaturphilosophie zu erfassen.
Welche zentralen Themen werden im Text behandelt?
Zentrale Themen sind die Moderne, Diskursanalyse, Poesie, die Beziehung zwischen Geistes- und Kulturwissenschaften, Topologie, das Konzept des "Selben" und des "Anderen", sowie die Analyse von Aussagen und Gedanken in verschiedenen philosophischen und literarischen Kontexten. Die epistemologischen Zentren der Moderne und deren Dekonstruktion bilden einen wichtigen Schwerpunkt.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text beinhaltet ein Vorwort, einen Lagebericht über Moderne und Diskursivität, Kapitelübersichten zu einzelnen Autoren (Saussure bis Baudrillard), die jeweils deren relevante Konzepte im Kontext der Forschungsfrage beleuchten, eine Zusammenfassung der Kapitel sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Methoden werden angewendet?
Der Text verwendet eine vergleichende Analyse verschiedener Denkansätze des 20. Jahrhunderts. Topologische Begriffe werden zur Diskursanalyse herangezogen. Die Arbeit betont die strukturellen Ähnlichkeiten in verschiedenen Aussagen, ohne jedoch auf eine definitive Antwort auf die Forschungsfrage abzuzielen. Heideggers Konzept des "Selben" dient als zentrale Inspirationsquelle.
Was ist die Zielsetzung des Texts?
Die Arbeit will zeigen, wie sich das "Sagen" zwischen geisteswissenschaftlichen Diskursen und poetischen Metaphern bemerkbar macht und wie dies kulturwissenschaftlich gedacht und analysiert werden kann. Sie untersucht die Formationen ähnlicher Aussagen in verschiedenen Denkschulen und hinterfragt die epistemologischen Zentren der Moderne.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis des Texts?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Moderne, Diskurs, Poesie, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaft, Topologie, Mannigfaltigkeit, das Selbe, das Andere, Aussage, Gedanke. Die Namen der behandelten Autoren bilden ebenfalls wichtige Schlüsselbegriffe.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Fragen der Moderne, Diskursanalyse, Literatur- und Kulturphilosophie auseinandersetzt. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den Konzepten der genannten Autoren setzt ein gewisses Vorwissen voraus.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2003, Die Mannigfaltigkeit des Selben im Diskurs der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79266