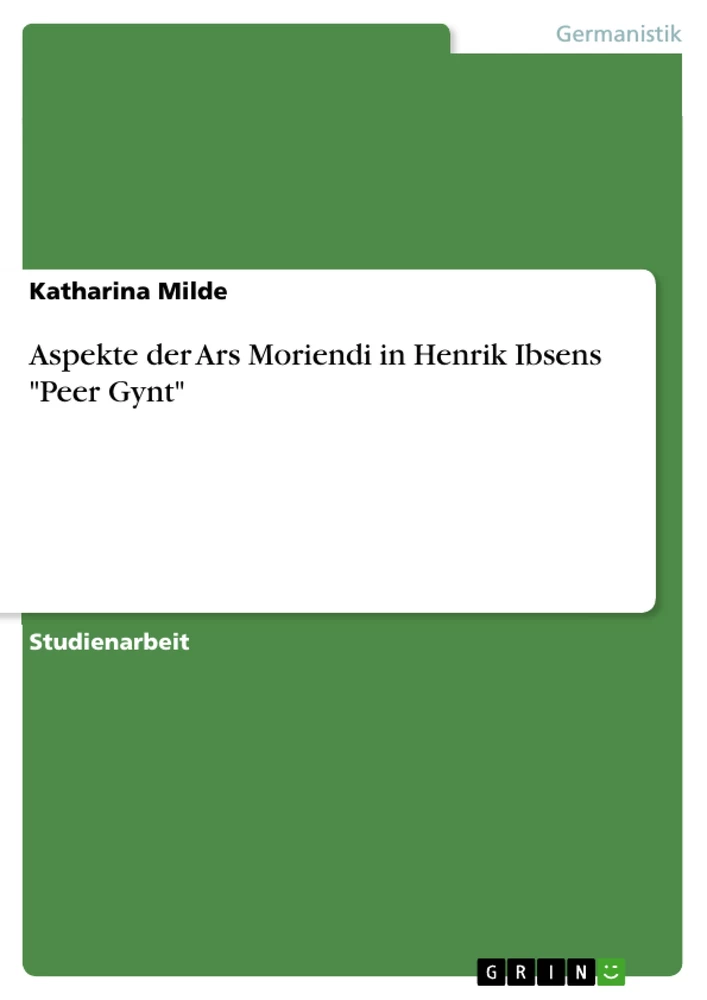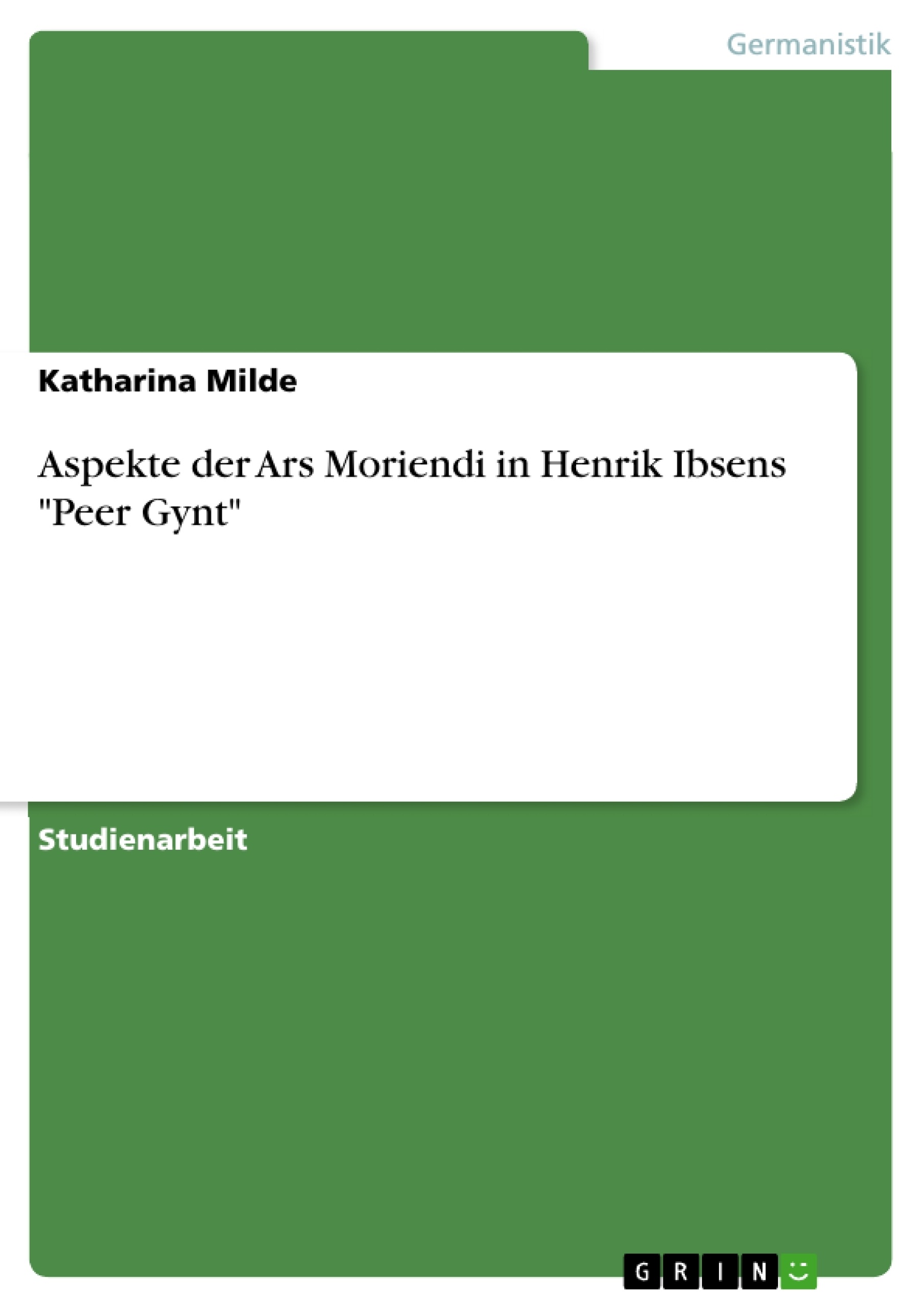Geprägt durch vor allem große Pestepidemien, Hungersnöte und Kriege, erlebt Europa im 7. Jahrhundert eine drastische Minderung der Bevölkerung. Ein Drittel der Bevölkerung findet durch eben diese Ereignisse den grausamen Tod. Die politische Einheit Europas findet ein jähes Ende, und erst im 12. Jahrhundert können die Menschen sich in Sicherheit wiegen. Doch bereits im 14. Jahrhundert folgen erneut die Pest, sowie Hungersnöte, Judenpogrome und der Hundertährige Krieg. Hinrichtungen oder die Verbrennung von Hexen und die Hetze gegen die Juden standen fortan an der Tagesordnung.* Gerade aus diesen Sachverhalten entsteht zu Beginn der frühen Neuzeit im 15. Jahrhundert eine Literaturgattung , die als Ars moriendi bezeichnet wird. Sie zeigt sich vor allem in Sterbebüchern und Erbauungsheften. Das herrschende Lebensgefühl und die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit werden darin deutlich gemacht. Was genau Gegenstand der Ars moriendi ist, soll hier untersucht werden. Wie genau gestaltete sich der Umgang der Menschen mit dem Tod im Mittelalter? Zentrale Frage soll aber des Weiteren sein, ob und welche Wirkung die Ars moriendi noch bis in die frühe Neuzeit und Moderne gehabt hat. Untersucht und deutlich gemacht werden soll dies an einem literarischen Beispiel, an Henrik Ibsens Peer Gynt. Inwieweit existieren hier Aspekte der Ars moriendi? [* Vgl. Arno Borst, Tod im Mittelalter, S. 395ff]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ars moriendi
- Der Tod im Mittelalter
- Gegenstand der Ars moriendi
- Henrik Ibsens Peer Gynt
- Kurze Zusammenfassung von Peer Gynt
- Aspekte der Ars moriendi in Henrik Ibsens Peer Gynt
- Ein Leben im rechten Glauben
- Sinnvoll gelebtes Leben?
- Der Teufel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ars moriendi, eine im 15. Jahrhundert entstandene Literaturgattung, und deren Relevanz bis in die frühe Neuzeit und Moderne. Die zentrale Fragestellung ist, ob und wie Aspekte der Ars moriendi in Henrik Ibsens Peer Gynt erkennbar sind. Die Untersuchung analysiert den Umgang mit dem Tod im Mittelalter und beleuchtet, wie die Ars moriendi den Umgang mit dem Sterben beeinflusste.
- Der Tod im Mittelalter und sein gesellschaftlicher Kontext
- Die Ars moriendi als Literaturgattung und ihre Intentionen
- Die Darstellung von Glauben, Versuchung und Tod in der Ars moriendi
- Analyse von Ibsens Peer Gynt im Hinblick auf Aspekte der Ars moriendi
- Die Bedeutung der Ars moriendi für das Verständnis von Tod und Sterben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Hintergrund der Ars moriendi, geprägt von Pestepidemien, Hungersnöten und Kriegen des Mittelalters, welche die gesellschaftliche Wahrnehmung des Todes prägten. Sie führt die zentrale Forschungsfrage ein: Inwieweit finden sich Aspekte der Ars moriendi in Henrik Ibsens Peer Gynt wieder? Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Umgangs mit dem Tod im Mittelalter und die Analyse des gewählten literarischen Beispiels an.
Die Ars moriendi: Der Tod im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die mittelalterliche Auffassung vom Tod. Im Gegensatz zur modernen Tabuisierung war der Tod im Mittelalter alltäglich und wurde als natürlicher Bestandteil des Lebens akzeptiert. Der Fokus liegt auf der Differenzierung der Todeserfahrung je nach sozialem Status und den unterschiedlichen Formen des Sterbens (z.B. Mors repentina). Der Ablauf mittelalterlicher Todesfeiern wird beschrieben, und es wird auf die ambivalente Wirkung der Gewöhnung an den Tod durch die häufigen Begegnungen mit ihm eingegangen. Die wechselseitige Fürbitte zwischen Lebenden und Toten wird ebenfalls erwähnt.
Die Ars moriendi: Gegenstand der Ars moriendi: Dieses Kapitel beschreibt die Ars moriendi als Literaturgattung der frühen Neuzeit, die das Ziel verfolgte, Menschen beim Erreichen ihres Seelenheils zu unterstützen. Die Bedeutung der Sterbestunde für das Seelenheil wird hervorgehoben, ebenso wie der Glaube an die Versuchung durch den Teufel. Die Form der Ars moriendi, mit ihren meist knappen Texten und aussagekräftigen Illustrationen, die vor allem für eine analphabetische Bevölkerung bestimmt waren, wird erläutert. Die fünf wichtigsten Versuchungen (Glaube, Verzweiflung, Ungeduld, Hochmut und irdische Güter) werden als zentrale Themen genannt, mit dem Teufel als ihrer Inkarnation. Die aufbauende und moralische Funktion der Ars moriendi wird unterstrichen.
Schlüsselwörter
Ars moriendi, Tod, Mittelalter, Henrik Ibsen, Peer Gynt, Sterben, Seelenheil, Teufel, Versuchung, Glaube, Todesauffassung, Literatur, frühe Neuzeit, Moral.
Häufig gestellte Fragen zu "Ars Moriendi und Henrik Ibsens Peer Gynt"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ars moriendi, eine im 15. Jahrhundert entstandene Literaturgattung, und deren Relevanz bis in die frühe Neuzeit und Moderne. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie Aspekte der Ars moriendi in Henrik Ibsens Peer Gynt erkennbar sind. Die Arbeit analysiert den Umgang mit dem Tod im Mittelalter und beleuchtet, wie die Ars moriendi den Umgang mit dem Sterben beeinflusste.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Tod im Mittelalter und sein gesellschaftlicher Kontext; die Ars moriendi als Literaturgattung und ihre Intentionen; die Darstellung von Glauben, Versuchung und Tod in der Ars moriendi; eine Analyse von Ibsens Peer Gynt im Hinblick auf Aspekte der Ars moriendi; und die Bedeutung der Ars moriendi für das Verständnis von Tod und Sterben.
Was ist die Ars Moriendi?
Die Ars moriendi ist eine Literaturgattung der frühen Neuzeit, die Menschen beim Erreichen ihres Seelenheils unterstützen sollte. Sie betont die Bedeutung der Sterbestunde für das Seelenheil und den Glauben an die Versuchung durch den Teufel. Die meist knappen Texte und aussagekräftigen Illustrationen richteten sich vor allem an eine analphabetische Bevölkerung. Zentrale Themen sind die fünf Versuchungen (Glaube, Verzweiflung, Ungeduld, Hochmut und irdische Güter), verkörpert durch den Teufel. Die Ars moriendi hatte eine aufbauende und moralische Funktion.
Wie wird der Tod im Mittelalter dargestellt?
Im Mittelalter war der Tod, im Gegensatz zur modernen Tabuisierung, alltäglich und wurde als natürlicher Bestandteil des Lebens akzeptiert. Die Todeserfahrung unterschied sich je nach sozialem Status und Art des Sterbens (z.B. Mors repentina). Die Arbeit beschreibt mittelalterliche Todesfeiern und die ambivalente Wirkung der Gewöhnung an den Tod durch häufige Begegnungen damit. Die wechselseitige Fürbitte zwischen Lebenden und Toten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt Henrik Ibsens Peer Gynt in dieser Arbeit?
Henrik Ibsens Peer Gynt dient als literarisches Beispiel, um die Relevanz der Ars moriendi in der Moderne zu untersuchen. Die Arbeit analysiert, inwieweit Aspekte der Ars moriendi (z.B. Glauben, Versuchung, Sinn des Lebens) in Peer Gynt erkennbar sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ars moriendi, Tod, Mittelalter, Henrik Ibsen, Peer Gynt, Sterben, Seelenheil, Teufel, Versuchung, Glaube, Todesauffassung, Literatur, frühe Neuzeit, Moral.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Ars moriendi (mit Unterkapiteln zum Tod im Mittelalter und dem Gegenstand der Ars moriendi), ein Kapitel zu Henrik Ibsens Peer Gynt, und ein Fazit. Die Einleitung skizziert den historischen Hintergrund und die Forschungsfrage. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die einzelnen Abschnitte.
- Arbeit zitieren
- Katharina Milde (Autor:in), 2006, Aspekte der Ars Moriendi in Henrik Ibsens "Peer Gynt", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79328