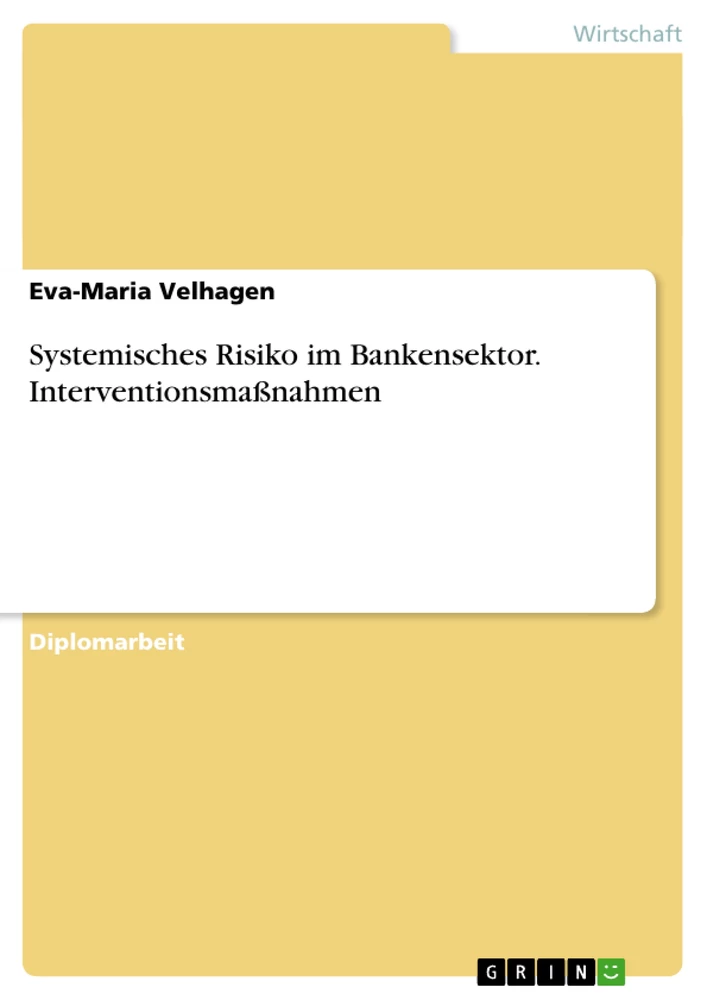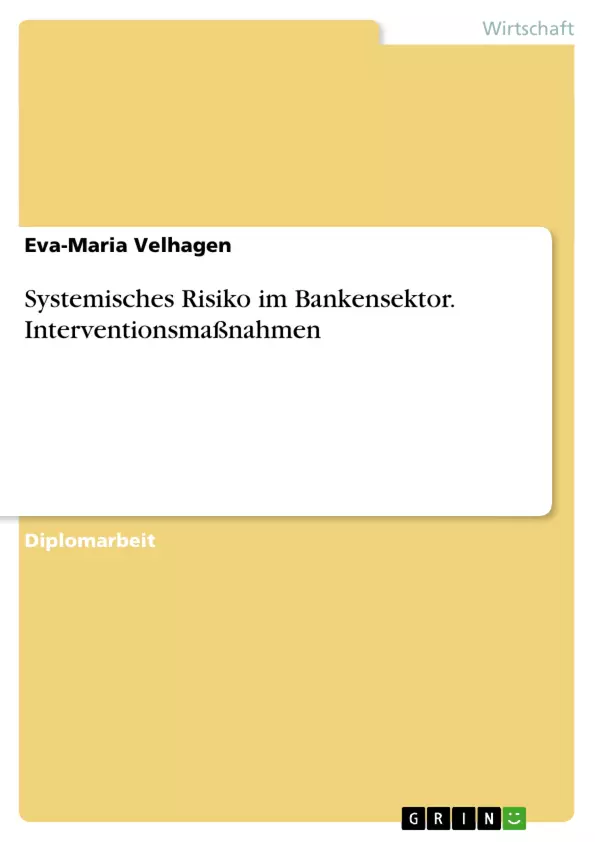Zahlreiche Bankenkrisen der vergangenen Jahrzehnte belegen, dass Störungen bis hin zum Zusammenbruch des gesamten Bankensystems gravierende und weit reichende Folgen nicht nur für die direkt betroffene Volkswirtschaft haben können. Daher ist der Bankensektor in allen Industrieländern einer der am meisten regulierten Wirtschaftsbereiche.
Verantwortlich für die Fragilität des Bankensektors sind zwei Besonderheiten der Geschäftsstruktur des Bankenwesens. Zum einen bestehen die Vermögensgegenstände einer Bank größtenteils aus langfristigen, illiquiden Investitionen, die durch kurzfristige und jederzeit kündbare Einlagen mit einem festen Zinsversprechen refinanziert werden. Werden diese Einlagen simultan zurückgefordert, so besteht die Gefahr, dass die von der Bank gehaltenen Liquiditätsreserven nicht ausreichen um allen Zahlungsforderungen nachzukommen. Zum anderen sind Banken über ein dichtes Netz wechselseitiger nationaler sowie internationaler Zahlungsverpflichtungen und Geschäftsbeziehungen miteinander verbunden.
Das mit Abstand wichtigste Ziel der Bankenregulierung ist die Vermeidung des systemischen Risikos. Der Begriff des systemischen Risikos beinhaltet, dass der Bankensektor und davon ausgehend das gesamte Finanzsystem aufgrund eines Schocks, der zunächst nur ein einzelnes Kreditinstitut betrifft, zusammenbrechen kann. In der Literatur wird dies als systemisches Risiko im engeren Sinne bezeichnet. Das systemische Risiko im weiteren Sinne beinhaltet zusätzlich die Gefahr, dass aufgrund eines makroökonomischen Schocks, wie einem Zinsanstieg, einem Schock auf den Finanzmärkten oder einer Währungsabwertung der simultane Zusammenbruch mehrerer oder sogar aller Kreditinstitute erfolgen kann.
Die vorliegende Arbeit wird sich im Besonderen mit dem systemischen Risiko im engeren Sinne beschäftigen, dessen Kernelemente die Ansteckung von Kreditinstituten ist, welche ursprünglich solvent und nicht von dem Schock betroffen waren. Ziel dieser Arbeit es die Ansteckungsmechanismen, die zu einer systemweiten Bankenkrise führen können, zu analysieren. Des Weiteren soll untersucht werden, welche Interventionsmaßnahmen geeignet erscheinen, um die Sicherheit und Stabilität des Bankensystems zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Informationseffekte
- Der Modellrahmen von Chen (1999)
- Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
- Der Sichteinlagenvertrag
- Rationales Herdenverhalten – Ursache systemweiter Bankenkrisen
- Das Einlagensicherungssystem
- Zusammenfassung der Modellergebnisse
- Dominoeffekte durch Interbankeneinlagen
- Der Modellrahmen von Dasgupta (2004)
- Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
- Die Auszahlungen
- Die Spielbeschreibung
- Das Gleichgewicht
- Das Gleichgewicht im statischen Spiel
- Das Gleichgewicht im dynamischen Spiel
- Ansteckung verursacht durch Interbankeneinlagen
- Optimale Höhe der Interbankeneinlagen
- Zusammenfassung der Modellergebnisse
- Dominoeffekte durch das Interbanken-Zahlungssystem
- Der Modellrahmen von Freixas et al. (2000)
- Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
- Das Reiseverhalten der Individuen
- Die optimalen Strategien der Individuen
- Risiken im Interbanken-Zahlungssystem
- Interventionsmaßnahmen seitens der Zentralbank
- Zusammenfassung der Modellergebnisse
- Vermögenseffekte
- Der Modellrahmen von Goldstein und Pauzner (2004)
- Das Gleichgewicht
- Das Gleichgewicht in Land 2
- Das Gleichgewicht in Land 1
- Ansteckung verursacht durch Portfoliodiversifikation
- Korrelation zwischen den Investitionserträgen
- Modellerweiterung
- Zusammenfassung der Modellergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Mechanismen der Ansteckung von Kreditinstituten, welche zu einer systemweiten Bankenkrise führen können. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Folgen des systemischen Risikos im Bankensektor zu entwickeln und geeignete Interventionsmaßnahmen zu erforschen, um die Sicherheit und Stabilität des Bankensystems zu gewährleisten.
- Informationseffekte und ihre Auswirkungen auf das Bankensystem
- Dominoeffekte durch Interbankeneinlagen und das Interbanken-Zahlungssystem
- Vermögenseffekte und die Rolle der Portfoliodiversifikation
- Die Bedeutung von Rationalität und Herdenverhalten in Bankenkrisen
- Möglichkeiten zur Vermeidung und Abmilderung von systemischem Risiko
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des systemischen Risikos im Bankensektor ein und erläutert die wichtigsten Ursachen und Folgen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Informationseffekten im Bankensektor und analysiert die Auswirkungen von rationalem Herdenverhalten auf das systemische Risiko. Kapitel 3 untersucht die Dominoeffekte, die durch Interbankeneinlagen entstehen können und die Bedeutung der Interbanken-Zahlungssysteme für die Ansteckungsgefahr. Kapitel 4 analysiert die Vermögenseffekte im Bankensektor und die Rolle der Portfoliodiversifikation für die Entstehung von systemischem Risiko.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem systemischen Risiko im Bankensektor, einem zentralen Thema der modernen Finanzökonomie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Systemisches Risiko, Ansteckung, Bankenkrisen, Informationseffekte, Interbankeneinlagen, Interbanken-Zahlungssystem, Vermögenseffekte, Portfoliodiversifikation, Rationalität, Herdenverhalten, Interventionsmaßnahmen, Finanzstabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter systemischem Risiko im Bankensektor?
Es beschreibt die Gefahr, dass der Ausfall einer einzelnen Bank eine Kettenreaktion auslöst, die das gesamte Finanzsystem zum Zusammenbruch bringen kann.
Wie entstehen Dominoeffekte zwischen Banken?
Dominoeffekte entstehen primär durch Interbankeneinlagen und vernetzte Zahlungssysteme, über die finanzielle Schieflagen direkt an andere Institute weitergegeben werden.
Welche Rolle spielt „rationales Herdenverhalten“ bei Bankenkrisen?
Informationseffekte können dazu führen, dass Einleger massenhaft ihre Gelder abziehen (Bank Run), wenn sie glauben, dass andere Einleger dasselbe tun, was auch solvente Banken gefährdet.
Was sind geeignete Interventionsmaßnahmen gegen systemische Risiken?
Dazu gehören Einlagensicherungssysteme, Liquiditätshilfen durch Zentralbanken und eine strenge Bankenregulierung zur Begrenzung von Ansteckungsgefahren.
Wie beeinflusst Portfoliodiversifikation das Ansteckungsrisiko?
Während Diversifikation das Risiko einzelner Banken senkt, kann sie über Vermögenseffekte dazu führen, dass Krisen in einem Markt schneller auf andere Märkte und Institute übertragen werden.
- Citation du texte
- Diplom Volkswirtin Eva-Maria Velhagen (Auteur), 2007, Systemisches Risiko im Bankensektor. Interventionsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79594