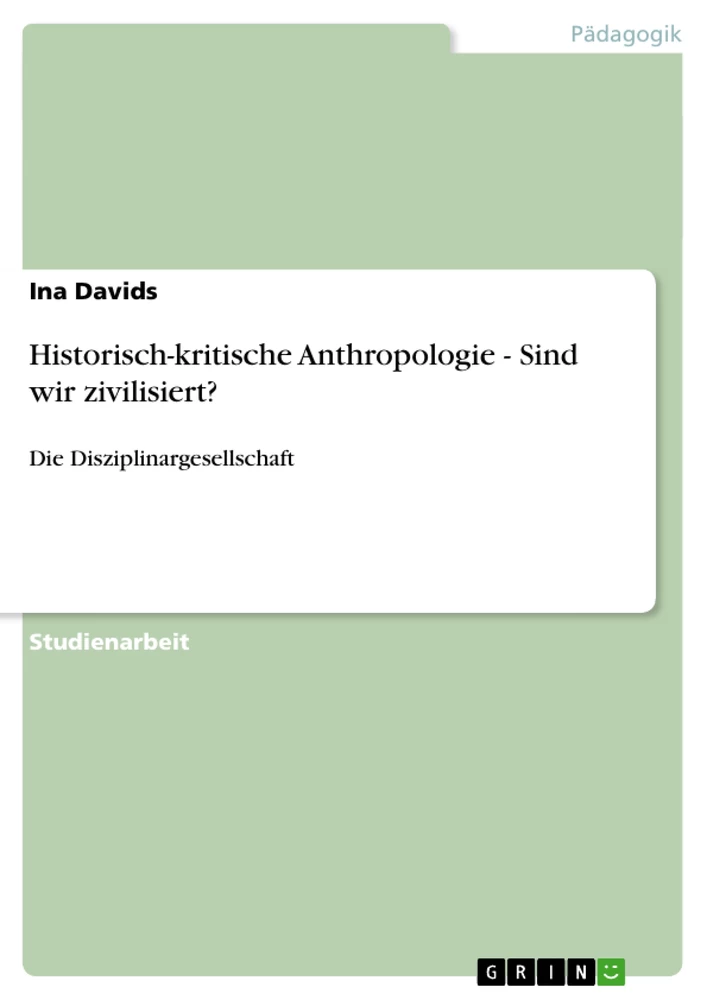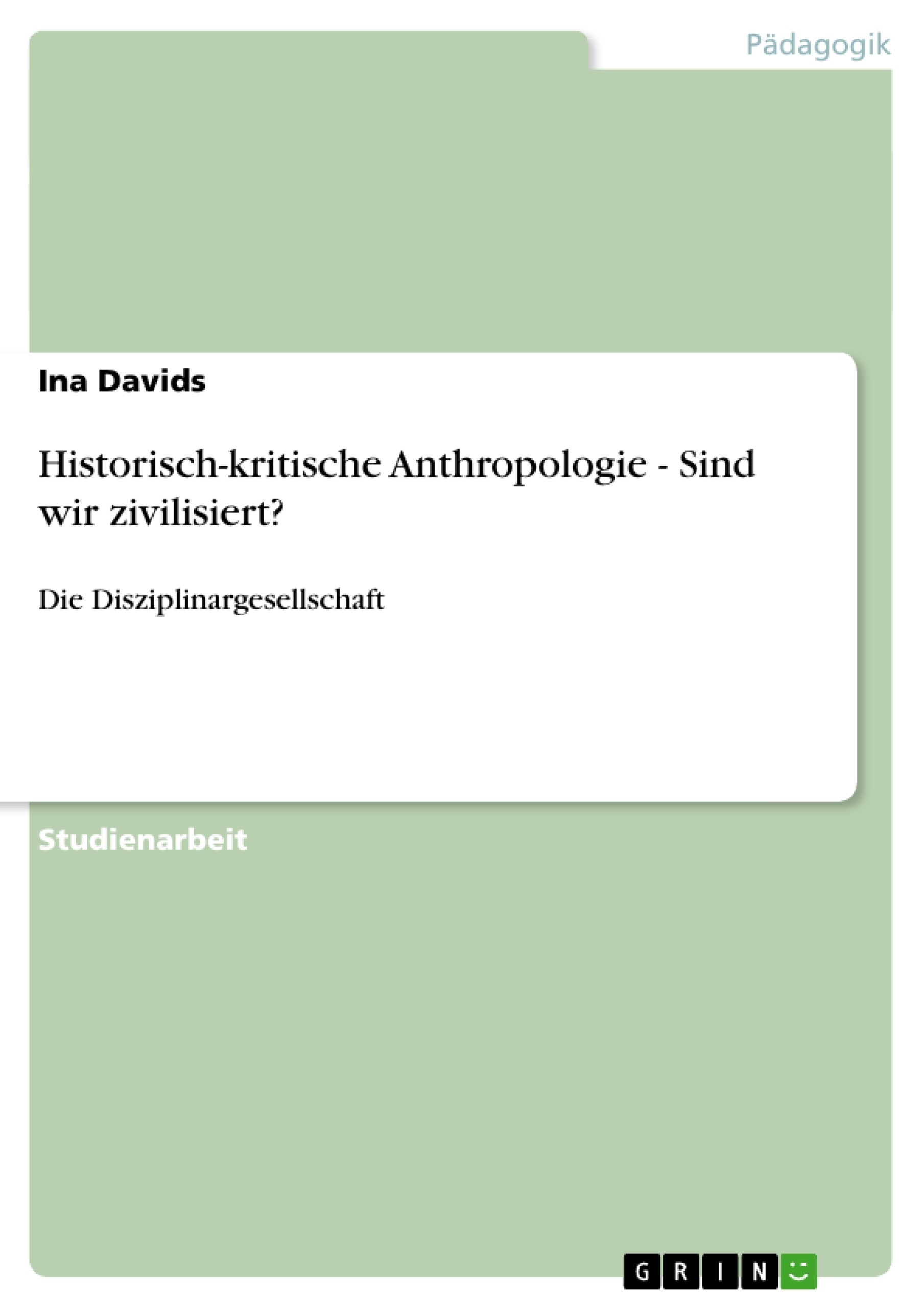Disziplin wurde in ihren ersten Zügen durchgeführt durch die Bestrafung von Verbrechern. Macht und Herrschaft wurde durch die körperliche und grausame Bestrafung deutlich. Diese Art der Bestrafung beeindruckte das Volk. Die Wunden die, die Bestrafung hinterließ, zeigte die Macht der Vollzieher, und der Respekt und die Unterwürfigkeit ihnen gegenüber stieg. Dass Gefängnis kann als Institution gesehen werden, die den Verbrecher kontrolliert und diszipliniert.
Durch Forschungen im 17. Jahrhundert wurde die Bevölkerung untersucht und deren Probleme erkannt. Nützlichkeit und Nutzbarmachung eines jeden Individuums bekam immer mehr Bedeutung für die Mächtigen. Dieses konnte erreicht werden durch Disziplin. Die verschiedenen Disziplinartechniken verbreiteten sich auf immer mehr Institutionen ab dem 18. Jahrhundert.
„Die alten Gewaltsysteme wurden durch subtile vernetzte Techniken und Taktiken anonymer Machtkalküle abgelöst“.
Das Ziel ist eine Machtausübung auf die Psyche. Allerdings muss erst der Körper kontrolliert werden, um Kontrolle über die Gedanken und Gefühle des Menschen zu bekommen.
Foucault spricht von einer „Dispositive der Macht“, was bedeutet, dass immer feiner werdende Netzte versuchen das Individuum in seinem Handeln zu kontrollieren. Die Pädagogik bedient sich auch verschiedener Disziplinartechniken zur Kontrolle des Zöglings.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess
- 3. Der Familiensinn und die Disziplin
- 4. Der Totalitätsanspruch des Erziehers
- 5. Die Kontrolle des Körpers
- 6. Die Kontrolle des Verhaltens durch Erziehungsinstrumente
- 7. Die Kontrolle durch Zeitmanagement
- 8. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Prozess der Zivilisation unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Erziehung und Disziplin. Sie analysiert, wie Disziplinartechniken eingesetzt wurden und werden, um Körper und Verhalten zu kontrollieren und Individuen in gesellschaftliche Strukturen einzubinden. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und den Auswirkungen dieser Praktiken auf die Individuen.
- Die historische Entwicklung von Disziplinartechniken
- Die Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess
- Der Einfluss des "Familiensinns" auf die Erziehung
- Der Totalitätsanspruch des Erziehers und seine Auswirkungen
- Die Kontrolle von Körper und Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der historisch-kritischen Anthropologie und die Frage nach der Zivilisation ein. Sie skizziert die Entwicklung von Disziplinierungstechniken von der körperlichen Bestrafung hin zu subtileren Formen der Machtausübung über die Psyche. Der Fokus liegt auf der Analyse von Disziplinargesellschaften und der Rolle der Pädagogik in diesem Kontext. Foucault's Konzept des "Dispositivs der Macht" wird als theoretischer Rahmen eingeführt.
2. Die Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess anhand der Theorien von Norbert Elias. Elias' Konzept des Zivilisationsprozesses wird erläutert, mit dem Fokus darauf, wie individuelle Entwicklungsprozesse die kollektive Geschichte widerspiegeln. Die Arbeit beleuchtet die paradoxe Situation, dass trotz der Kontrolle der "Partialtriebe" die Entwicklungsaufgaben scheinbar ungelöst bleiben und die Verhaltensregulierungen und Triebunterdrückungen nicht explizit gerechtfertigt werden. Der kontroverse Aspekt des Verzichts auf Süßigkeiten im 19. Jahrhundert wird als Beispiel für die frühzeitige Regulierung von Trieben diskutiert.
3. Der Familiensinn und die Disziplin: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung des "Familiensinns" und seinen Einfluss auf die Erziehung. Es vergleicht die mittelalterliche Kindererziehung mit der Erziehung in späteren Epochen und stellt die Frage nach der Entstehung des modernen Konzepts von Kindheit und Erziehung. Die Arbeit argumentiert, dass die zunehmende Bedeutung der Erziehung nicht innerhalb der Familie entstand, sondern von außen durch das Schulsystem beeinflusst wurde. Die Rolle der Mutter und ihre Notwendigkeit im Kontext der Erziehung werden kritisch analysiert.
4. Der Totalitätsanspruch des Erziehers: Hier wird der Totalitätsanspruch des Erziehers kritisch beleuchtet. Die Arbeit diskutiert die "irrationale Rationalität" der Erziehung und ihre Wurzeln in unbewussten Ängsten des Erwachsenen. Rousseaus Emile wird als Beispiel für den Totalitätsanspruch des Erziehers angeführt, der versucht, den Zögling als "tabula rasa" zu formen und somit seine Entwicklung komplett zu kontrollieren. Die "Fabrikation des Kindes" wird als zentrales Thema des Kapitels herausgestellt.
5. Die Kontrolle des Körpers: Das Kapitel widmet sich der Kontrolle des Körpers als Instrument der Macht. Es unterscheidet zwischen der anatomisch-metaphysischen und der technisch-politischen Perspektive auf die Körperkontrolle. Die Arbeit untersucht die zunehmende Ausfeinerung der Disziplinierungstechniken im Laufe der Geschichte und ihre Anwendung im militärischen Kontext. Die Eliminierung von Spontanität und Naturwüchsigkeit des Kindes wird als Ziel der Erziehung identifiziert, wobei die Erziehung bereits im Säuglingsalter beginnt.
Schlüsselwörter
Zivilisationsprozess, Disziplin, Erziehung, Disziplinargesellschaft, Körperkontrolle, Machtausübung, Familiensinn, Totalitätsanspruch des Erziehers, Norbert Elias, Michel Foucault, Schwarze Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Zivilisationsprozess und die Rolle der Erziehung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zivilisationsprozess unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Erziehung und Disziplin. Sie analysiert, wie Disziplinartechniken eingesetzt wurden und werden, um Körper und Verhalten zu kontrollieren und Individuen in gesellschaftliche Strukturen einzubinden. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und den Auswirkungen dieser Praktiken auf die Individuen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung von Disziplinartechniken, die Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess, den Einfluss des "Familiensinns" auf die Erziehung, den Totalitätsanspruch des Erziehers und seine Auswirkungen sowie die Kontrolle von Körper und Verhalten. Es werden Theorien von Norbert Elias und Michel Foucault herangezogen.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Norbert Elias (Zivilisationsprozess) und Michel Foucault (Dispositiv der Macht). Rousseaus "Emile" wird als Beispiel für den Totalitätsanspruch des Erziehers angeführt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Rolle der Erziehung im Zivilisationsprozess, zum Familiensinn und Disziplin, zum Totalitätsanspruch des Erziehers, zur Körperkontrolle und zur Kontrolle des Verhaltens durch Erziehungsinstrumente. Sie beinhaltet zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche zentralen Aspekte der Körperkontrolle werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der anatomisch-metaphysischen und der technisch-politischen Perspektive auf die Körperkontrolle. Es wird die zunehmende Ausfeinerung der Disziplinierungstechniken im Laufe der Geschichte und deren Anwendung im militärischen Kontext untersucht. Die Eliminierung von Spontanität und Naturwüchsigkeit des Kindes wird als Ziel der Erziehung identifiziert.
Wie wird der "Familiensinn" definiert und analysiert?
Das Kapitel zum "Familiensinn" untersucht dessen Entstehung und Einfluss auf die Erziehung. Es vergleicht die mittelalterliche Kindererziehung mit der Erziehung späterer Epochen und hinterfragt die Entstehung des modernen Konzepts von Kindheit und Erziehung. Die Rolle der Mutter und der Einfluss des Schulsystems werden kritisch beleuchtet.
Was versteht die Arbeit unter dem "Totalitätsanspruch des Erziehers"?
Der "Totalitätsanspruch des Erziehers" wird als Versuch beschrieben, den Zögling als "tabula rasa" zu formen und seine Entwicklung komplett zu kontrollieren. Die "irrationale Rationalität" der Erziehung und ihre Wurzeln in unbewussten Ängsten des Erwachsenen werden diskutiert. Rousseaus "Emile" dient als Beispiel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zivilisationsprozess, Disziplin, Erziehung, Disziplinargesellschaft, Körperkontrolle, Machtausübung, Familiensinn, Totalitätsanspruch des Erziehers, Norbert Elias, Michel Foucault, Schwarze Pädagogik.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine historisch-kritische Analyse des Zivilisationsprozesses und der Erziehungsmethoden. Sie greift auf theoretische Konzepte von Elias und Foucault zurück und analysiert historische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Individuen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die Themen Zivilisationsprozess, Erziehung, Disziplin und Macht interessiert. Sie eignet sich besonders für Studierende der Geschichtswissenschaften, Soziologie, Pädagogik und verwandter Disziplinen.
- Citation du texte
- Ina Davids (Auteur), 2006, Historisch-kritische Anthropologie - Sind wir zivilisiert? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79627