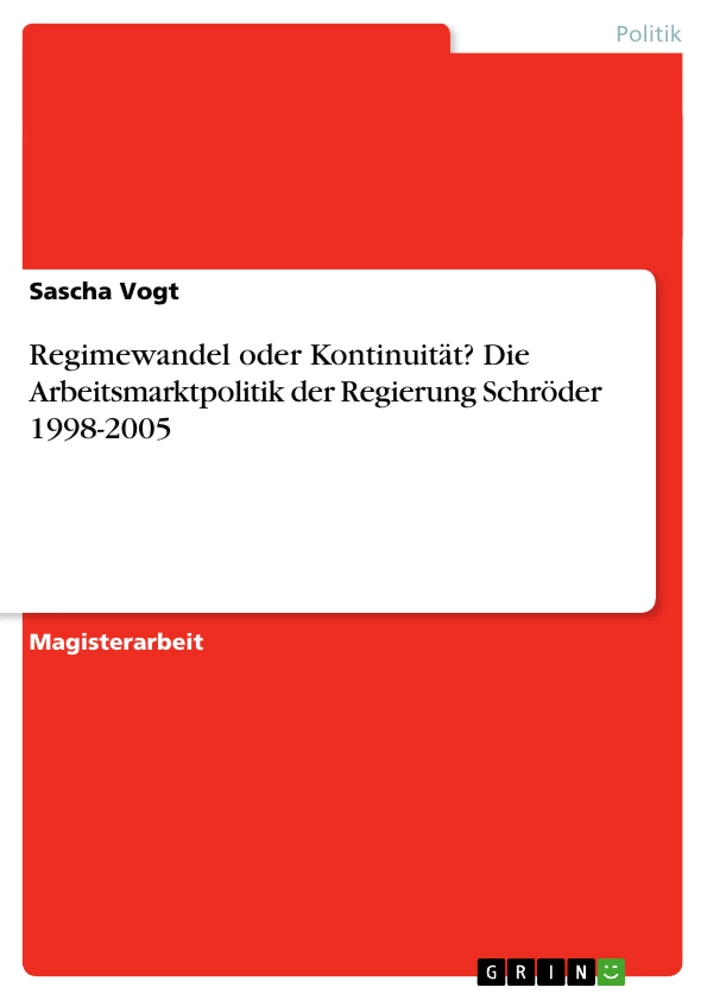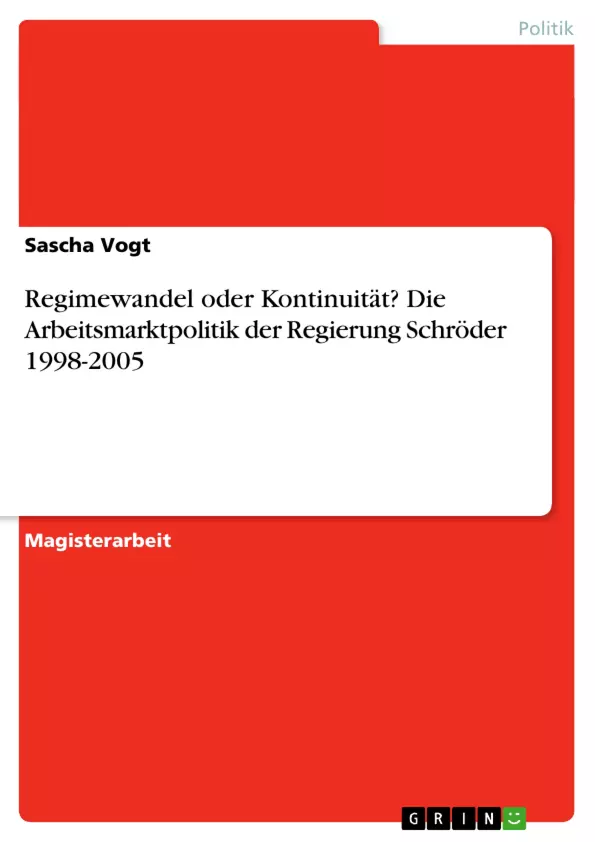Bis in die 90er Jahre hinein galt Deutschland in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung als Musterbeispiel für ein konservatives Wohlfahrtsstaats- und - daraus abgeleitet - auch Arbeitsmarktregime. Mit der Amtsübernahme der rot-grünen Bundesregierung war ab 1998 zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Regierung 'links der Mitte' im Amt. Auch wenn sich Regime nicht 'über Nacht' verändern, hätte damit erwartet werden können, dass sich auch das deutsche Arbeitsmarktregime in einem sozialdemokratischen Sinne verändert. Die in der öffentlichen Debatte besonders umstrittenen 'Hartz-Reformen' legen jedoch auf den ersten Blick einen anderen Schluss nahe. Gleichwohl erscheint eine allein auf den Umbau der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung fokussierte Analyse rot-grüner Arbeitsmarktpolitik zu eng, da so andere wichtige Bereiche dieses Politikfeldes, etwa das Arbeitsrecht, außen vor bleiben würden. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht, ob und wie sich nach sieben Jahren rot-grüner Arbeitsmarktpolitik das deutsche Arbeitsmarktregime verändert hat: Ist es tatsächlich zu einer (weiteren) Annäherung an den liberalen Regimetyp gekommen oder finden sich auch verstärkt sozialdemokratische Elemente? Kann das deutsche Arbeitsmarktregime insgesamt noch immer als konservativ bezeichnet werden?
Hierzu erfolgt in einem ersten Schritt eine Verortung des deutschen Arbeitsmarktregimes innerhalb der in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung noch immer prominenten Typologie Esping-Andersens vor Beginn der Amtszeit der Regierung Schröder. Dabei wird insbesondere auch auf die entscheidenden Merkmale, die für eine Einordnung Deutschlands in das konservative Regime sprechen, eingegangen. In einem zweiten Schritt werden die externen Herausforderungen, mit denen die rot-grüne Bundesregierung konfrontiert war, kurz skizziert, um eine verbesserte Einordnung von Entscheidungen vornehmen zu können. Im Hauptteil schließlich wird die Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung umfassend und getrennt nach den Aspekten 'Makroökonomische Beschäftigungsstrategie', 'Arbeitsrecht'. 'Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung' sowie 'Maßnahmen zur Beeinflussung der Größe des Arbeitsangebots' untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemaufriss und Fragestellung
- 1.2 Begriffsexplikationen und Abgrenzung des Politikfeldes
- 1.3 Weiteres Vorgehen
- 1.4 Stand der Literatur
- 2. Die typologische Verortung des deutschen Arbeitsmarktregimes
- 2.1 Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus
- 2.1.1 Grundzüge der Typologie
- 2.1.2 Implikationen der, drei Welten' für das Arbeitsmarktregime
- 2.2 Kritik der Typologie und Schlussfolgerungen für das Vorgehen
- 2.3 Entwicklung und Verortung des deutschen Arbeitsmarktregimes
- 3. Herausforderungen für das deutsche Arbeitsmarktregime
- 3.1 Globalisierung
- 3.2 Produktivitätssteigerung und Tertiarisierung der Wirtschaft
- 3.3 Europäische Union
- 3.4 Deutsche Wiedervereinigung
- 3.5 Gesellschaftlicher Strukturwandel
- 4. Die Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung
- 4.1 Makroökonomische Beschäftigungsstrategie
- 4.1.1 Die erste Legislaturperiode: Das Bündnis für Arbeit
- 4.1.2 Die zweite Legislaturperiode: Die,Agenda 2010'
- 4.2 Veränderungen des Arbeitsrechts
- 4.3 Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung
- 4.4 Beeinflussung der Größe des Arbeitsangebots
- 5. Fazit
- 5.1 Zusammenführung der Ergebnisse
- 5.2 Bewertung und Ausblick
- 5.3 Weiterer Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung in Deutschland zwischen 1998 und 2005. Ihr Ziel ist es, die Veränderungen und Kontinuitäten in der Arbeitsmarktpolitik dieses Zeitraums vor dem Hintergrund der typologischen Verortung des deutschen Arbeitsmarktregimes zu analysieren. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen gelegt, mit denen der deutsche Arbeitsmarkt konfrontiert war und ist.
- Die Typologisierung des deutschen Arbeitsmarktregimes im Vergleich zu anderen europäischen Wohlfahrtsstaaten
- Die Herausforderungen für den deutschen Arbeitsmarkt, wie Globalisierung, Produktivitätssteigerung und gesellschaftlicher Strukturwandel
- Die Analyse der Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung, insbesondere die Maßnahmen des "Bündnisses für Arbeit" und der "Agenda 2010"
- Die Bewertung der Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik auf die Arbeitslosigkeit und die Beschäftigung
- Die Diskussion über den weiteren Forschungsbedarf in der Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Veränderungen und Kontinuitäten in der Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung. Kapitel 2 beleuchtet die typologische Verortung des deutschen Arbeitsmarktregimes im Vergleich zu anderen europäischen Wohlfahrtsstaaten. Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen für den deutschen Arbeitsmarkt, wie Globalisierung, Produktivitätssteigerung und gesellschaftlicher Strukturwandel. Kapitel 4 untersucht die Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung, insbesondere die Maßnahmen des "Bündnisses für Arbeit" und der "Agenda 2010".
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Arbeitsmarktpolitik, Regimewandel, Kontinuität, Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, Produktivitätssteigerung, Strukturwandel, "Bündnis für Arbeit", "Agenda 2010", Arbeitslosigkeit, Beschäftigung, Deutschland, Rot-Grün.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Agenda 2010 unter Gerhard Schröder?
Das Ziel war die Modernisierung des deutschen Sozialstaats und Arbeitsmarkts, um die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Was versteht man unter den "Hartz-Reformen"?
Die Hartz-Gesetze (I-IV) strukturierten die Arbeitsmarktpolitik um, führten die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammen (Hartz IV) und setzten verstärkt auf "Fördern und Fordern".
Galt Deutschland vor 1998 als konservatives Wohlfahrtsregime?
Ja, nach Esping-Andersen zeichnete sich das deutsche Regime durch Status- und Beitragsbezogenheit sowie eine starke Orientierung am männlichen Familienernährer aus.
Was war das "Bündnis für Arbeit"?
Es war ein in der ersten Legislaturperiode Schröders initiiertes Gesprächsforum zwischen Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern, um gemeinsam Lösungen für den Arbeitsmarkt zu finden.
Führte die rot-grüne Politik zu einem liberalen Regimewandel?
Die Arbeit untersucht, ob die Reformen eine Annäherung an das liberale Modell (wie in den USA oder UK) darstellten oder ob der konservative Kern des deutschen Systems erhalten blieb.
- Citar trabajo
- Magister Artium Sascha Vogt (Autor), 2007, Regimewandel oder Kontinuität? Die Arbeitsmarktpolitik der Regierung Schröder 1998-2005, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79722