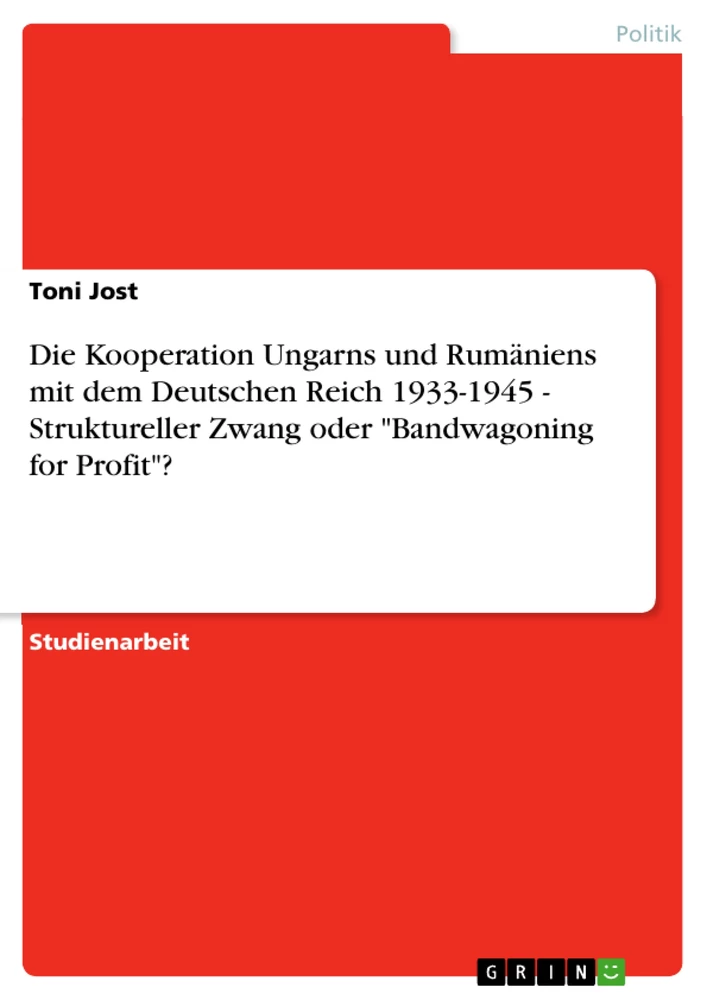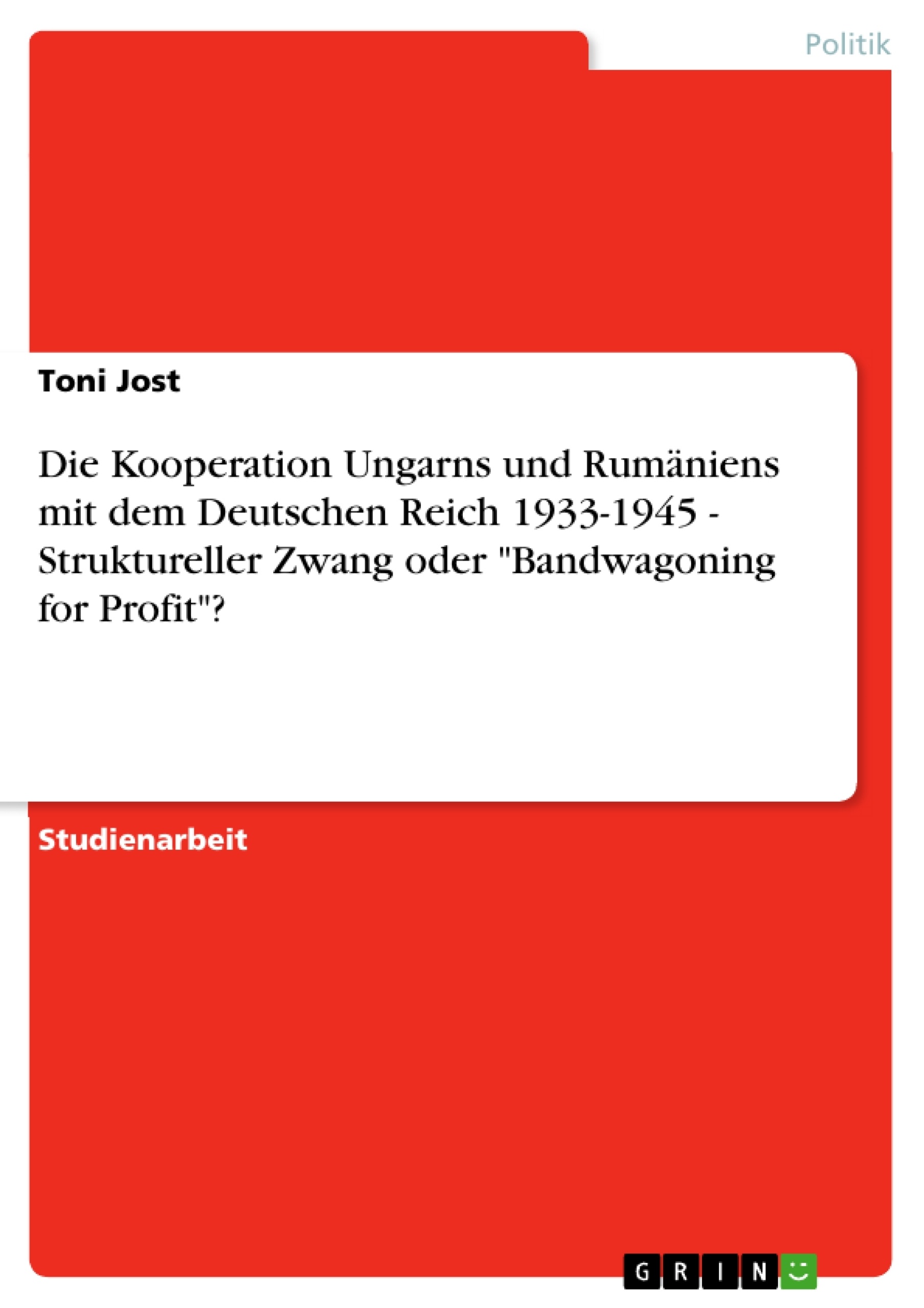Diese Arbeit überpüft die Erklärungskraft der drei neorealistischen Ansätze (Waltz, Walt, Schweller) anhand historischer Entwicklungen. Sie setzt sich dafür mit einem in der politikwissenschaftlichen Forschung eher am Rande betrachteten Problem auseinander: der Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg. Von besonderem Interesse sind die Fragen, ob Bandwagoning- oder Balancing-Aspekte zur Kooperation führten, gegebenenfalls welche Macht ausbalanciert werden sollte oder welche Güter es zu erringen galt. In welchem Verhältnis standen Freiwilligkeit und Zwang zueinander? Bestand zwischen den Ländern eine ideologische Bande oder war es ein pragmatisches Zweckbündnis? Und wie viel Autonomie ließ ihnen die Kooperation mit dem Deutschen Reich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Die Gleichgewichtstheorien der neorealistischen Schule
- Balance of Power nach Kenneth N. Waltz
- Balance of Threat nach Stephen M. Walt
- Balance of Interest nach Randall L. Schweller
- Das internationale System im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs
- Südosteuropa in der Großraumkonzeption der Nationalsozialisten
- Etappen der Annäherung
- Erste Phase: 1933-1938
- Zweite Phase: 1938-1941
- Konsequenzen der Anlehnung
- Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich (1933-1945) im Kontext neorealistischer Gleichgewichtstheorien. Sie hinterfragt, ob diese Kooperation primär auf "Bandwagoning for Profit" oder strukturellen Zwängen beruhte. Die Arbeit analysiert die Motive beider Länder und bewertet das Ausmaß von Freiwilligkeit und Zwang in dieser Beziehung.
- Die Anwendbarkeit neorealistischer Gleichgewichtstheorien auf die deutsch-ungarisch-rumänische Kooperation im Zweiten Weltkrieg.
- Die Rolle von "Bandwagoning" und "Balancing" in der Entscheidungsfindung Ungarns und Rumäniens.
- Der Einfluss von wirtschaftlichen Interessen und Sicherheitsbedenken auf die Kooperationsentscheidung.
- Das Verhältnis von Freiwilligkeit und Zwang in der Kooperation.
- Die Auswirkungen der Kooperation auf die Autonomie Ungarns und Rumäniens.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen zwischenstaatlicher Kooperation im Sicherheitsbereich, insbesondere das Problem der Defektion in anarchischen internationalen Systemen. Sie diskutiert divergierende Positionen von Institutionalisten und Neorealisten zur Überwindung des Sicherheitdilemmas und führt in die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ein: die Analyse der Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg, unter Berücksichtigung neorealistischer Perspektiven wie Bandwagoning und Balancing.
Die Gleichgewichtstheorien der neorealistischen Schule: Dieses Kapitel präsentiert detailliert verschiedene neorealistische Gleichgewichtstheorien, insbesondere die Konzepte von Balance of Power (Waltz), Balance of Threat (Walt), und Balance of Interest (Schweller). Es analysiert die unterschiedlichen Schwerpunkte dieser Theorien – Macht, Bedrohung und Interessen – und ihre Implikationen für das Verständnis zwischenstaatlicher Kooperation und des Sicherheitsverhaltens von Staaten. Der Vergleich dieser Theorien legt den Grundstein für die spätere Analyse der deutsch-ungarisch-rumänischen Beziehungen.
Das internationale System im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs: Dieses Kapitel analysiert das internationale System vor dem Zweiten Weltkrieg, um den Kontext der deutsch-ungarisch-rumänischen Kooperation zu beleuchten. Es untersucht das deutsche Interesse an Südosteuropa und die Machtverhältnisse in der Region. Die Analyse dieses Kapitels bildet die Grundlage für das Verständnis der strategischen Kalkulationen Ungarns und Rumäniens im Angesicht der aufsteigenden deutschen Macht.
Südosteuropa in der Großraumkonzeption der Nationalsozialisten: Dieses Kapitel wird sich eingehend mit der nationalsozialistischen Großraumkonzeption in Bezug auf Südosteuropa auseinandersetzen. Es wird die strategischen Ziele Deutschlands in der Region untersuchen, sowie die Rolle, die Ungarn und Rumänien in diesem Kontext spielen sollten. Die Analyse wird die Motive und Interessen Deutschlands im Südosteuropa-Kontext darlegen und die späteren Handlungen Ungarns und Rumäniens in diesem Kontext erhellen.
Etappen der Annäherung: Dieses Kapitel beschreibt die schrittweise Annäherung Ungarns und Rumäniens an das Deutsche Reich in zwei Phasen. Es wird die Entwicklung der Beziehungen im Detail darstellen, die politischen und wirtschaftlichen Faktoren analysieren, welche zu den Entscheidungen Ungarns und Rumäniens beigetragen haben. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung des Prozesses der Annäherung und der Analyse der beteiligten Akteure und ihrer Motive.
Schlüsselwörter
Neorealismus, Gleichgewichtstheorien, Balance of Power, Balance of Threat, Balance of Interest, Bandwagoning, Zweiter Weltkrieg, Deutsches Reich, Ungarn, Rumänien, Südosteuropa, Internationale Beziehungen, Sicherheitspolitik, Kooperation, Zwang, Autonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der deutsch-ungarisch-rumänischen Kooperation (1933-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich zwischen 1933 und 1945 im Kontext neorealistischer Gleichgewichtstheorien. Im Fokus steht die Frage, ob diese Kooperation primär auf opportunistischem Verhalten ("Bandwagoning for Profit") oder auf strukturellen Zwängen beruhte. Die Motive beider Länder und das Ausmaß von Freiwilligkeit und Zwang in dieser Beziehung werden untersucht.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf neorealistische Gleichgewichtstheorien, insbesondere die Konzepte von Balance of Power (Waltz), Balance of Threat (Walt) und Balance of Interest (Schweller). Diese Theorien werden verglichen und auf ihre Anwendbarkeit auf die deutsch-ungarisch-rumänische Kooperation angewendet.
Welche Aspekte der Kooperation werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Anwendbarkeit neorealistischer Gleichgewichtstheorien, die Rolle von "Bandwagoning" und "Balancing" in der Entscheidungsfindung Ungarns und Rumäniens, den Einfluss wirtschaftlicher Interessen und Sicherheitsbedenken, das Verhältnis von Freiwilligkeit und Zwang sowie die Auswirkungen der Kooperation auf die Autonomie der beiden Länder.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Forschungsstand (neorealistische Gleichgewichtstheorien), ein Kapitel zum internationalen System vor dem Zweiten Weltkrieg, ein Kapitel zur nationalsozialistischen Großraumkonzeption in Südosteuropa, ein Kapitel zu den Etappen der Annäherung (1933-1938 und 1938-1941), ein Kapitel zu den Konsequenzen der Anlehnung, eine Bewertung und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neorealismus, Gleichgewichtstheorien, Balance of Power, Balance of Threat, Balance of Interest, Bandwagoning, Zweiter Weltkrieg, Deutsches Reich, Ungarn, Rumänien, Südosteuropa, Internationale Beziehungen, Sicherheitspolitik, Kooperation, Zwang, Autonomie.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Analyse der Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg unter Berücksichtigung neorealistischer Perspektiven wie Bandwagoning und Balancing.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum von 1933 bis 1945.
Welche Länder stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich, Ungarn und Rumänien.
- Citation du texte
- Toni Jost (Auteur), 2007, Die Kooperation Ungarns und Rumäniens mit dem Deutschen Reich 1933-1945 - Struktureller Zwang oder "Bandwagoning for Profit"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80609