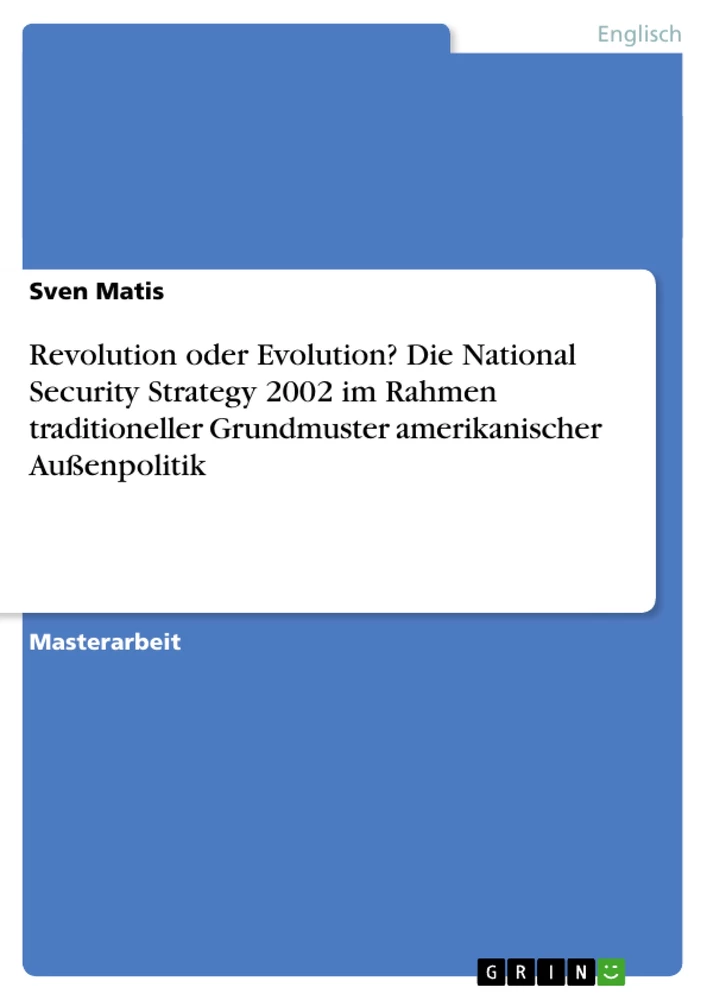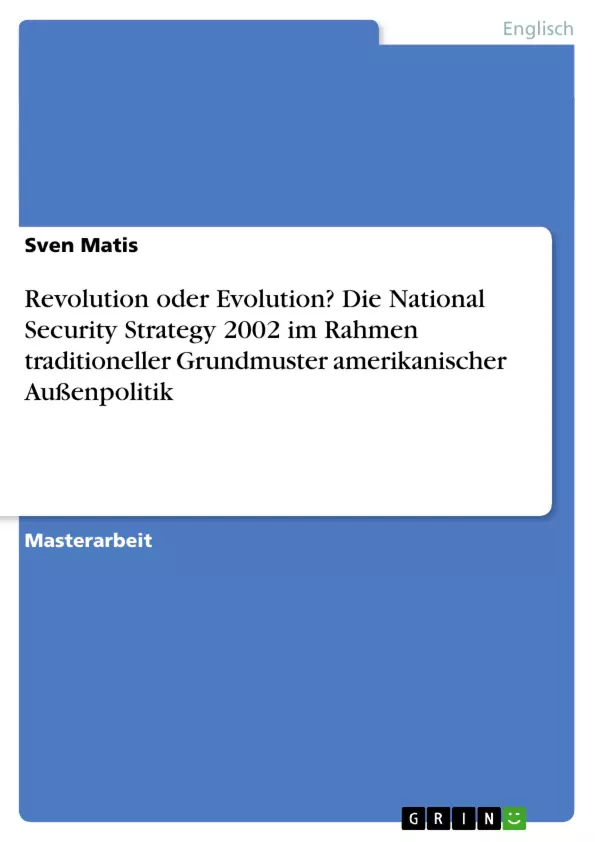Als am 11. September 2001 der amerikanische Präsident George W. Bush zum ersten Mal nach den Anschlägen vor die Öffentlichkeit tritt, zeigt er hier einen Einblick in sein tiefstes Inneres, „what you saw was my gut reaction coming out“.
Bush verurteilt in seiner ersten Reaktion die Terrorattacke und verspricht, „those folks who committed this act“ zu finden. Er beendet seine Rede mit einem weiteren Versprechen: „Terrorism against our nation will not stand.“
Elf Jahre zuvor hatte sein Vater mit der berühmten Formulierung „This will not stand“ auf den Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait reagiert. Dass Bush jr. mit seiner Bemerkung an die Worte seines Vaters aus dem Jahr 1990 erinnerte, sei ihm damals nicht bewusst gewesen. „Why I came up with those specific words, maybe it was an echo of the past”.
Fast genau ein Jahr später legte Bush das ‚Grand Design’ seiner Außenpolitik und damit die strategischen Konsequenzen auf die Angriffe in der ‚National Security Strategy 2002’ (NSS) vor. Dieses Strategiepapier führte zu weltweiten Diskussionen, u.a. weil das darin enthaltene Vorrecht auf eine proaktive, unilaterale Bekämpfung des Terrorismus durch präemptive Militäreinsätze für Irritationen sorgte.
Die vorliegende Arbeit räumt mit einiger dieser Irritationen auf und liefert einen analytischen Beitrag zur Diskussion über die amerikanische Außenpolitik. Im Vordergrund steht die Frage, ob die NSS eine revolutionäre Abweichung traditioneller Grundmuster darstellt oder eher ein „Echo“ der Vergangenheit ist.
Diese Arbeit schreibt ganz bewusst gegen eine weit verbreitete Gleichgültigkeit bzw. Missachtung geschichtlicher Zusammenhänge an.
Um den Inhalt dieser Arbeit in einem Satz zusammenzufassen: Die Kontinuitäten der amerikanischen Außenpolitik und ihre Anpassungen an die jeweiligen Herausforderungen werden konzise dargestellt und an der National Security Strategy von 2002 abgeglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Einführung
- II. Grundmuster US-Amerikanischer Außenpolitik
- II.1. ‚Manifest Destiny’ – wie sich der Exzeptionalismus-Gedanke in der amerikanischen Außenpolitik niederschlägt
- II.1.2. Das ‚Manifest Destiny’ als innergesellschaftlicher Mythos
- II.1.3. Das ‚Manifest Destiny’ in der Außenpolitik
- II.2. Liberalismus in der Außenpolitik – wie sich die Ideale der Unabhängigkeitserklärung in der amerikanischen Außenpolitik niederschlagen
- II.2.1. Verbreitung von Demokratie als Regierungsform
- II.2.2. Verbreitung von Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem
- II.3. Realismus in der Außenpolitik – wie sich die nationalen Sicherheitsinteressen in der amerikanischen Außenpolitik niederschlagen
- II.3.1 Ausdifferenzierung Unilateralismus – Multilateralismus
- II.3.2. Unilateralismus als Grundmuster der US-Außenpolitik
- II.3.3. Multi- und Unilateralismus im 19. Jahrhundert
- II.3.4. Multilateralismus und Unilateralismus im 20. Jahrhundert
- II.4. Präemptive Kriege als Grundmuster der Außenpolitik
- II.5. ‚Werkzeugkasten amerikanischer Außenpolitik’
- II.1. ‚Manifest Destiny’ – wie sich der Exzeptionalismus-Gedanke in der amerikanischen Außenpolitik niederschlägt
- III. National Security Strategy 2002 – Revolution oder Evolution?
- III.1. Das Zustandekommen der National Security Strategy - „This nation will act!“
- III.2. Die Analyse des internationalen Status quo in der National Security Strategy: „Meet[ing] the challenges and opportunities of the twenty-first century“
- III.3. ‚Back to the roots?’ Realismus und Liberalismus als traditionelle Grundmuster in der National Security Strategy
- III.3.1. Demokratie und Liberalismus in der National Security Strategy
- III.3.2. Realismus in der National Security Strategy
- III.3.3. Unilateralismus vs. Multilateralismus in der National Security Strategy
- III.3.4. Exkurs: Die Quelle des ‚neuen’ amerikanischen Unilateralismus
- III.3.5. Präemption in der National Security Strategy
- III.3.6. Exkurs: Präemptionskriege – Präventionskriege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der ‚National Security Strategy 2002’ und analysiert, ob diese Strategie eine revolutionäre Abweichung traditioneller Grundmuster amerikanischer Außenpolitik darstellt oder eher eine Weiterentwicklung der Vergangenheit darstellt.
- Das ‚Manifest Destiny’ und der amerikanische Exzeptionalismus als prägende Faktoren der US-Außenpolitik
- Liberale Grundmuster wie die Verbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft
- Realistische Grundmuster wie Unilateralismus und Präemption
- Die National Security Strategy 2002 als Ausdruck des neuen Sicherheitsverständnisses nach 9/11
- Die Rolle der USA in der Welt und ihre strategischen Ziele im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet die wichtigsten Grundmuster der amerikanischen Außenpolitik, beginnend mit der Idee des ‚Manifest Destiny‘ und des amerikanischen Exzeptionalismus. Sie analysiert, wie sich liberale und realistische Grundmuster, wie die Verbreitung von Demokratie und die Durchsetzung nationaler Sicherheitsinteressen, im Laufe der Geschichte manifestiert haben. Die zweite Hälfte der Arbeit widmet sich der National Security Strategy 2002 und untersucht, inwieweit diese Strategie auf den traditionellen Grundmustern beruht und wie sie diese im Kontext des neuen Sicherheitsumfelds nach 9/11 weiterentwickelt. Die Arbeit analysiert die NSS 2002 im Hinblick auf die Verbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft, den Umgang mit dem Unilateralismus und die Rolle der Präemption als strategisches Mittel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet wichtige Schlüsselkonzepte wie Exzeptionalismus, ‚Manifest Destiny’, Liberalismus, Realismus, Unilateralismus, Präemption, National Security Strategy, 9/11, Terrorismus, Demokratie, Marktwirtschaft, internationale Beziehungen, Großmachtpolitik, und Weltordnung im Kontext der amerikanischen Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Frage der National Security Strategy (NSS) 2002 Analyse?
Die Arbeit untersucht, ob die NSS 2002 eine revolutionäre Abweichung von traditionellen Mustern der US-Außenpolitik darstellt oder eine Fortführung historischer Grundmuster ("Echo der Vergangenheit") ist.
Welche Rolle spielt der Begriff 'Manifest Destiny' in der US-Außenpolitik?
'Manifest Destiny' beschreibt den amerikanischen Exzeptionalismus-Gedanken, der das Selbstverständnis der USA als Nation mit einer besonderen Mission in der Welt prägt.
Was versteht man unter dem Begriff 'Präemption' im Kontext der NSS 2002?
Präemption bezeichnet das Vorrecht auf proaktive, unilaterale Militäreinsätze zur Bekämpfung von Terrorismus, bevor ein Angriff stattfindet – ein hochumstrittener Punkt der Bush-Doktrin.
Wie unterscheiden sich Unilateralismus und Multilateralismus in der US-Geschichte?
Während Multilateralismus auf internationale Kooperation setzt, beschreibt Unilateralismus das eigenständige Handeln der USA zur Sicherung nationaler Interessen, ein Muster, das bereits im 19. Jahrhundert erkennbar war.
Welchen Einfluss hatte der 11. September auf die Strategie von 2002?
9/11 war der Auslöser für die NSS 2002, da die Anschläge ein neues Sicherheitsverständnis und die Notwendigkeit einer angepassten Verteidigungsstrategie gegen den globalen Terrorismus schufen.
- Citation du texte
- Sven Matis (Auteur), 2006, Revolution oder Evolution? Die National Security Strategy 2002 im Rahmen traditioneller Grundmuster amerikanischer Außenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81420