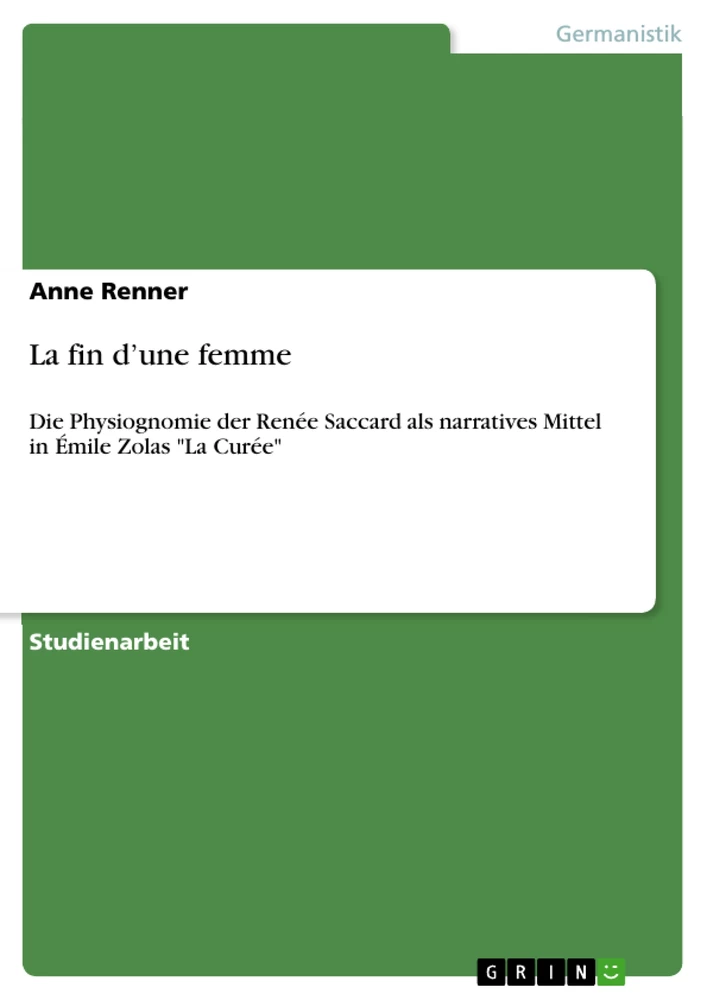Émile Zola gilt als Hauptvertreter des Naturalismus, der dominierenden literarischen Strömung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Naturalismus setzt die durch den Realismus eingeleitete Orientierung an den Wissenschaften und das Ziel der Darstellung der Gesellschaft fort, und verabschiedet sich dabei von der romantischen Idee des autonomen Individuums. Er versteht sich als eine engagierte Kunst, die einen Beitrag zur Bewusstseinsveränderung und der Beseitigung sozialer Missstände leisten kann. Zola stellt ausgiebige Recherchen zu den verschiedenen sozialen Milieus seiner Epoche an, um sie danach literarisch so realistisch wie möglich wiedergeben zu können. Auch die Gesetze der Vererbung studiert er genau, um ihnen sein Personal zu unterwerfen. Diese beiden Komponenten, Milieu und Vererbung, treffen in der Physiognomie der Romanfiguren aufeinander. In der folgenden Analyse verfolge ich die These, dass die physiognomischen Beschreibungen bei Zola strategische Funktionen innerhalb der Narration einnehmen. Dies möchte ich am Beispiel der Renée in La Curée exemplarisch nachvollziehen, indem ich die umfangreichen Beschreibungen Renées und ihrer näheren Umgebung - um mit einem Bild des Romans zu sprechen - sowohl inhaltlich als auch formal unter die Lupe nehme. Als theoretischen Hintergrund für meine Analyse beziehe ich mich auf die Physiologie im Allgemeinen und Zolas Vorstellungen von Literatur im Speziellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Physiologie als narratives Mittel
- Zolas literarisches Projekt
- Der experimentelle Roman und der Rougon-Macquart Zyklus
- Charakteristika der narrativen Struktur
- Analyse der Darstellung Renée Saccards in,,La Curée".
- Inhaltsangabe des Romans
- Charakteristika von Zolas Portraittechnik
- Dégénérescence - Die Determinante Erbanlagen
- Die Determinante Milieu
- Zwei gegensätzliche Milieus
- Der korrumpierende Einfluss des Milieus des Second Empire
- Renées innerer Konflikt
- Renée und Maxime
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Analyse von Émile Zolas „La Curée“ untersucht die physiognomischen Beschreibungen als narratives Mittel im Naturalismus. Die Arbeit befasst sich mit der These, dass Zolas Romanfiguren durch ihre Körperlichkeit, insbesondere Mimik und Gestik, charakterisiert werden, um die Determinanten von Milieu und Vererbung zu verdeutlichen.
- Physiognomik und Physiologie als literarisches Mittel im 19. Jahrhundert
- Zolas naturalistisches Konzept und die Darstellung der Gesellschaft
- Die Rolle der Physiognomie in Zolas Werk „La Curée“
- Die Bedeutung von Milieu und Vererbung für die Charakterentwicklung von Renée Saccard
- Der Zusammenhang zwischen Physiognomie und innerem Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Émile Zola als Hauptvertreter des Naturalismus vor und beleuchtet dessen wissenschaftliche Orientierung sowie die Darstellung der Gesellschaft in seinen Romanen. Sie führt den Fokus auf die These der Arbeit: Physiognomische Beschreibungen dienen als strategisches Element innerhalb der Narration. Kapitel 2 erörtert die Rolle der Physiologie in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts, wobei die Bedeutung von Körpermerkmalen und Körpersprache für die Charakterisierung von Figuren im Fokus stehen. Kapitel 3 behandelt Zolas literarisches Projekt, insbesondere den experimentellen Roman und den Rougon-Macquart Zyklus. Es werden die Charakteristika der narrativen Struktur beleuchtet, die zentrale Rolle des Milieus und die Bedeutung der Vererbung herausgestellt. Kapitel 4 analysiert die Darstellung von Renée Saccard in „La Curée“. Zolas Portraittechnik, die Determinanten von Dégénérescence, Milieu und Vererbung sowie der innere Konflikt der Protagonistin werden untersucht. Kapitel 4.4.1 behandelt die zwei gegensätzlichen Milieus, aus denen Renée stammt, und der korrumpierende Einfluss des Milieus des Second Empire wird in Kapitel 4.4.2 analysiert. Schließlich erörtert Kapitel 4.6 die Beziehung zwischen Renée und Maxime, um die Bedeutung der Physiognomik im Kontext der romantischen Liebe zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Naturalismus, Physiognomik, Physiologie, Émile Zola, „La Curée“, Renée Saccard, Milieu, Vererbung, Dégénérescence, Charakterisierung, narratives Mittel, Portraittechnik, Second Empire.
- Quote paper
- Anne Renner (Author), 2007, La fin d’une femme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81935