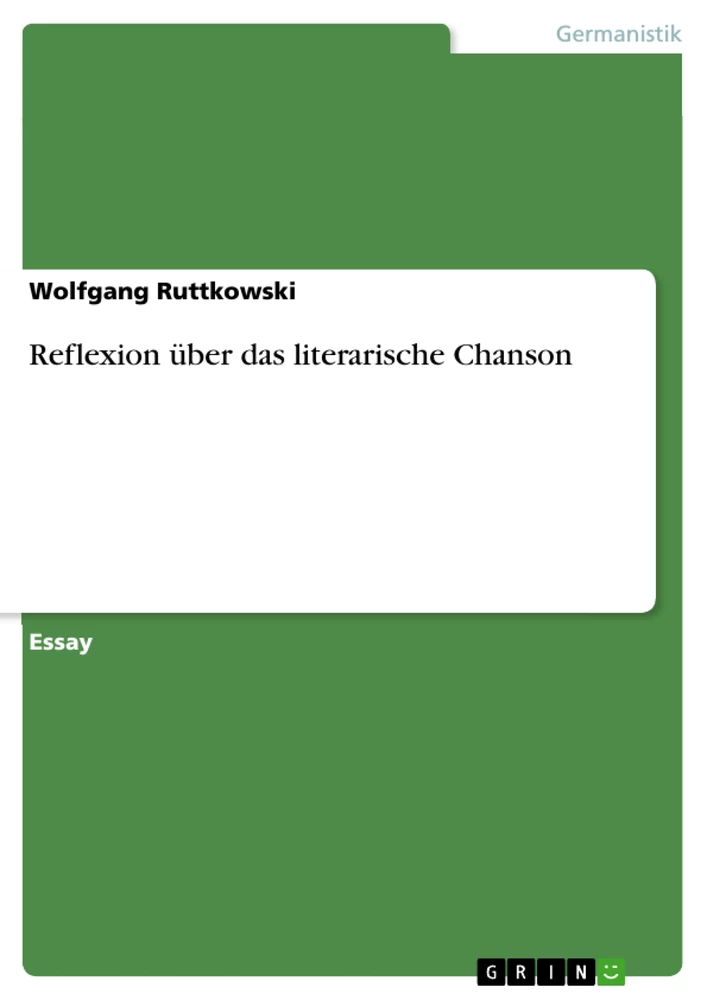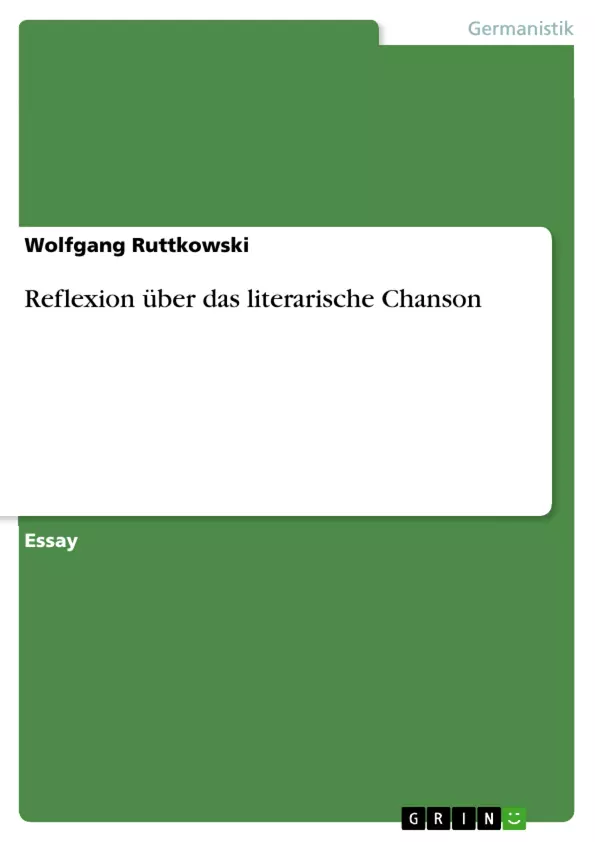Der Begriff Chanson kann in Deutschland keine literarische Gattung bezeichnen, wie etwa die Begriffe Sonett, Ode, Gazel etc., die eine feste Sprachstruktur meinen, oder auch nur die Begriffe Volkslied und Ballade, die bei aller Mannigfaltigkeit immerhin gewisse Stilgemeinsamkeiten aufweisen. Texte verschiedenster literarischer Herkunft (zum Beispiel Balladen, Bänkellieder des Volkes und der Salons, lyrische Volkslieder, SchmunzeIlyrik, Couplets) können durch den Vortrag des «Interpreten» zum Chanson «kreiert» werden.
Erste literaturwissenschaftliche Beschreibung des Chansons als Gattung.
Inhaltsverzeichnis
- Reflexion über das literarische Chanson
- Die Vier Haupttypen des dargestellten Objektes
- Selbstdarstellungschanson oder Vorstellungschanson
- Handlungsdarstellungschanson
- Reflexionschanson
- Stimmungs- und Zustandsschilderungschanson
- Zwei Bauformen des Chansons
- Zwei unterschiedliche Formen des Kehrreims
- Sprachzuge im Chanson
- Psychologische Bedingungen der Lebensform
- Eigentümlichkeiten der Schallform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Besonderheiten und die vielschichtige Natur des literarischen Chansons in Deutschland. Der Autor bemüht sich, den Begriff des Chansons im deutschen Kontext zu definieren und zu erklären, warum er sich nicht mit literarischen Gattungen wie dem Sonett oder der Ode vergleichen lässt.
- Die Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit des Chansons
- Die Unterschiede des Chansons zu anderen literarischen Gattungen
- Die Rolle des Interpreten und der Vortragssituation
- Die Bedeutung der Sprache, der Musik und der Mimik für das Chanson
- Die psychologischen Bedingungen und der Einfluss der Kultur auf das Chanson
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Definition des Chansons und stellt fest, dass es keine feste literarische Gattung darstellt, sondern durch den Vortrag des Interpreten „kreiert“ wird. Es werden verschiedene Typen von Chansons vorgestellt, wie das Selbstdarstellungschanson, das Handlungsdarstellungschanson, das Reflexionschanson und das Stimmungs- und Zustandsschilderungschanson. Anschließend werden zwei Bauformen des Chansons - die „horizontal“ und die „vertikal“ orientierte - sowie zwei Formen des Kehrreims beleuchtet. Der Autor geht auf die Bedeutung der Sprache, der Musik und der Mimik für das Chanson ein und analysiert die psychologischen Bedingungen seiner Lebensform. Abschließend werden die besonderen Eigentümlichkeiten der Schallform des Chansons beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: literarisches Chanson, Interpret, Vortragssituation, Sprache, Musik, Mimik, Couplet, Kehrreim, Selbstdarstellung, Handlungsdarstellung, Reflexion, Stimmung, Zustandsschilderung, Schallform, psychologischer Kontext, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Chanson eine eigenständige literarische Gattung?
Nein, im Gegensatz zum Sonett oder der Ode bezeichnet Chanson in Deutschland keine feste Sprachstruktur, sondern wird erst durch den Vortrag des Interpreten „kreiert“.
Welche vier Haupttypen des Chansons werden unterschieden?
Es wird zwischen Selbstdarstellungs- (Vorstellungs-), Handlungsdarstellungs-, Reflexions- sowie Stimmungs- und Zustandsschilderungschansons unterschieden.
Welche Rolle spielt der Interpret beim Chanson?
Der Interpret ist entscheidend; er nutzt Sprache, Musik und Mimik, um Texte verschiedenster Herkunft (z.B. Balladen oder Bänkellieder) in ein Chanson zu verwandeln.
Was sind die zwei grundlegenden Bauformen des Chansons?
Der Text unterscheidet zwischen einer „horizontal“ orientierten Bauform (linearer Verlauf) und einer „vertikal“ orientierten Bauform.
Welche Bedeutung hat der Kehrreim (Refrain)?
Es werden zwei unterschiedliche Formen des Kehrreims analysiert, die zur Strukturierung und Wirkung des Chansons beitragen.
Was versteht man unter der 'Schallform' des Chansons?
Die Schallform umfasst die akustischen Eigentümlichkeiten des Vortrags, einschließlich der psychologischen Bedingungen der Lebensform des Chansons.
- Citation du texte
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Auteur), 1975, Reflexion über das literarische Chanson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82653