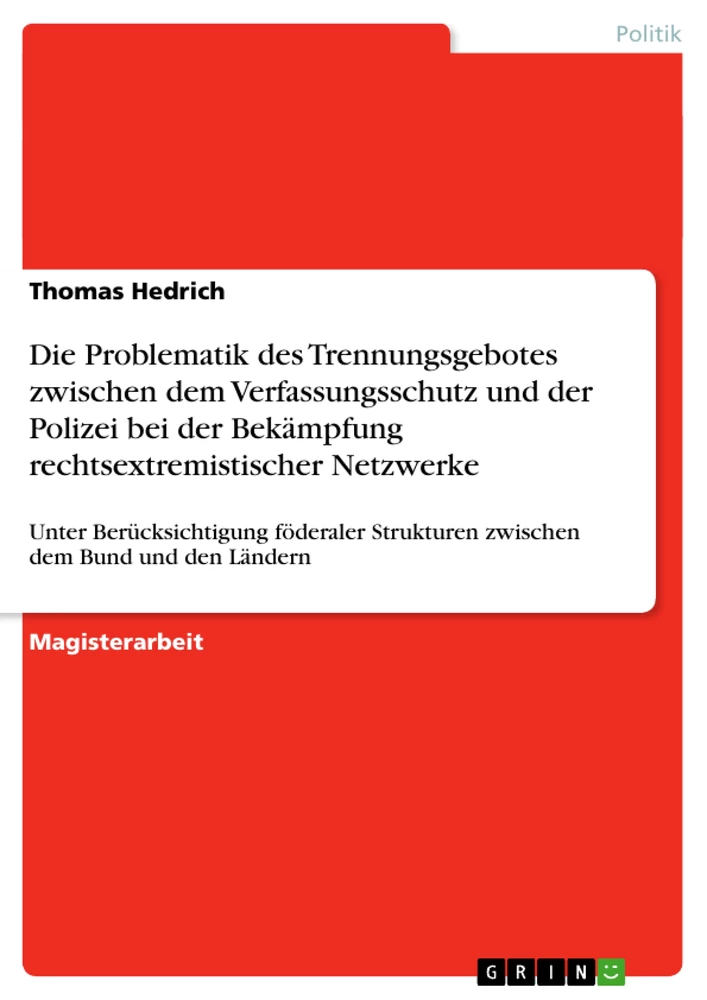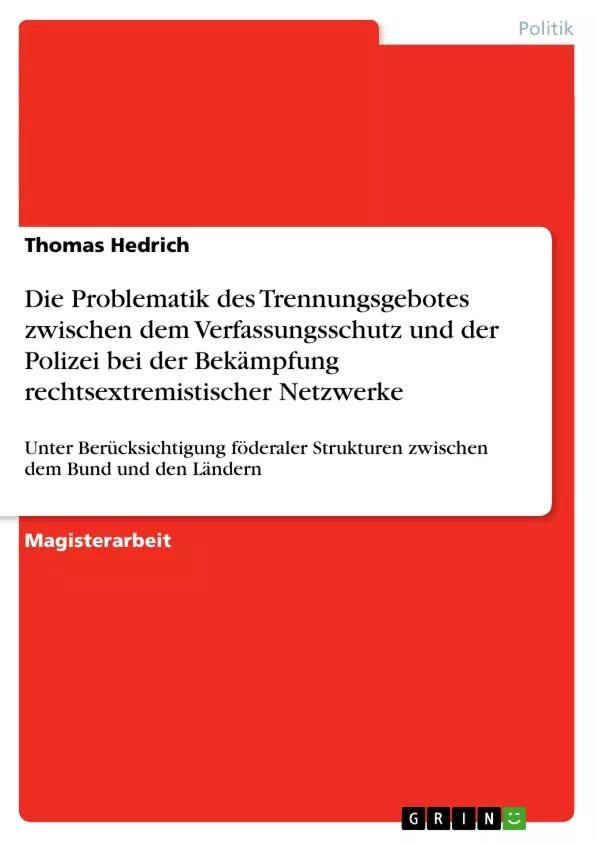Die Sicherheits- und Kriminalpolitik der vergangenen Jahre ist überwiegend von der Tendenz geprägt, auf tatsächliche oder vermeintliche Bedrohungslagen mit der eilig erhobenen Forderung nach neuen oder verschärften Eingriffsinstrumenten zu reagieren. Dies zeigt sich etwa am Beispiel der Bundesländer Sachsen, Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen, die sich zunehmend mit dem Phänomen des Rechtsextremismus konfrontiert sehen und zur Bekämpfung neue Wege gehen müssen. Die dabei praktizierte gemeinsame Vorgehensweise mit dem Verfassungsschutz wirft jedoch die Frage auf, ob und inwiefern dabei Grundrechte wie z. B. das Fernmeldegeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung und nicht zuletzt die informelle Selbstbestimmung in einem nicht zumutbarem Maße, durch beide Behörden zugleich, verletzt oder eingeschränkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das föderale System der Bundesrepublik Deutschland
- Das Bundesamt für Verfassungsschutz
- Machtbegrenzende Prinzipien des Rechtsstaates
- Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Problematik des Trennungsgebotes zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Netzwerke, unter Berücksichtigung föderaler Strukturen zwischen Bund und Ländern.
- Föderale Strukturen in Deutschland und deren Einfluss auf die Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz
- Aufgaben und Kompetenzen des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Bereich der Bekämpfung von Rechtsextremismus
- Rechtliche Grundlagen und Prinzipien des Trennungsgebotes zwischen Verfassungsschutz und Polizei
- Herausforderungen und Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz im Kampf gegen rechtsextremistische Netzwerke
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Effizienz bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einleitung in die Thematik und Relevanz des Trennungsgebotes zwischen Verfassungsschutz und Polizei bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Netzwerke.
- Kapitel 2: Das föderale System der Bundesrepublik Deutschland: Darstellung der föderalen Strukturen und Kompetenzverteilungen zwischen Bund und Ländern in Deutschland, mit besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik und die Bekämpfung von Rechtsextremismus.
- Kapitel 3: Das Bundesamt für Verfassungsschutz: Beschreibung der Aufgaben, Kompetenzen und Arbeitsfelder des Bundesamtes für Verfassungsschutz, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Rechtsextremismus, einschließlich der Organisation und der Kontrolle des Bundesamtes.
- Kapitel 4: Machtbegrenzende Prinzipien des Rechtsstaates: Analyse der historischen und rechtlichen Grundlagen des Trennungsgebotes zwischen Polizei und Verfassungsschutz, einschließlich der verfassungsrechtlichen Diskussionen und der Bedeutung dieses Prinzips für die Funktionsweise des Rechtsstaates.
- Kapitel 5: Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz: Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz, einschließlich der rechtlichen Grundlagen, der Herausforderungen und der Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Kampf gegen Rechtsextremismus.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Verfassungsschutz, Polizei, Föderalismus, Trennungsgebot, Zusammenarbeit, Datenschutz, Kontrollmechanismen, rechtliche Grundlagen, Kompetenzverteilung, Netzwerke, Bekämpfung von Rechtsextremismus, Bundesamt für Verfassungsschutz, Landesämter für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Strafverfolgung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Trennungsgebot zwischen Verfassungsschutz und Polizei?
Es ist ein rechtsstaatliches Prinzip, das die organisatorische und funktionelle Trennung zwischen Nachrichtendiensten (Verfassungsschutz) und Exekutivbehörden (Polizei) vorschreibt.
Welche Problematik wird bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus analysiert?
Die Arbeit untersucht, ob die enge Zusammenarbeit beider Behörden Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis oder die informationelle Selbstbestimmung unzulässig einschränkt.
Welche Rolle spielt der Föderalismus in dieser Debatte?
Die Arbeit analysiert, wie föderale Strukturen zwischen Bund und Ländern die Zusammenarbeit und Kompetenzverteilung der Sicherheitsbehörden beeinflussen.
Was sind die Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz?
Zu den Aufgaben gehört die Beobachtung und Aufklärung von Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, insbesondere im Bereich des Rechtsextremismus.
Warum wird nach neuen Eingriffsinstrumenten verlangt?
Aufgrund wachsender Bedrohungslagen durch rechtsextremistische Netzwerke fordern Bundesländer wie Sachsen oder Bayern oft verschärfte gesetzliche Befugnisse.
- Citar trabajo
- Magister Thomas Hedrich (Autor), 2007, Die Problematik des Trennungsgebotes zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Netzwerke, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83334