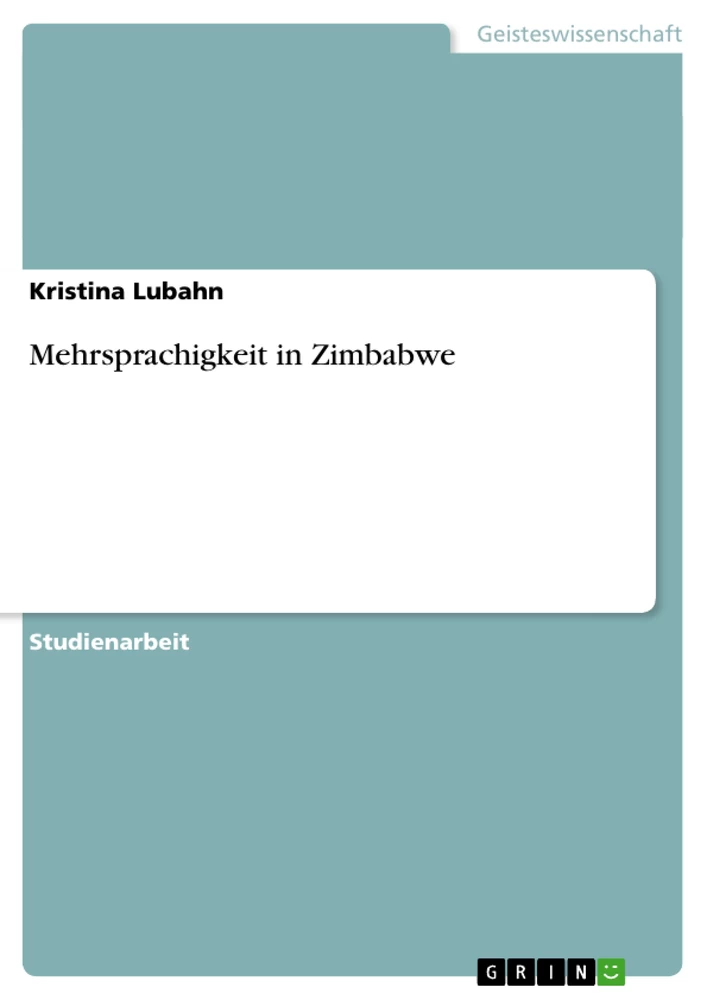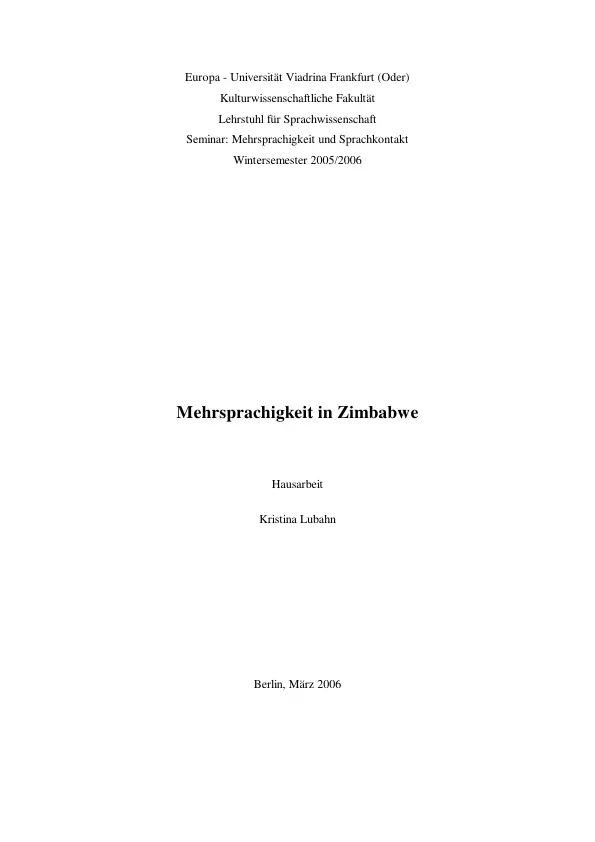Ein Drittel aller menschlichen Sprachen wird auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen. In Afrika gibt es rund 1500 verschiedene, gegenseitig nicht verständliche Sprachen. Die Sprecherzahl liegt zwischen ca. 60 Millionen und wenigen Hundert. Alle afrikanischen Staaten beherbergen mindestens eine, meist jedoch mehrere Sprachen innerhalb ihrer Grenzen. Dies resultiert aus der Kolonialzeit, in der die Grenzen ohne Rücksicht auf die einheimischen gesellschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Verhältnisse am „Reißbrett“ festgelegt wurden. In dieser Zeit wurde die Sprache der Kolonialmacht als allgemeines Kommunikationsmittel eingeführt und gefördert. Die Pflege der einheimischen Sprachen wurde jedoch vernachlässigt. Die Sprache der ehemaligen Kolonialherren wurde nach der Unabhängigkeit meist als offizielle Sprache beibehalten. Erst langsam wird in einer Reihe von Staaten dazu übergegangen, wenigstens im Grundschulbereich die afrikanischen Sprachen zu fördern.
Noch immer fällt es den Regierungen und Eliten schwer, Mehrsprachigkeit als Reichtum und Ressource zu begreifen. Afrikanische Sprachen werden als Problem und Entwicklungshindernis wahrgenommen.
Myers-Scotton fragt:
“Who becomes a bilingual in Africa? The simple answer is, almost everyone who is mobile, either in a socio-economic or a geographic sense. While there are monolinguals in Africa, the typical person speaks at least one language in addition to his/her first language, and persons living in urban areas often speak two or three additional languages.”
Auch in Zimbabwe findet man eine mehrsprachige Situation vor. Die ehemalige Kolonialsprache hat auch hier einen hohen Prestigewert. Für die Analyse des Variationsraumes der Mehrsprachigkeit in Zimbabwe wird in dieser Arbeit das Schema nach George Lüdi verwendet. Mit Hilfe dieses Schemas ist es möglich, die Diglossie oder Mehrsprachigkeit zu differenzieren und die verschiedenen Typen der Diglossie zu bestimmen. Dazu stehen laut dem Schema sechs Variablen zur Verfügung: der sprachliche Abstand, der Sprachgemeinschaftstyp, die funktionale Komplementarität, die Standardisierung, der Erwerbstyp und das Sprachprestige.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Sprachlicher Abstand
- 2.1 Übersicht über die Sprachen in Zimbabwe
- 2.2 Sprachfamilie und Entstehung
- 2.3 Dialekte und Pidginsprachen
- 2.4 Entlehnungen
- 3.0 Prestigeunterschiede
- 4.0 Sprachgemeinschaftstyp
- 4.1 Räumliche Erstreckung der Zwei- oder Mehrsprachigkeit
- 4.2 Soziale Erstreckung der Zwei- oder Mehrsprachigkeit
- 5.0 Funktionale Komplementarität
- 5.1 Arten der Funktionstrennung
- 5.1.1 Informelle Domäne
- 5.1.2 Kulturelle Domäne
- 5.1.3 Wirtschaftliche Domäne
- 5.1.4 Bildungsdomäne
- 5.1.5 Politische und administrative Domäne
- 5.1.6 Rechtliche Domäne
- 5.1.7 Domäne der Massenmedien
- 5.1.8 Internationale Domäne
- 5.2 Stabilität der Funktionstrennung
- 5.1 Arten der Funktionstrennung
- 6.0 Standardisierung
- 6.1 Entwicklung der Standartsprache und eines Schriftsystems
- 6.2 Sprachlicher Ausbau und normative Institutionen
- 7.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die mehrsprachige Situation in Zimbabwe anhand des Schemas von George Lüdi, das verschiedene Variablen zur Analyse der Diglossie nutzt. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale der Mehrsprachigkeit in Zimbabwe zu analysieren und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachvarietäten aufzuzeigen.
- Sprachlicher Abstand zwischen den Sprachen in Zimbabwe
- Prestigeunterschiede zwischen den Sprachen
- Funktionale Komplementarität der Sprachen
- Standardisierung der Sprachen
- Sprachgemeinschaftstyp in Zimbabwe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit in Afrika und Zimbabwe ein und beleuchtet die Hintergründe der Mehrsprachigkeit im Kontext der Kolonialgeschichte. Es wird auf die Bedeutung der ehemaligen Kolonialsprache Englisch im Land eingegangen und die Verwendung des Schemas von George Lüdi zur Analyse der Diglossie angekündigt.
Das Kapitel "Sprachlicher Abstand" behandelt die Sprachenlandschaft in Zimbabwe, einschließlich der wichtigsten Sprachen, ihrer Familienzugehörigkeit und der Entstehung von Dialekten und Pidginsprachen. Es wird auch auf die Bedeutung von Lehnwörtern eingegangen.
Das Kapitel "Prestigeunterschiede" befasst sich mit dem hohen Prestige der englischen Sprache in Zimbabwe im Vergleich zu den einheimischen Sprachen Shona und Ndebele. Es werden auch die Prestigeunterschiede innerhalb der indigenen Sprachen beleuchtet.
Das Kapitel "Sprachgemeinschaftstyp" untersucht die räumliche und soziale Erstreckung der Zwei- oder Mehrsprachigkeit in Zimbabwe. Es wird auf die unterschiedlichen Sprachkenntnisse der Bevölkerungsgruppen in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung eingegangen.
Das Kapitel "Funktionale Komplementarität" analysiert die verschiedenen Domänen, in denen die Sprachen in Zimbabwe verwendet werden. Es wird auf die Funktionstrennung zwischen den Sprachen in unterschiedlichen Bereichen wie dem informellen, kulturellen, wirtschaftlichen, bildungspolitischen, administrativen, rechtlichen, medialen und internationalen Bereich eingegangen.
Das Kapitel "Standardisierung" befasst sich mit der Entwicklung der Standardsprache und eines Schriftsystems für die Sprachen Shona und Ndebele. Es werden auch die Institutionen angesprochen, die sich mit dem sprachlichen Ausbau und der Normierung der Sprachen beschäftigen.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Zimbabwe, Diglossie, Sprachlicher Abstand, Prestigeunterschiede, Funktionale Komplementarität, Standardisierung, Sprachgemeinschaftstyp, Shona, Ndebele, Englisch, Kolonialismus, Afrika
Häufig gestellte Fragen
Welche Sprachen dominieren die mehrsprachige Situation in Zimbabwe?
Neben der ehemaligen Kolonialsprache Englisch sind Shona und Ndebele die bedeutendsten einheimischen Sprachen.
Warum hat Englisch in Zimbabwe ein so hohes Prestige?
Dies ist ein Erbe der Kolonialzeit, in der Englisch als Sprache der Verwaltung, Bildung und Wirtschaft etabliert wurde.
Was ist "Diglossie"?
Diglossie bezeichnet die funktionale Trennung von Sprachen, bei der verschiedene Sprachen in unterschiedlichen sozialen Domänen (z.B. privat vs. offiziell) genutzt werden.
Welches Schema wird zur Analyse der Mehrsprachigkeit verwendet?
Die Arbeit nutzt das Schema von George Lüdi, das Variablen wie sprachlichen Abstand, Prestige und Standardisierung einbezieht.
In welchen Bereichen werden afrikanische Sprachen in Zimbabwe gefördert?
Es findet ein langsamer Übergang statt, afrikanische Sprachen zumindest im Grundschulbereich verstärkt als Unterrichtssprachen zu nutzen.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Kristina Lubahn (Autor), 2006, Mehrsprachigkeit in Zimbabwe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83842