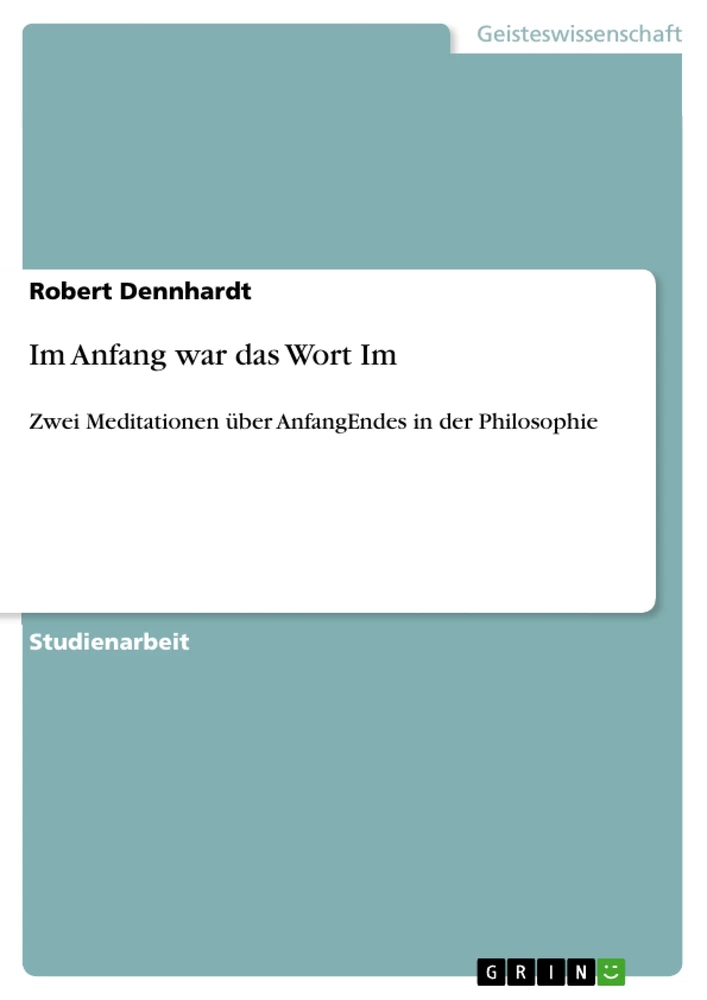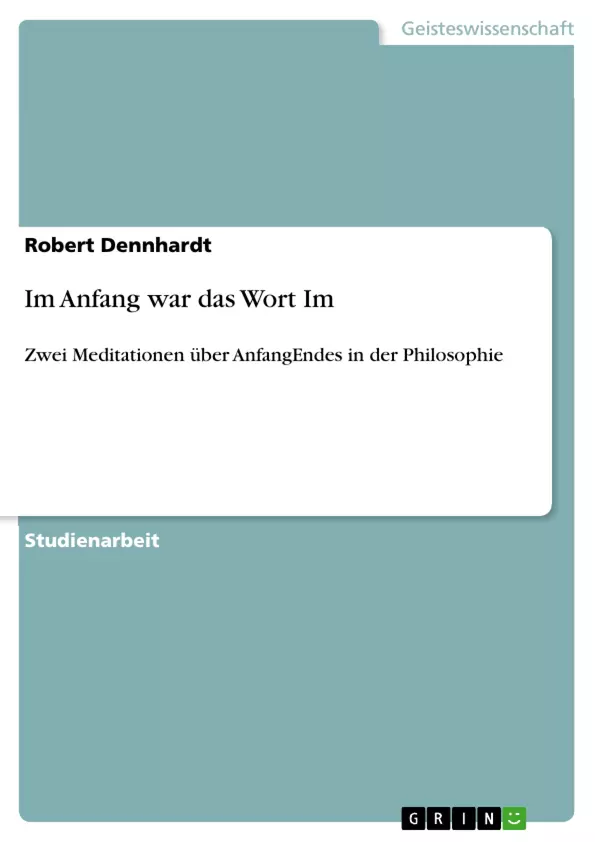Ein Philosoph unserer ehrwürdigen Universität faßte einst das Problem des Anfangs ironisch-wehmütig so zusammen: Die Wissenschaft sagt: laßt uns anfangen! Und die Philosophie fragt darauf hin: Ja, aber wo und vor allem was ist Anfang? Das heißt praktisch: „Man würde nie anfangen können, wenn man alle Möglichkeiten des Anfangens gegeneinander abwägen müßte.“ (Luhmann 1995, 72.) Auf die Frage, was Anfang sei oder das Anfangen an sich, kann ich zuvorderst nur mit Edmond Jabès antworten: „Ich weiß es nicht. Aber wenn ich beispielsweise [Anfang] sage, und ich wiederhole [Anfang], und ich sage wieder [Anfang], so sagt nach und nach dieses Wort all das, was im Innersten meine Erfahrung enthält […].“ (Jabès 1989, 21. Ähnlich zurückhaltend äußert sich Heidegger in Sein und Zeit nur ein einziges Mal mit Blick auf das manchmal unerträgliche Grauen des Daseins: „Das Sein des Da ist in solcher Verstimmung als Last offenbar geworden. Warum, weiß man nicht.“ (Heidegger 1984, 134.))
Ein zur idealistisch-teleologischen Dialektik quer stehender Ansatz denkt einen willkürlichen Anfang als eine erste Unterscheidung. Danach ist eine Philosophie nicht mehr logisch-wissenschaftlich wie bei Hegel denkbar, da mit Begriffen wie Nicht-Sein und Denken schon ein Zentrum innerhalb des Feldes der Diskurse geschaffen wurde. Ohne ein solches Zentrum dagegen wird es entscheidend, an welcher Stelle ETWAS anfänglich statt hat, ohne an sich irgendeine Bedeutung zu haben. Genau diesen synchronen Charakter eines Anfangs bedeuten spätere Theorien, von der Semiologie Saussures bis zur Sprachphilosophie als Grammatologie Derridas oder des Formenkalküls Spencer-Browns und der Systemtheorie Luhmanns. Quer dazu wäre noch ein spezieller Ansatz einer Philosophie der Leerstelle bzw. Kenogrammatik und Polykontexturalität von Gotthard Günther zu nennen. (Siehe hierzu den einführenden Aufsatz von Kaehr 1994, 81 bis 125.) Sowohl die Hegelsche zirkuläre Dialektik als auch jene neueren Ansätze lassen einen topologischen Diskurs als Holismus nicht zu, jedoch einen selbst-ähnlichen Diskurs des Fraktals. Das Ganze ist dann das Wahre. Damit wird Sein im Sinne einer Arche, Entelechie oder vis vitalis epistemologisch ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Vom Kreisen ...
- ... und Kreuzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem des Anfangs in der Philosophie durch eine kreisende Meditation über die Werke von Hegel, Luhmann und anderen Denkern und Dichtern. Sie beleuchtet die paradoxen Aspekte des Anfangens, insbesondere den Sprung in einen grundlosen Grund des Nicht-Anfang-Seins.
- Das Problem des Anfangs in der Philosophie
- Hegels Konzept des Anfangs und des reinen Wissens
- Die topologische Metapher des Kreises als Modell für das Anfangen
- Das Paradoxon von Sein und Nicht-Sein im Zusammenhang mit dem Anfang
- Der Diskurs zwischen Philosophie und Poesie als Ort der Auseinandersetzung mit dem Anfang
Zusammenfassung der Kapitel
Vom Kreisen ...: Dieses Kapitel erörtert das Problem des Anfangens in der Philosophie. Es beginnt mit der Frage nach dem "Was sollen wir tun?" und führt die scheinbare Sicherheit des scheinbar eindeutigen Wissens mit dem Grund des Zweifels zusammen. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Paradox des Anfangens, indem sie die Ansichten verschiedener Philosophen wie Jabès und Hegel gegenüberstellt. Der Fokus liegt auf der Schwierigkeit, den Anfang zu definieren und das Anfangen selbst zu beschreiben, und wie dieser Prozess mit Angst und Grauen verbunden sein kann. Hegels Konzept des Anfangs als leere Wort und reines Nicht-Wissen wird eingeführt, welches im Gegensatz zu allen bedeutungsvollen Setzungen der Sprache steht. Das Kapitel beleuchtet die Unmöglichkeit, den Anfang eindeutig zu definieren, und deutet auf die Rolle der Poesie im Diskurs über den Anfang hin.
... und Kreuzen: Dieses Kapitel setzt die Reflexion über den Anfang fort und konzentriert sich auf Hegels Vorstellung vom Kreislauf der Wissenschaften. Das "Erste" wird als gleichzeitig "Letztes" dargestellt, ein sich selbst träumendes "déjà-vu". Der Fokus liegt auf der topologischen Metapher des Kreises als Darstellung des Anfangs und Endes als zusammengehörig. Hegels Phänomenologie des Geistes wird analysiert, um die Vorstellung des Hineingerissenwerdens in einen grundlosen Grund zu veranschaulichen. Der Kreislauf in sich selbst wird als zentrales Element des Hegelschen Denkens über den Anfang präsentiert und mit den Arbeiten von Spencer-Brown und Luhmann in Verbindung gebracht. Die paradoxe Natur des Anfangs und das immer-schon-Charakter des epistemologischen Anfangs sind wesentliche Bestandteile der Argumentation.
Schlüsselwörter
Anfang, Philosophie, Hegel, Luhmann, Kreis, Paradox, Sein, Nicht-Sein, Wissen, Poesie, Metaphysik, Epistemologie, Topologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Kreisende Meditation über den Anfang
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das philosophische Problem des Anfangs, indem sie eine kreisende Meditation um die Werke von Hegel, Luhmann und anderen Denkern und Dichtern vollzieht. Ein zentrales Thema ist das Paradox des Anfangens, insbesondere der Sprung in einen grundlosen Grund des Nicht-Anfang-Seins.
Welche Philosophen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich vor allem mit Hegel und Luhmann, bezieht aber auch andere Denker wie Jabès mit ein. Die Perspektive umfasst philosophische und poetische Ansätze.
Welche Metapher wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die topologische Metapher des Kreises als Modell für das Anfangen, um die zyklische und paradoxe Natur des Anfangs zu veranschaulichen. Der Kreis symbolisiert die Verbindung von Anfang und Ende.
Welche zentralen Konzepte werden diskutiert?
Zentrale Konzepte sind das Problem des Anfangs in der Philosophie, Hegels Konzept des Anfangs und des reinen Wissens, das Paradoxon von Sein und Nicht-Sein im Zusammenhang mit dem Anfang, sowie der Diskurs zwischen Philosophie und Poesie als Ort der Auseinandersetzung mit dem Anfang. Die Phänomenologie des Geistes Hegels spielt eine wichtige Rolle.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Vom Kreisen ..."?
Dieses Kapitel erörtert das Problem des Anfangens, die Schwierigkeiten, den Anfang zu definieren und zu beschreiben, und die damit verbundene Angst und das Grauen. Es stellt die Ansichten verschiedener Philosophen gegenüber und führt Hegels Konzept des Anfangs als leere Wort und reines Nicht-Wissen ein. Es deutet auf die Rolle der Poesie im Diskurs über den Anfang hin.
Was ist der Inhalt des Kapitels "... und Kreuzen"?
Dieses Kapitel setzt die Reflexion fort und konzentriert sich auf Hegels Vorstellung vom Kreislauf der Wissenschaften, wobei das "Erste" gleichzeitig als "Letztes" dargestellt wird. Es analysiert die topologische Metapher des Kreises und Hegels Phänomenologie des Geistes, um das Hineingerissenwerden in einen grundlosen Grund zu veranschaulichen. Die Arbeiten von Spencer-Brown und Luhmann werden in Verbindung gebracht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anfang, Philosophie, Hegel, Luhmann, Kreis, Paradox, Sein, Nicht-Sein, Wissen, Poesie, Metaphysik, Epistemologie, Topologie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit philosophischen Fragen des Anfangs auseinandersetzen möchten. Sie ist für ein akademisches Publikum konzipiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Problem des Anfangs in der Philosophie durch eine eingehende Analyse verschiedener philosophischer und poetischer Perspektiven zu untersuchen und zu beleuchten.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2000, Im Anfang war das Wort Im, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84873