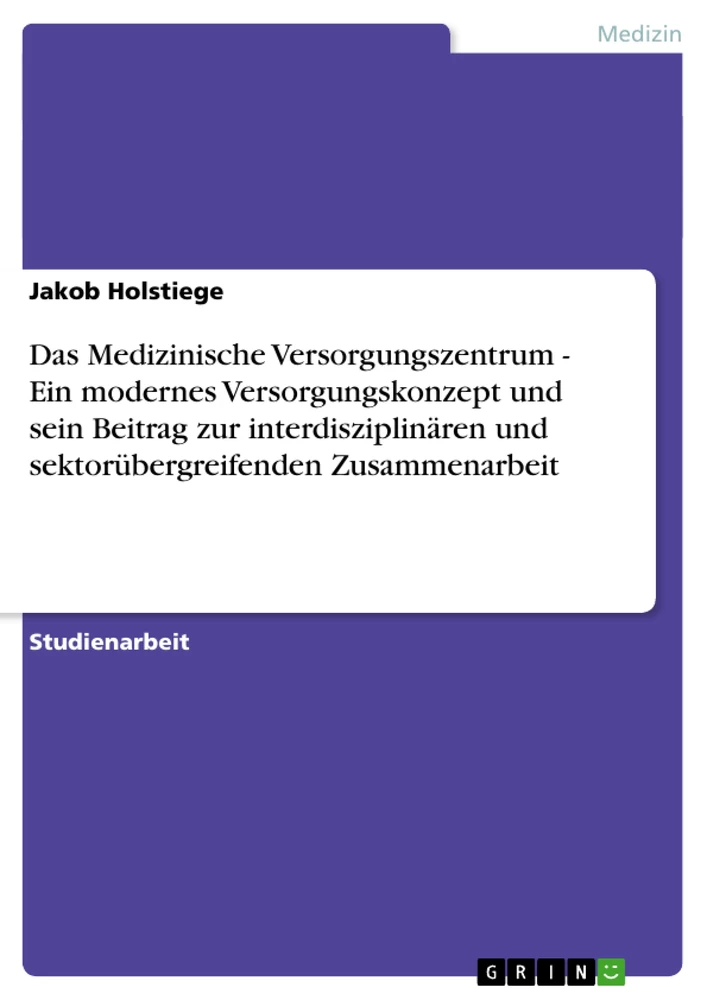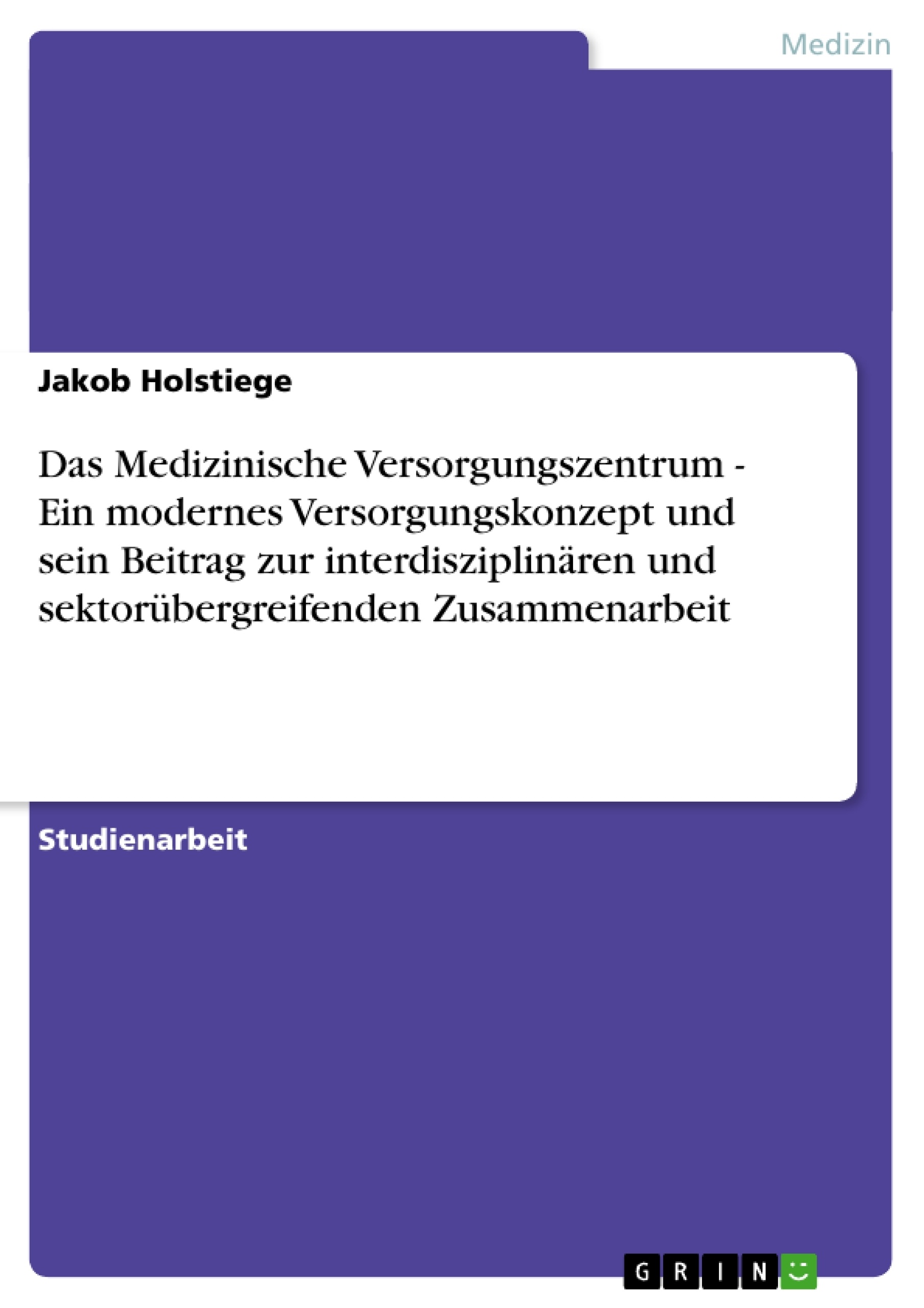Einleitung
In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion scheint ein breiter Konsens darüber zu herrschen, dass die gesundheitliche Versorgung in Deutschland von erheblichen Ineffizienzen gekennzeichnet ist. Eine intensive Arbeitsteilung hochspezialisierter in starren sektoralen Grenzen agierender Leistungserbringer führt zu mangelhaft koordinierten Versorgungsprozessen. Gleichzeitig nimmt die Verschiebung des gesellschaftlichen Krankheitspanoramas hin, zu einer stetig wachsenden Bedeutung chronischer und multimorbider Krankheitsverläufe in einer alternden Bevölkerung, zu. Immer mehr Menschen sind auf langfristige mehrdimensionale Behandlungsformen angewiesen. All diese Entwicklungen tragen neben geringeren Einnahmen maßgeblich dazu bei, dass die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung zunehmend unter Druck gerät. In den Augen des Gesetzgebers sind Teilaspekte des historisch gewachsenen Ordnungsrahmens als Ursache für eine unangemessene Verzahnung medizinischer Einzelleistungen zu sehen. Eine Modifizierung der rechtlichen Vorgaben soll die Implementierung neuartiger und die Weiterentwicklung schon vorhandener Versorgungsformen ermöglichen und so Defizite in der Leistungserbringung beseitigen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde zu Beginn des Jahres 2004 das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) verabschiedet, welches unter anderem die integrierte Versorgung reformiert und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Medizinische Versorgungszentren schafft. Beide Konzepte zielen darauf ab, die Kommunikation und Kooperation in der medizinischen Leistungserbringung zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage für das Krankenkassenmodernisierungsgesetz
- Das MVZ und seine gesetzlichen Grundlagen
- Gründung und Trägerschaft eines MVZ
- Zulassung eines MVZ
- Gesellschaftsformen
- Das ambulante Vergütungssystem
- Ausgestaltungsvarianten
- Das intrasektorale MVZ
- Das MVZ am Krankenhaus
- Beteiligungs- und Gründungsanreize aus der Sicht eines Krankenhauses
- Interdisziplinäre und sektorübergreifende Zusammenarbeit
- Räumliche Nähe
- Organisationsform und Hierarchie eines MVZ
- Vergütungsanreize
- Ergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Konzept der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und analysiert ihr Potential zur Verbesserung von Interdisziplinarität und sektorübergreifender Zusammenarbeit im deutschen Gesundheitswesen. Sie fokussiert sich auf das MVZ am Krankenhaus, das durch seinen intersektoralen Ansatz besondere Relevanz erlangt. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen von MVZ, mögliche Ausgestaltungsformen und die Anreize für Krankenhäuser, sich an der Gründung und Entwicklung von MVZ zu beteiligen. Der Schwerpunkt liegt auf den Vorteilen, die sich für Krankenhäuser in einem zunehmenden Klinikwettbewerb ergeben.
- Das Konzept des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) nach § 95 SGB V
- Die Rolle von MVZ bei der Verbesserung der Interdisziplinarität in der ambulanten Versorgung
- Die Förderung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen durch MVZ
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung und Trägerschaft von MVZ
- Beteiligungs- und Gründungsanreize für Krankenhäuser im Kontext von MVZ
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Problemfeld der Ineffizienz und mangelnden Koordinierung im deutschen Gesundheitswesen dar, insbesondere im Hinblick auf chronische und multimorbide Krankheitsverläufe. Sie erläutert die Bedeutung des Krankenkassenmodernisierungsgesetzes (GMG) und die Rolle von MVZ bei der Verbesserung der Versorgungssituation.
- Ausgangslage für das Krankenkassenmodernisierungsgesetz: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen, die die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in den letzten Jahren bewältigen musste, darunter steigende Ausgaben, sinkende Einnahmen und der demographische Wandel. Es beleuchtet die Problematik der mangelnden interdisziplinären und sektorübergreifenden Zusammenarbeit und zeigt die Notwendigkeit neuer Versorgungsformen auf.
- Das MVZ und seine gesetzlichen Grundlagen: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 95 SGB V. Es behandelt die Gründung und Trägerschaft von MVZ, die Zulassungsprozesse und die verschiedenen Gesellschaftsformen, die für MVZ zur Verfügung stehen.
- Das ambulante Vergütungssystem: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Vergütungssystem für ambulante Leistungen und erläutert die relevanten Mechanismen für MVZ.
- Ausgestaltungsvarianten: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ausgestaltungsformen von MVZ, insbesondere das intrasektorale MVZ und das MVZ am Krankenhaus. Es beleuchtet die Besonderheiten und Vorteile des letzteren Modells.
- Beteiligungs- und Gründungsanreize aus der Sicht eines Krankenhauses: Dieses Kapitel analysiert die Anreize für Krankenhäuser, sich an der Gründung und Entwicklung von MVZ zu beteiligen. Es betrachtet die möglichen Vorteile für Krankenhäuser im Kontext des zunehmenden Klinikwettbewerbs.
- Interdisziplinäre und sektorübergreifende Zusammenarbeit: Dieses Kapitel untersucht das Potential von MVZ zur Verbesserung der interdisziplinären und sektorübergreifenden Zusammenarbeit. Es betrachtet die räumliche Nähe, die Organisationsform, Vergütungsanreize und die erwartbaren Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Interdisziplinarität, sektorübergreifende Zusammenarbeit, Krankenhaus, ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, Krankenkassenmodernisierungsgesetz (GMG), § 95 SGB V, Gesundheitswesen, Klinikwettbewerb, Versorgungsqualität, Ineffizienz, Koordinierung, Chronische Krankheiten, Multimorbidität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)?
Eine fachübergreifende, ärztlich geleitete Einrichtung, in der Ärzte als Angestellte oder Vertragsärzte zusammenarbeiten.
Welches Gesetz schuf die Grundlage für MVZ?
Das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) im Jahr 2004.
Wie fördern MVZ die interdisziplinäre Zusammenarbeit?
Durch die räumliche Nähe verschiedener Fachrichtungen und koordinierte Behandlungsprozesse unter einem Dach.
Warum sind MVZ für Krankenhäuser attraktiv?
Sie ermöglichen eine bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung und stärken die Position im Klinikwettbewerb.
Welche Trägerschaften sind für ein MVZ möglich?
MVZ können von Krankenhäusern, Vertragsärzten oder anderen zugelassenen Leistungserbringern gegründet werden.
Was ist der Vorteil für Patienten mit chronischen Krankheiten?
Sie profitieren von einer besser koordinierten, mehrdimensionalen Behandlung ohne weite Wege zwischen verschiedenen Fachärzten.
- Citar trabajo
- Jakob Holstiege (Autor), 2007, Das Medizinische Versorgungszentrum - Ein modernes Versorgungskonzept und sein Beitrag zur interdisziplinären und sektorübergreifenden Zusammenarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85073