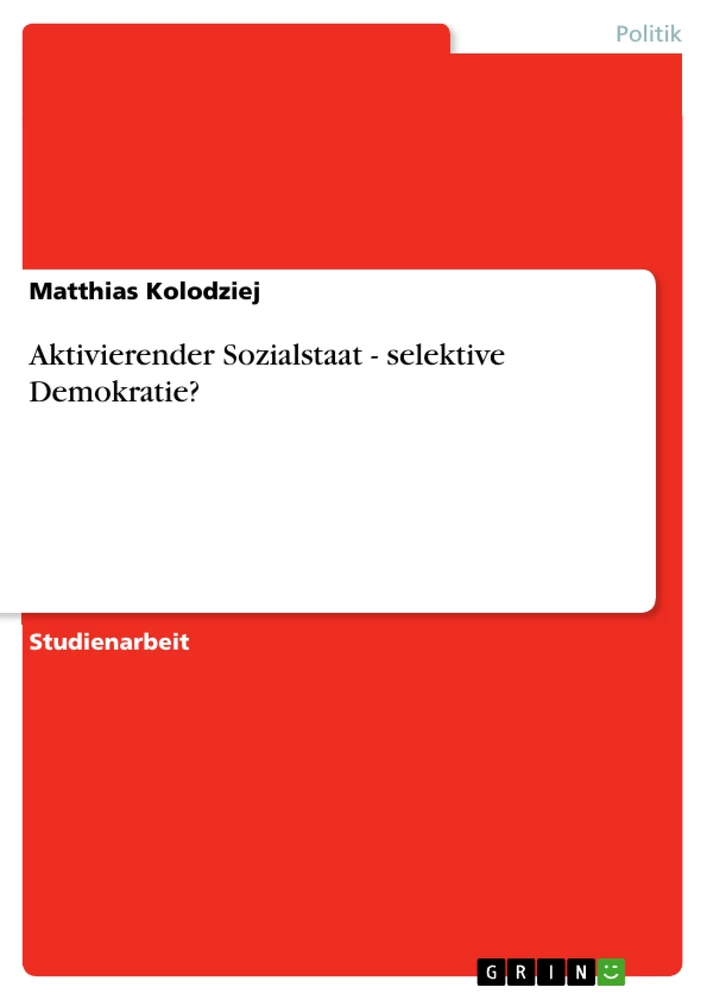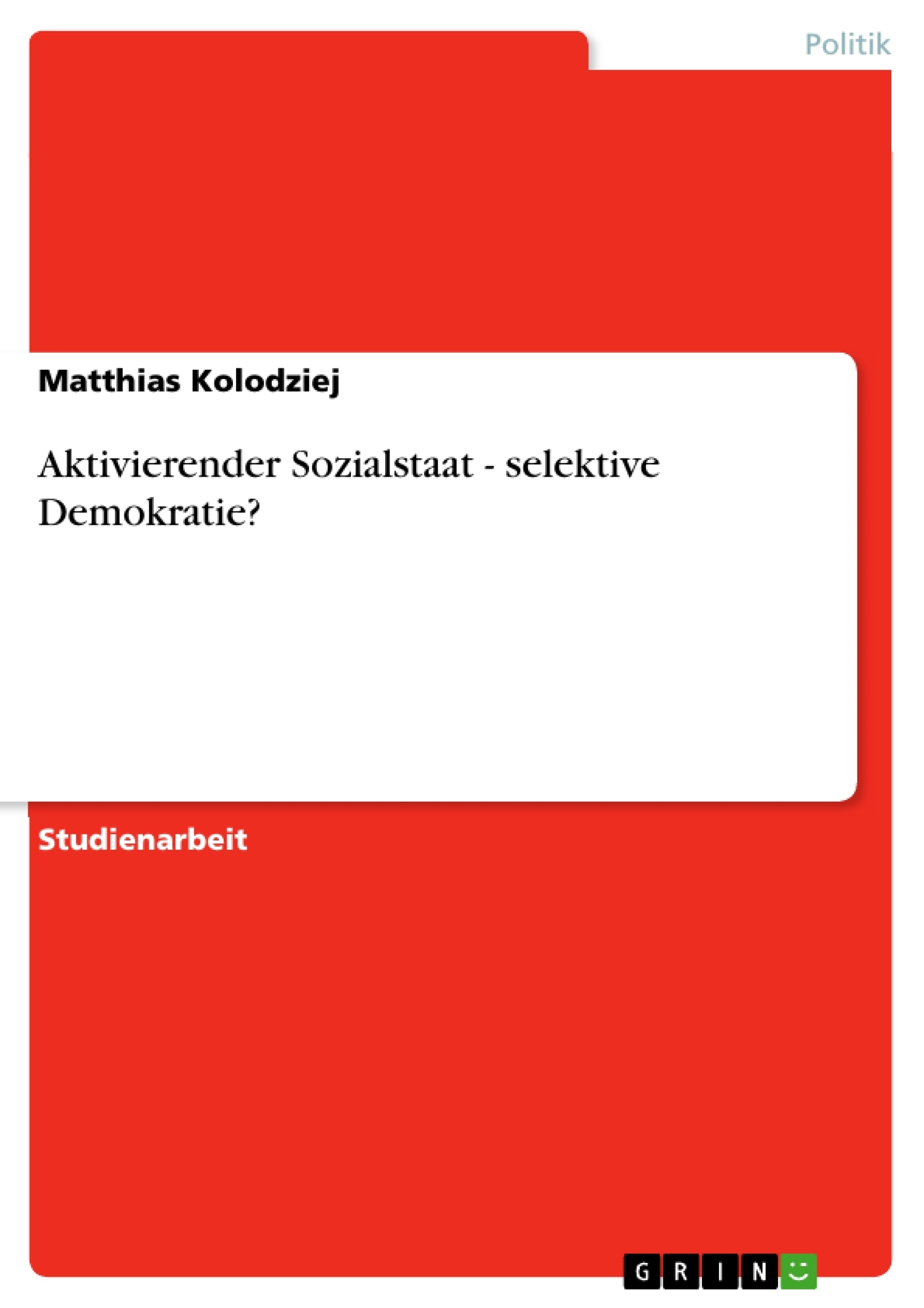Der deutsche Sozialstaat hat eine Tradition seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhun-derts. Reichskanzler Bismarck war damals gezwungen, auf dieHerausforderungen einer sich im Zeichen der Industrialisierung grundlegend wandelnden Gesellschaft zu reagieren. Eine große neue Bevölkerungsschicht entstand, die Arbeiterschicht, sie war mächtig und musste dementsprechend behandelt werden. So setzte Bismarck „Zuckerbrot und Peitsche“ ein, um der Schicht Herr zu werden, er sorgte dafür, dass die Arbeiter im Fall einer Erkrankung versorgt waren und dass sie im Alter ein Auskommen hatten. Zu diesen Maßnahmen war Bismarck gezwungen, da sich das gesellschaftliche Leben verändert hatte, das Leben war nicht mehr wie zuvor innerhalb von großen Familienverbünden organisiert, in denen verschiedene Lebensrisiken und –situationen bewältigt werden konnten, sondern man lebte nun in kleinen städtischen Wohnungen in kleinen Familienverbünden. Hier war eben diese Bewältigung der Lebenslagen nicht mehr in dem Maße möglich. Die Politik hatte darauf zu reagieren und tat dies im beschriebenen Rahmen. Später wurde dann auch eine Arbeitslosenversicherung eingeführt. Grundlegendes Prinzip der drei so genannten Sozialversicherungen war das Solidaritätsprinzip, wonach die Risiken einzelner von der Gesamtheit getragen wurden. Dieses Prinzip ist bis heute das Fundament des Sozialstaates Bundesrepublik Deutschland. Dabei gibt es eine Duplizität der Ereignisse, denn heute steht die Politik ebenso vor einer sich rasch wandelnden Gesellschaft, die durch die Folgen derjenigen Vorgänge, die als Globalisierung bezeichnet werden, bewirkt werden. Die Globalisierung kann im 21. Jahrhundert als ebenso wirkungsmächtiger Prozess begriffen werden wie es die Industrialisierung im 19. Jahrhundert war. Ein Prozess, der die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig verändert und auf den die Politik zu reagieren hat. An welcher Stelle steht nun der Sozialstaat im 21. Jahrhundert? Ist er noch zeitgemäß? Welche Herausforderungen stellt der Globalisierungsprozess und was sind die Kritikpunkte und Kontroversen um den Sozialstaat? Fragen wie diese sollen in der folgenden Arbeit beantwortet werden. Grundlegend wird dabei jedoch die These sein, dass den neuen Herausforderungen an den Sozialstaat und dessen Probleme mit dem Konzept eines „Aktivierenden Sozialstaates“ begegnet werden sollte. Was ist nun unter diesem Konzept zu verstehen und welches sind die Probleme, die damit bewältigt werden sollen? Es wird auch die Frage zu beantworten sein, welche Folgewirkungen dieses Konzept mit sich bringt, wer die Gewinner und die Verlierer sind. Eine schwerwiegende Folgewirkung scheint dabei die soziale Selektion zu sein. Denn es ist zu beobachten, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet und dass dadurch weite Teile der Bevölkerung vom sozialen Leben ausgeschlossen zu werden drohen. Wer stark ist und sich selber helfen kann, der ist auch abgesichert, wer nicht, der darf nur mit einem Minimum an Hilfe rechnen, kurz, nach derzeitigem Stand der Sozialgesetzgebung wird er mit den allernötigsten Lebensgrundlagen versorgt. Es ist also die Frage zu stellen, ob tatsächlich alle Menschen die Chancengleichheit haben, in einem solchen Sozialstaat zu leben oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Der Begriff des Sozialstaates
- Neue Herausforderungen und Probleme der Sozialstaatlichkeit
- Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats
- Der „aktivierende Sozialstaat“ in der Tagespolitik
- Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats im Bereich der Arbeitsmarktpolitik
- Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats im Bereich der Rentenpolitik
- Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats im Bereich der Gesundheitspolitik
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen des deutschen Sozialstaats im 21. Jahrhundert im Kontext der Globalisierung und analysiert das Konzept des „aktivierenden Sozialstaats“ als mögliche Antwort auf diese Herausforderungen. Die Arbeit hinterfragt die Auswirkungen dieses Konzepts auf die soziale Gerechtigkeit und die Chancengleichheit.
- Der Begriff und die Entwicklung des Sozialstaates in Deutschland
- Neue Herausforderungen für den Sozialstaat durch Globalisierung und gesellschaftliche Veränderungen
- Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats: Ziele, Maßnahmen und Kritikpunkte
- Analyse des aktivierenden Sozialstaats in der Arbeitsmarkt-, Renten- und Gesundheitspolitik
- Die Frage nach sozialer Selektion und Chancengleichheit im Kontext des aktivierenden Sozialstaats
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These auf, dass der „aktivierende Sozialstaat“ eine geeignete Antwort auf die Herausforderungen des modernen Sozialstaates darstellt. Sie verortet den Sozialstaat historisch im Kontext der Industrialisierung und der Globalisierung und skizziert die Forschungsfrage nach den Auswirkungen des Konzepts des aktivierenden Sozialstaats, insbesondere im Hinblick auf soziale Selektion und Chancengleichheit. Die Struktur der Arbeit wird dargelegt und der Fokus auf die Analyse des aktivierenden Sozialstaates im Kontext der deutschen Politik wird betont. Die Arbeit grenzt sich dabei explizit von umfassenden Darstellungen der deutschen Sozialpolitik und Diskursanalysen ab.
Theoretischer Teil: Dieser Teil liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse des aktivierenden Sozialstaats. Er beleuchtet den Begriff des Sozialstaats bzw. Wohlfahrtsstaats und die unterschiedlichen Auffassungen in der Wissenschaft. Es wird der Unterschied zwischen den Begriffen „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ diskutiert und die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips im Grundgesetz hervorgehoben. Der Abschnitt beleuchtet zudem die neuen Herausforderungen und Probleme der Sozialstaatlichkeit, die durch die Globalisierung und den gesellschaftlichen Wandel entstanden sind, und führt in das Konzept des aktivierenden Sozialstaats ein, um einen Rahmen für die spätere empirische Analyse zu schaffen. Die unterschiedliche Verwendung der Begriffe wird analysiert und eingeordnet.
Der „aktivierende Sozialstaat“ in der Tagespolitik: Dieser Abschnitt analysiert das Konzept des aktivierenden Sozialstaats in verschiedenen Politikfeldern der Bundesrepublik Deutschland. Es werden die Arbeitsmarkt-, Renten- und Gesundheitspolitik exemplarisch betrachtet, um die praktische Umsetzung und die Auswirkungen des Konzepts zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Stärken und Schwächen des Konzepts in diesen Bereichen, unter Einbezug aktueller politischer und wissenschaftlicher Debatten. Durch die Betrachtung unterschiedlicher Politikfelder wird die Reichweite und die Komplexität des Konzepts deutlich.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, aktivierender Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik, Gesundheitspolitik, soziale Selektion, Deutschland, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Der aktivierende Sozialstaat in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den deutschen Sozialstaat im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Globalisierung und untersucht das Konzept des „aktivierenden Sozialstaats“ als Reaktion auf neue Herausforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen dieses Konzepts auf soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Sozialstaates in Deutschland, neue Herausforderungen durch Globalisierung und gesellschaftliche Veränderungen, das Konzept des aktivierenden Sozialstaats (Ziele, Maßnahmen und Kritik), dessen Analyse in der Arbeitsmarkt-, Renten- und Gesundheitspolitik sowie die Frage nach sozialer Selektion und Chancengleichheit in diesem Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen Abschnitt zur Umsetzung des aktivierenden Sozialstaats in der Tagespolitik und Schlussbetrachtungen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit vor. Der theoretische Teil definiert den Sozialstaat und seine Herausforderungen. Der Hauptteil analysiert den aktivierenden Sozialstaat in verschiedenen Politikfeldern. Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Was wird im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil beleuchtet den Begriff des Sozialstaats und des Wohlfahrtsstaats, die Unterschiede zwischen beiden Begriffen, die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips im Grundgesetz und die neuen Herausforderungen der Sozialstaatlichkeit durch Globalisierung und gesellschaftlichen Wandel. Es wird das Konzept des aktivierenden Sozialstaats eingeführt.
Wie wird der aktivierende Sozialstaat in der Tagespolitik analysiert?
Der Abschnitt zur Tagespolitik analysiert den aktivierenden Sozialstaat exemplarisch in der Arbeitsmarkt-, Renten- und Gesundheitspolitik. Es werden die praktische Umsetzung, Auswirkungen, Stärken und Schwächen des Konzepts untersucht, unter Einbezug aktueller politischer und wissenschaftlicher Debatten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Sozialstaat, aktivierender Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik, Gesundheitspolitik, soziale Selektion, Deutschland, Grundgesetz.
Welche zentrale These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass der „aktivierende Sozialstaat“ eine geeignete Antwort auf die Herausforderungen des modernen Sozialstaates darstellt, wobei die Auswirkungen auf soziale Selektion und Chancengleichheit kritisch hinterfragt werden.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die zentrale These vor, verortet den Sozialstaat historisch und skizziert die Forschungsfrage. Sie beschreibt die Struktur der Arbeit und betont den Fokus auf die Analyse des aktivierenden Sozialstaats in der deutschen Politik. Die Arbeit grenzt sich dabei von umfassenden Darstellungen der deutschen Sozialpolitik ab.
Was ist das Fazit der Arbeit (Schlussbetrachtungen)?
(Der HTML-Auszug enthält keine expliziten Schlussbetrachtungen. Diese müssten aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Quote paper
- Matthias Kolodziej (Author), 2007, Aktivierender Sozialstaat - selektive Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86389