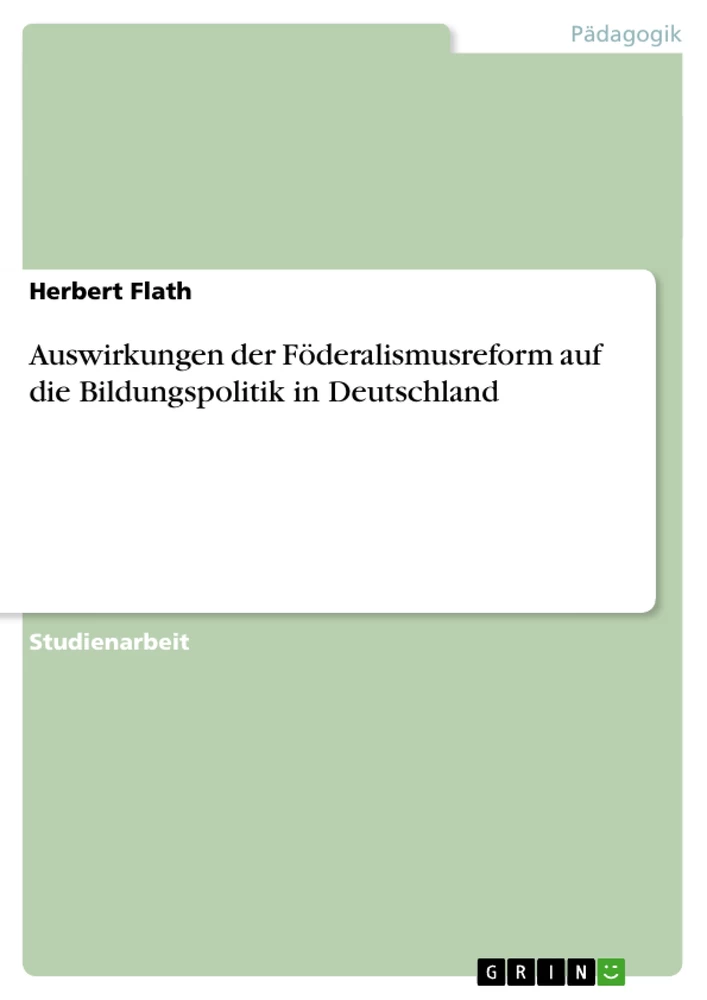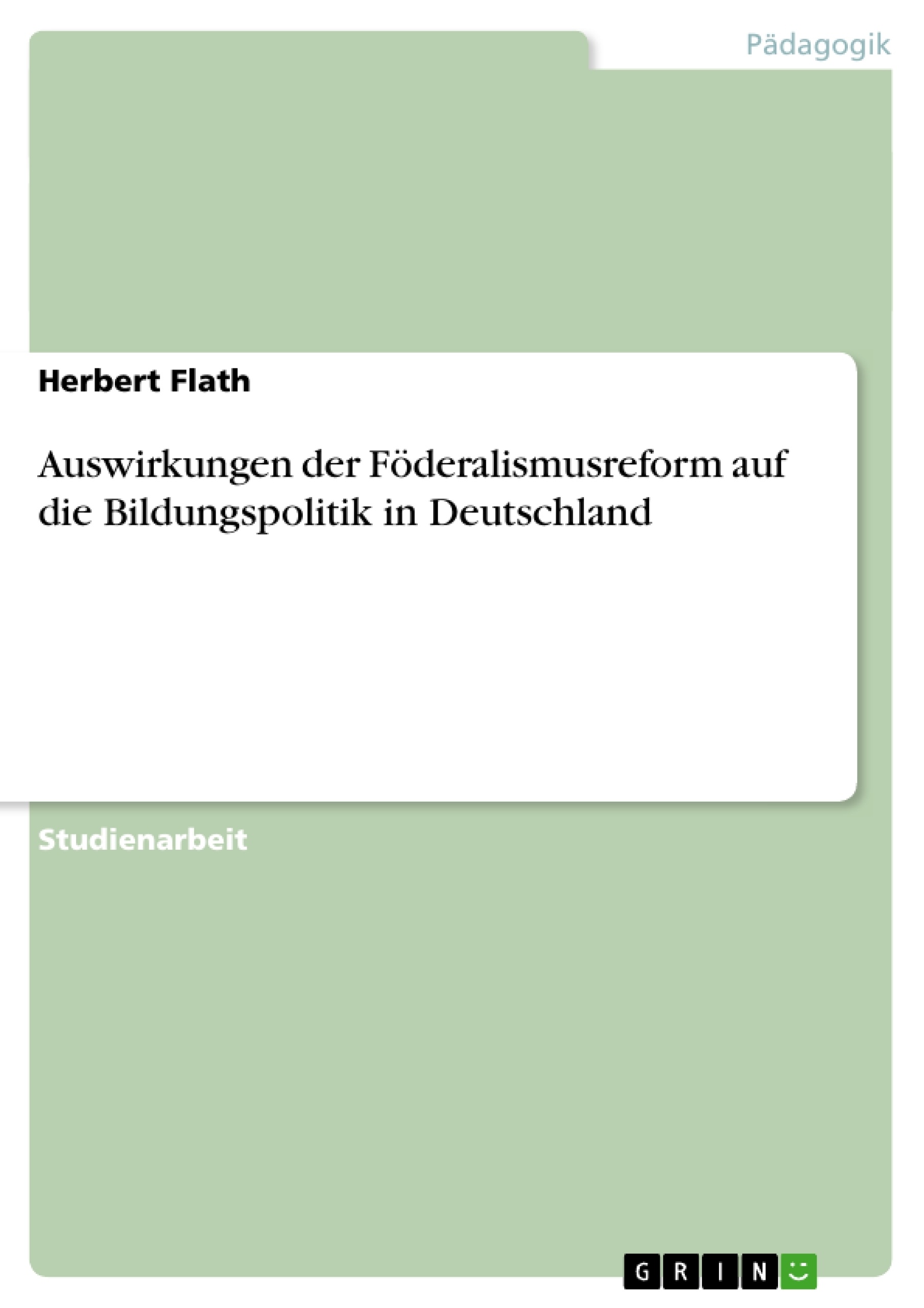Im Juni und Juli 2006 wurden das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ und das „Föderalismusreform-Begleitgesetz“ zunächst im Bundestag, anschließend im Bundesrat, verabschiedet. Damit war die Föderalismusreform – sprich die Neuordnung der Kompetenzen von Bund und Ländern – beschlossene Sache. Seit Jahren war sie diskutiert worden und bereits einmal, nämlich im Dezember 2004, war sie gescheitert. Nun, da sie verabschiedet ist, handelt es sich bei dieser Reform um die umfangreichste Verfassungsänderung seit Verkündung des Grundgesetzes 1949.
Deutschland als Bundesstaat ist in seiner Verfassung, also im Grundgesetz, auf das Prinzip des Föderalismus festgelegt – das bedeutet, der Bundesstaat besteht aus einzelnen Ländern, die zwar keine souveränen Staaten darstellen, allerdings zahlreiche eigene Kompetenzen besitzen. Andererseits treten diese Länder im Föderalismus aber auch zahlreiche Zuständigkeiten an den Bund ab. Im Laufe der Zeit hatte sich nun ein Problem in dieser Ordnung ergeben, welches zu einer Reform des Föderalismus drängte: Durch zahlreiche Änderungen des Grundgesetzes waren die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern in einigen Bereichen äußerst unübersichtlich verflochten, es war also gerade für Laien teilweise nahezu unmöglich, noch zu erkennen, wer wann wofür zuständig ist. Neben dieser komplexen Unübersichtlichkeit war außerdem die Tendenzen erkennbar, dass sich der Bund zunehmend Kompetenzen bediente, die im föderalistischen Sinne eher den Ländern zustehen.
Um den Föderalismus zu stärken und Zuständigkeiten zu entwirren, wurde bereits 2003 unter Bundeskanzler Schröder eine Reform der Bundesstaatlichen Ordnung in Angriff genommen. Diese scheiterte allerdings im Jahre 2004 am Streitpunkt Bildungspolitik. Nach der Bundestagswahl 2005 verankerten schließlich CDU und SPD einen neuen Anlauf für die Reform in ihrem Koalitionsvertrag, so dass diese Mitte 2006 in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden konnte. Seit dem 1. November 2006 sind nun die neuen Regelungen in Kraft getreten.
In dieser Arbeit soll zunächst die Bedeutung und Geschichte des Föderalismus in Deutschland besprochen werden. Anschließend rückt der Fokus konkret auf die Bildungspolitik: Zunächst wird betrachtet, wie die Zuständigkeiten bei der Bildung bisher geregelt waren, dann soll untersucht werden, was sich nun im Rahmen der Reform geändert hat und welche Auswirkungen dies hat bzw. haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Föderalismus in Deutschland
- Was bedeutet Föderalismus in Deutschland
- Geschichte des Föderalismus in Deutschland
- Die Föderalismusreform
- Die Geschichte der Reform
- Das umstrittene Kooperationsverbot
- Bisherige Verteilung der Kompetenzen in der Bildung
- Wichtige bildungspolitische Einrichtungen
- Die Kultusministerkonferenz
- Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
- Die bisherige Kompetenzverteilung für den Bildungssektor im Grundgesetz
- Änderungen in der Bildungspolitik durch die Föderalismusreform
- Aufhebung der Rahmengesetzgebung und Überführung in die konkurrierende Gesetzgebung
- Neufassung der Gemeinschaftsaufgaben
- Zusammenfassung und Kritik
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Bildungspolitik in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich und den möglichen Folgen dieser Reform für die Bildungssysteme in Deutschland.
- Die Bedeutung des Föderalismus in Deutschland
- Die Geschichte der Föderalismusreform
- Die Kompetenzverteilung in der Bildungspolitik vor und nach der Reform
- Die Auswirkungen der Reform auf die Bildungspolitik
- Kritik und Diskussion der Reform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt den Kontext der Föderalismusreform dar. Anschließend wird das Prinzip des Föderalismus in Deutschland erläutert, seine Bedeutung und seine historische Entwicklung. Dabei wird auch auf die Entstehung und Entwicklung des Bundesstaates Deutschland eingegangen. Die Arbeit widmet sich dann der Föderalismusreform, ihrer Geschichte und den wichtigsten Punkten der Reform. Es werden die bisherige Kompetenzverteilung in der Bildungspolitik und die wichtigsten Institutionen im Bildungsbereich vorgestellt. Im Anschluss wird analysiert, wie die Kompetenzverteilung in der Bildung durch die Föderalismusreform geändert wurde. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einer kritischen Betrachtung der Reform.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bildungspolitik, Grundgesetz, Kompetenzverteilung, Bundesstaat, Länder, Bund, Reform, Bildungssysteme, Kultusministerkonferenz, Bund-Länder-Kommission.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hauptzweck der Föderalismusreform 2006?
Hauptzweck war die Neuordnung und Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhöhen und Verantwortlichkeiten klarer zu definieren.
Wie hat sich die Bildungspolitik durch die Reform verändert?
Die Rahmengesetzgebung des Bundes wurde weitgehend abgeschafft. Die Länder erhielten mehr Eigenständigkeit, während das sogenannte Kooperationsverbot die direkte Finanzierung von Bildungsaufgaben durch den Bund einschränkte.
Was versteht man unter dem Kooperationsverbot?
Das Kooperationsverbot besagt, dass der Bund den Ländern keine Finanzhilfen für Aufgaben gewähren darf, die in deren alleinige Zuständigkeit fallen, wie etwa der Schulbereich.
Welche Rolle spielt die Kultusministerkonferenz (KMK)?
Die KMK dient als wichtiges Instrument der Länderkoordination, um trotz der Kulturhoheit der Länder eine gewisse Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit im Bildungswesen zu gewährleisten.
Warum scheiterte die Reform zunächst im Jahr 2004?
Der erste Anlauf scheiterte vor allem am Streitpunkt der Bildungspolitik, da sich Bund und Länder nicht über die Verteilung der Kompetenzen im Bildungssektor einigen konnten.
- Quote paper
- Herbert Flath (Author), 2005, Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Bildungspolitik in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86400