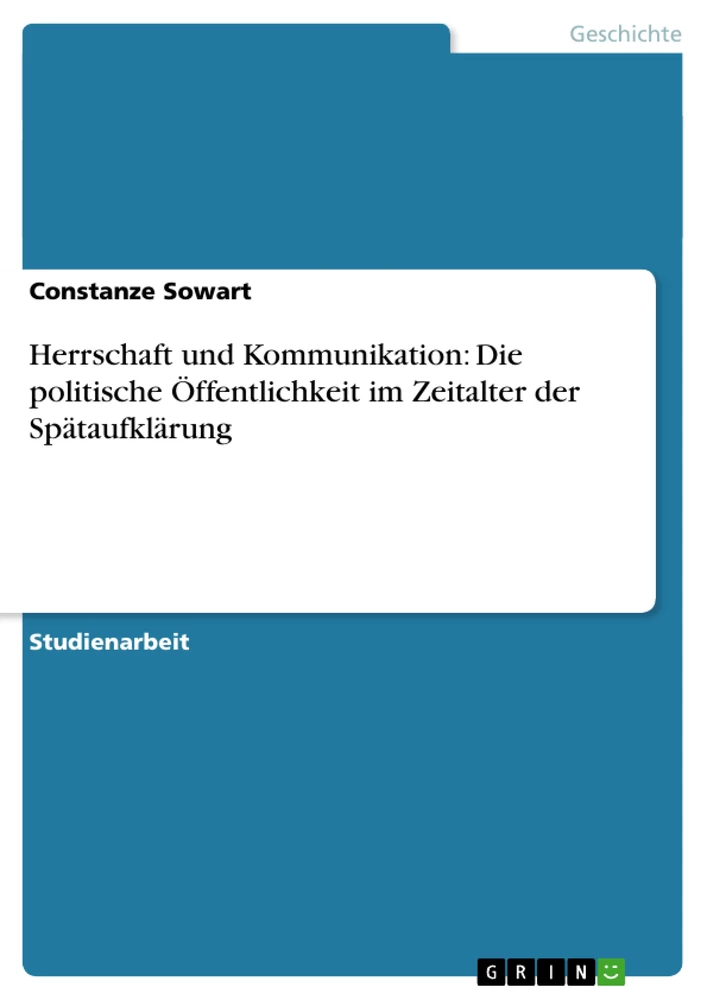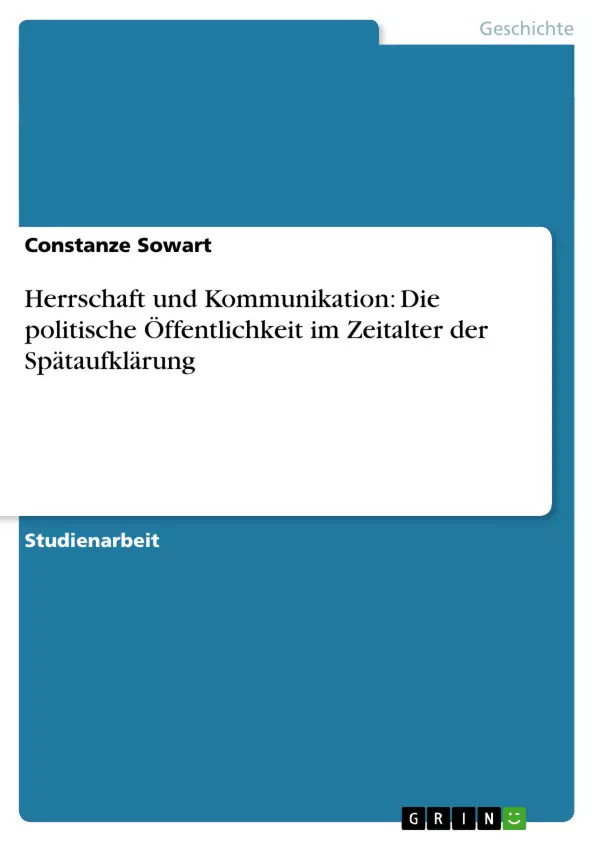Es scheint sich – nicht nur aufgrund der neuen Kultur-Politik-Geschichtsschreibung – fast von selbst zu verstehen, Herrschaft als „kommunikativ-dynamischen Prozess“ zu verstehen. Das zugrundeliegende Modell besitzt eine Reihe sinnvoller Elemente. Es unterscheidet analytisch verschiedene „Figurationen des Kommunikationsphänomens“ und bezieht sie aufeinander: Information, Medium und Öffentlichkeit. Letztere aber als kommunikativen Raum aufzufassen, der „Vorgänge und Handlungen auch in einseitiger, zufälliger oder gewollter Informations-übermittlung sichtbar macht“, führt zu einem diffusen Begriff, der beliebige „Orte“ zu For-men der Öffentlichkeit macht – vom Straßenauflauf, einer Zunft, einer Behörde, einer Lesegesellschaft bis zum Militär. Hier soll dagegen ein deutlich engerer Begriff von Öffentlichkeit verwendet werden. Ihre Teilnehmer kommunizieren bewusst, mit gemeinsamen Kommunikationsabsichten, allen zugänglichen Formen und vor allem mit allen interessierenden Inhalten; Öffentlichkeit reflektiert und bewertet die transportierten Inhalte. Dies trifft sich zumindest mit einer weiteren Prämisse des Modells, das Kommunikation als von beiden Seiten aktive Beziehung von Sender und Empfänger beschreibt. Herrschaft wird damit zum Aushandlungsprozess. Dies geschieht in Abgrenzung zum Herrschaftsbegriff Max Webers, der Herrschaft bekanntlich als Chance zum Befehlsgehorsam definierte. Allerdings wird damit der bewusst eng gehaltene Herrschaftsbegriff Webers mit dem bewusst amorph gehaltenen Begriff der Macht verwischt. Begibt man sich in das Begriffsfeld „soziale Macht“ ist der relationale Charakter dieser Beziehung wie die Bedeutung von Kommunikation ohnehin immanent. Dies gilt im übrigen auch für Weber, der Macht parallel zu sozialen Beziehungen im allgemeinen definiert. Diese werden grundsätzlich als relational und sinnhaft aufgefasst und setzen damit Kommunikation voraus.
Kommunikation ist in mehrfacher Hinsicht Bedingung von Herrschaft bzw. Macht. Dem Modell droht dennoch Gefahr aus zweierlei Richtung. Dass Herrschaft sich erst durch ein funktionierendes Kommunikations- und Verkehrsnetz konstituierte, ist als Forschungsrahmen sinnvoll, als „These“ jedoch ist es trivial. Wenn man Aushandlungsprozesse als fundamental ansieht, darf die Nachricht bzw. die Information nicht hinter den Medien zurückstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Herrschaft als kommunikativ dynamischer Prozess...
- 2. Ausdehnung und Träger der neuen Öffentlichkeit......
- 3. Aufklärung und Obrigkeit: Herrschaftskritik in der Öffentlichkeit
- 4. Unruhen und aufgeklärte Öffentlichkeit
- 5. Grenzen, Weite und Ambivalenz der politischen Öffentlichkeiten: ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Rolle der Kommunikation im Kontext von Herrschaft im Zeitalter der Spätaufklärung. Es wird erörtert, wie sich Herrschaft durch kommunikative Prozesse konstituiert und verändert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die neue politische Öffentlichkeit und ihre Bedeutung für den Wandel von Herrschaft liegt.
- Die Bedeutung von Kommunikation für die Konstitution und Dynamik von Herrschaft
- Die Entstehung und Entwicklung der neuen politischen Öffentlichkeit im Zeitalter der Spätaufklärung
- Die Rolle der Aufklärung in der Kritik an der Obrigkeit und der Etablierung einer neuen Ordnung
- Die Auswirkungen von Unruhen und gesellschaftlichen Umbrüchen auf die politische Öffentlichkeit
- Die Grenzen, Möglichkeiten und Ambivalenzen der politischen Öffentlichkeit in der Spätaufklärung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Herrschaft als kommunikativ dynamischer Prozess
Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept von Herrschaft als dynamischen Prozess, der durch Kommunikation geprägt ist. Es werden verschiedene Modelle der Kommunikation und ihre Bedeutung für die Ausübung von Herrschaft analysiert, wobei ein Schwerpunkt auf der Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Kommunikation liegt. - Kapitel 2: Ausdehnung und Träger der neuen Öffentlichkeit
Hier wird die Entstehung und Entwicklung der neuen politischen Öffentlichkeit in der Spätaufklärung untersucht. Es wird erläutert, wie sich diese Öffentlichkeit durch verschiedene Träger wie bürgerliche Sozietäten, wissenschaftliche Gesellschaften und die Presse konstituierte und welche Auswirkungen sie auf die gesellschaftlichen Machtverhältnisse hatte. - Kapitel 3: Aufklärung und Obrigkeit: Herrschaftskritik in der Öffentlichkeit
Dieses Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung der Aufklärung mit der Obrigkeit und dem absolutistischen Staat. Es wird dargestellt, wie die öffentliche Kommunikation von Aufklärern dazu beitrug, das bestehende Herrschaftsmodell zu hinterfragen und alternative Konzepte der Herrschaft zu entwickeln. - Kapitel 4: Unruhen und aufgeklärte Öffentlichkeit
Hier werden die Auswirkungen von Unruhen und gesellschaftlichen Umbrüchen auf die politische Öffentlichkeit untersucht. Es wird gezeigt, wie die öffentliche Kommunikation in Zeiten der Krisen und des Wandels eine wichtige Rolle spielte, um die öffentliche Meinung zu formen und die Herrschaft zu beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Textes sind: Herrschaft, Kommunikation, politische Öffentlichkeit, Spätaufklärung, Aufklärung, Obrigkeit, gesellschaftlicher Wandel, Unruhen, Kritik, Legitimation, Macht, Naturrecht, bürgerliche Sozietäten, Literatur, Presse, Medien.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Herrschaft in der Spätaufklärung verstanden?
Herrschaft wird als ein kommunikativ-dynamischer Prozess und als Aushandlungsverhältnis zwischen Regierenden und Regierten aufgefasst.
Was kennzeichnet die "neue politische Öffentlichkeit"?
Teilnehmer kommunizieren bewusst mit gemeinsamen Absichten über alle interessierenden Inhalte und bewerten diese kritisch.
Wie grenzt sich dieser Herrschaftsbegriff von Max Weber ab?
Während Weber Herrschaft als Chance zum Befehlsgehorsam definierte, betont dieses Modell den relationalen Charakter von Macht.
Welche Rolle spielten bürgerliche Sozietäten?
Lesegesellschaften und wissenschaftliche Gesellschaften waren zentrale Träger der neuen Öffentlichkeit und Orte der Herrschaftskritik.
Warum ist Kommunikation eine Bedingung für Macht?
Machtbeziehungen sind grundsätzlich relational und sinnhaft; sie setzen den Austausch von Informationen und die Anerkennung von Geltungsansprüchen voraus.
- Citar trabajo
- Constanze Sowart (Autor), 2007, Herrschaft und Kommunikation: Die politische Öffentlichkeit im Zeitalter der Spätaufklärung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86874