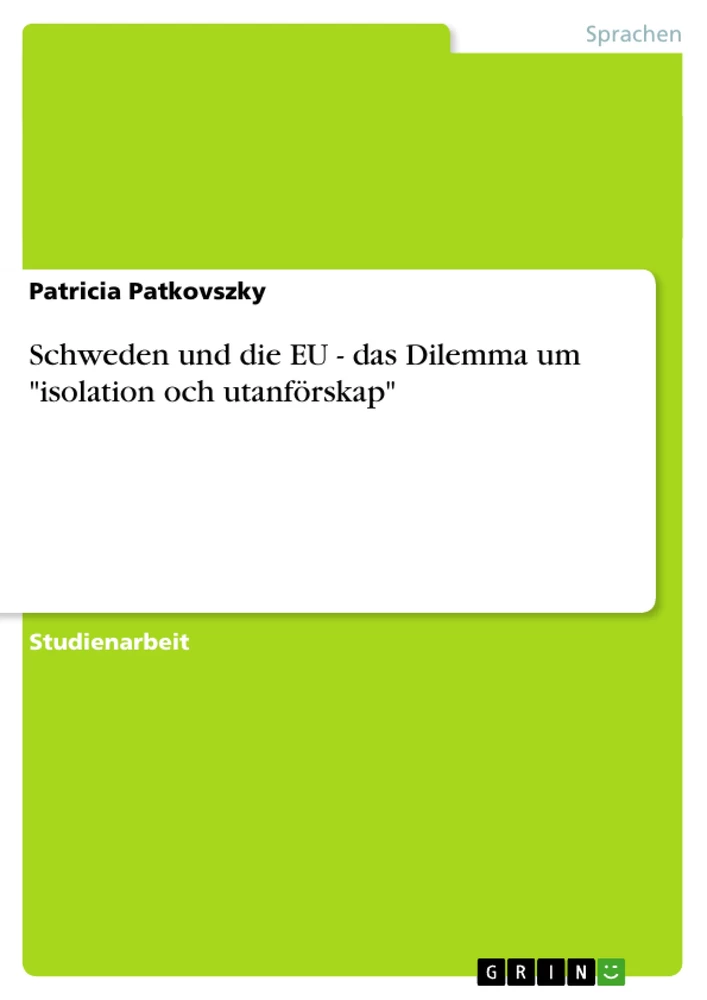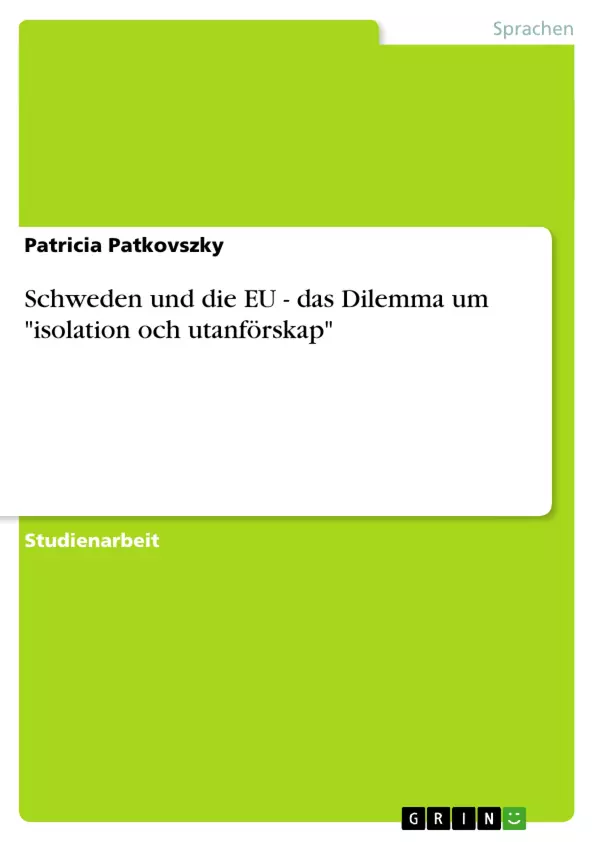Die Schweden gelten gemeinhin als Europa-Skeptiker.
Zwar ist Schweden geographisch gesehen ein Teil Europas und trat 1995 auch der
Europäischen Union bei - die innere Einstellung und die politische Haltung seiner
Bewohner vermittelt jedoch eher das Bild von unwilligen Mitgliedern. Sie scheinen sich
Europa ganz einfach nicht zugehörig fühlen zu wollen und zeigen dies auch deutlich
bei Umfragen, Wahlen und Volksabstimmungen.
Dazu mag das Selbstbild der Schweden über sich und ihr Land beitragen. Ein Selbstbild,
das stark mit der Mentalität der Schweden zusammenhängt.
Diese Arbeit soll einen Einblick geben, warum sich die Bewohner Schwedens nur so
unwillig und mühsam für die Idee einer europäischen Gemeinschaft begeistern konnten
und können. Was bedeutet die Europäische Union für die Schweden, warum fürchten sie eine dortige Partizipation und verhinderten den Beitritt zur Währungsgemeinschaft?
Um die Hintergründe zu verstehen, beginne ich mit einer Übersicht über die Geschichte
des schwedischen EU-Beitritts. Danach werde ich die Züge der schwedischen Mentalität
beleuchten, die als mögliche Ursachen für Schwedens Außenseiterposition als europäischer
Partner dienen können. Abschließend möchte ich kurz auf die Europa-Politik
Schwedens eingehen, insbesondere auf die gescheiterte Volksabstimmung zum Euro
2003 und die aktuelle Debatte zur Europäischen Verfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Volksheim zum Europäischen Haus
- Das Verhältnis zu Europa in der schwedischen Geschichte
- Schwedens Europa-Politik
- Die Volksabstimmung zur Währungsunion 2003
- Die Europäische Verfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die skeptische Haltung der schwedischen Bevölkerung gegenüber der Europäischen Union. Ziel ist es, die Gründe für diese Zurückhaltung zu beleuchten und die Auswirkungen auf die schwedische Europapolitik aufzuzeigen. Die Analyse fokussiert auf die historische Entwicklung des schwedisch-europäischen Verhältnisses, die schwedische Identität und ihre Rolle in der europäischen Integration.
- Schwedens Selbstbild und das "halva inne-syndromet"
- Das Schwedische Modell und seine Bedeutung für die europäische Integration
- Die schwedische Europapolitik und die Herausforderungen der EU-Mitgliedschaft
- Die Rolle der Volksabstimmung zur Währungsunion 2003
- Die Bedeutung der schwedischen Identität für die europäische Integration
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die These auf, dass Schweden trotz seiner EU-Mitgliedschaft eine skeptische Haltung gegenüber der europäischen Integration pflegt. Die Arbeit befasst sich mit der "Halb-und-Halb-Mentalität" der Schweden und dem Einfluss des "Schwedischen Modells" auf die europäische Integration.
- Kapitel 2 beleuchtet den Weg Schwedens vom "Volksheim" zum "Europäischen Haus" und analysiert die Entwicklung der schwedischen Identität im Kontext der europäischen Integration.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem historischen Verhältnis Schwedens zu Europa und untersucht die schwedische Europapolitik im Laufe der Zeit.
- Kapitel 4 analysiert die schwedische Europapolitik im Detail, mit einem Schwerpunkt auf der Volksabstimmung zur Währungsunion 2003 und der Debatte um die Europäische Verfassung.
Schlüsselwörter
Schwedische Identität, Europäische Union, Integration, Europa-Skepsis, "halva inne-syndromet", Schwedisches Modell, Volksabstimmung, Währungsunion, Europäische Verfassung, Geschichte, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Warum gelten Schweden oft als Europa-Skeptiker?
Die Skepsis rührt oft von einem starken schwedischen Selbstbild und der Sorge her, dass die EU-Integration das „Schwedische Modell“ (den Wohlfahrtsstaat) und die nationale Souveränität gefährden könnte.
Was bedeutet das „halva inne-syndromet“?
Es beschreibt eine schwedische Mentalität der „Halb-Zugehörigkeit“: Man ist zwar Mitglied der EU, fühlt sich aber innerlich nicht voll zugehörig und bewahrt eine distanzierte Haltung.
Warum scheiterte die Euro-Volksabstimmung 2003 in Schweden?
Die Mehrheit der Schweden stimmte gegen den Beitritt zur Währungsunion, vor allem aus Angst vor Kontrollverlust über die eigene Wirtschaftspolitik und die Beibehaltung der schwedischen Krone als Identitätssymbol.
Wie hat sich Schwedens Weg vom „Volksheim“ zum EU-Mitglied entwickelt?
Nach langer Neutralität und Fokus auf das interne Sozialmodell trat Schweden 1995 der EU bei, was einen bedeutenden Wandel in der Außen- und Identitätspolitik markierte.
Welche Rolle spielt die Europäische Verfassung in der schwedischen Debatte?
Die Debatte um die Verfassung verstärkte die Befürchtungen vor einem europäischen „Superstaat“, was die traditionelle schwedische Zurückhaltung gegenüber einer tieferen politischen Union widerspiegelte.
- Citation du texte
- Patricia Patkovszky (Auteur), 2007, Schweden und die EU - das Dilemma um "isolation och utanförskap", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87054