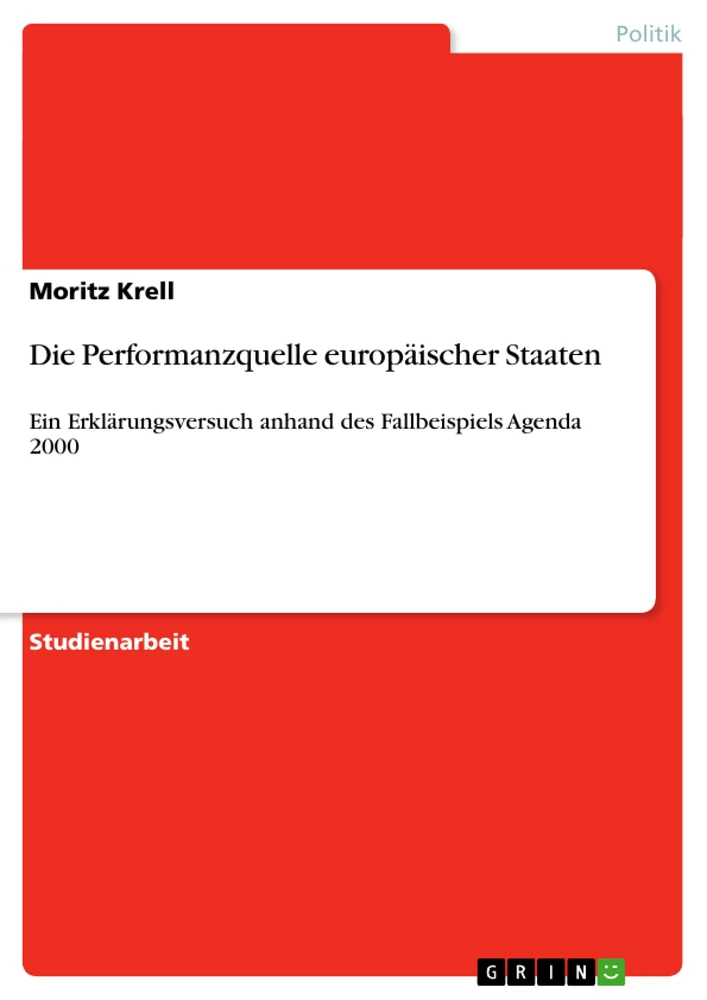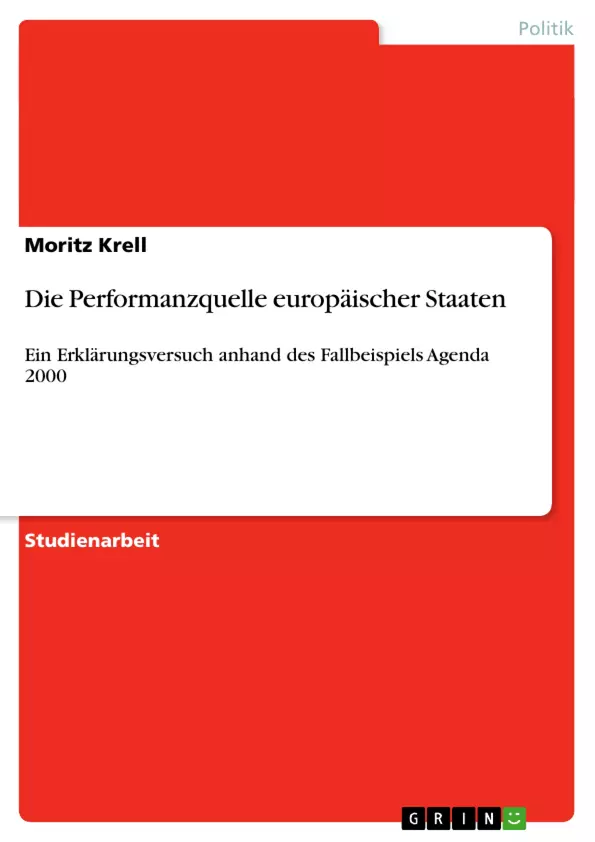Die Europäische Union (EU) ist derzeit für rund 80% aller politischen Entscheidungen ihrer Mitgliedsstaaten verantwortlich. Zentrales Organ ist hierbei der Ministerrat der EU, in welchem die Regierungen in unterschiedlichen Verfahrensweisen über die Ausgestaltung zukünftiger europäischer Politiken verhandeln. Betrachtet man die Empirie, können Unterschiede in der Fähigkeit, seine eigene Position in dem Verhandlungsverlauf zu behaupten, zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten beobachtet werden.
Das empirische Puzzle, das sich hieraus als Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit ergibt, ist somit der Grund dieser zeitlich synchron und diachron auftretenden Unterschiede bezüglich der Durchsetzungsfähigkeit eigener Interessen auf europäischer Ebene. Konkreter geht es darum, Erklärungen dafür vorzustellen, weshalb einige nationalstaatliche Akteure besser und andere schlechter befähigt sind, ihre Ziele innerhalb der EU zu erreichen. Die abhängige Variable (AV) dieser Arbeit ist also die Performanz von Mitgliedsstaaten der EU bei der Regelsetzung auf europäischer Ebene. Um diese zu erklären werden im ersten Teil dieser Arbeit zwei konkurrierende Theorien als Erklärungsansätze vorgestellt. Zum einen das Mehrheits- und Konsensmodell der demokratischer Systeme nach Lijphart und zum anderen der Intergouvernementalismus, welcher auf Hoffmann zurückgeht.
In einem weiteren Schritt werden aus diesen beiden Ansätzen Hypothesen abgeleitet, die zuerst operationalisiert und daraufhin weiter plausibilisiert werden. Die Plausibilität der Theorien wird mithilfe der Untersuchung von Selck/Kaeding geprüft, die eine Korrelation zwischen Ausgangsposition der Staaten und Verhandlungsergebnis errechnet haben. Somit ergibt sich ein erster Eindruck über die Eignung der Theorien, die gewählte AV zu erklären.
Der zweite Teil der Arbeit ist ein Fallbeispiel, mit dem die plausible Theorie weiter plausibilisiert oder im Idealfall verifiziert (bzw. falsifiziert) wird. Da die Untersuchung von Selck/Kaeding empirische Daten aus den Jahren 1999 und 2000 benutzt hat, ist es optimal auch das Fallbeispiel aus diesem Zeitraum zu wählen. Deshalb wird im zweiten Teil die Hypothese einer Theorie am Beispiel der Performanz Deutschlands bei den Verhandlungen über die Agenda 2000 weiter geprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mehrheits- und Konsensdemokratien
- 3. Intergouvernementalismus
- 4. Ableitung der Hypothesen
- 4.1 Föderalismus
- 4.2 Intergouvernementalismus
- 5. Operationalisierung
- 5.1 Performanz in der Regelsetzung (AV)
- 5.2 Föderalismusgrad (UV1)
- 5.3 Wirtschaftskraft
- 6. Erste Plausibilisierung
- 7. Fallbeispiel: Die Agenda 2000
- 7.1 Inhaltlicher und zeitlicher Kontext
- 7.2 Mitwirkungen der Länder
- 7.3 Die Länderinteressen
- 7.4 Die deutsche Position
- 7.5 Ergebnisse der Ratsverhandlung
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedlichen Fähigkeiten von EU-Mitgliedsstaaten, ihre Interessen in der europäischen Politikgestaltung durchzusetzen. Sie analysiert, warum einige Staaten ihre Ziele effektiver erreichen als andere. Der Fokus liegt auf der Performanz von Staaten in der Regelsetzung auf europäischer Ebene, wobei zwei konkurrierende Theorien, Mehrheits- und Konsensmodell sowie Intergouvernementalismus, als Erklärungsansätze dienen.
- Performanz von EU-Mitgliedsstaaten in der Regelsetzung
- Unterschiede in der Durchsetzungsfähigkeit nationaler Interessen auf europäischer Ebene
- Erklärungsansätze: Mehrheits- und Konsensmodell sowie Intergouvernementalismus
- Operationalisierung und Plausibilisierung der Theorien
- Fallbeispiel: Die deutsche Position in den Verhandlungen zur Agenda 2000
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beschreibt das empirische Puzzle der unterschiedlichen Performanz von EU-Mitgliedsstaaten bei der Durchsetzung ihrer Interessen. Die abhängige Variable der Arbeit ist die Performanz in der Regelsetzung, und es werden zwei konkurrierende Theorien (Mehrheits- und Konsensmodell sowie Intergouvernementalismus) als Erklärungsansätze vorgestellt.
- Kapitel 2: Mehrheits- und Konsensdemokratien Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Föderalismus und dessen Einfluss auf die Entscheidungsfindung in Nationalstaaten. Es wird die Typologie der Demokratiemodelle von Lijphart vorgestellt, die zwischen Mehrheits- und Konsensdemokratien unterscheidet. Im Fokus steht die „federal-unitary dimension“ und ihre Relevanz für die Einordnung von Staaten als unitarisch oder föderal.
- Kapitel 3: Intergouvernementalismus Das Kapitel erläutert die Grundannahmen des Intergouvernementalismus, der Europäische Integration als ein Ergebnis von Verhandlungen zwischen nationalen Regierungen auf Basis ihrer eigenen Interessen und Verhandlungsmacht betrachtet. Es werden die wichtigsten Aspekte des Intergouvernementalismus wie die Bedeutung von Veto-Möglichkeiten, die Kosten-Nutzen-Abwägung und die Rolle von unilateralen Alternativen dargestellt.
- Kapitel 4: Ableitung der Hypothesen Dieses Kapitel leitet aus den zuvor dargestellten Theorien Hypothesen ab, die in den folgenden Kapiteln geprüft werden. Es werden Hypothesen zum Einfluss des Föderalismusgrades und der Wirtschaftskraft auf die Performanz von Staaten in der EU-Regelsetzung formuliert.
- Kapitel 5: Operationalisierung In diesem Kapitel werden die zuvor abgeleiteten Hypothesen operationalisiert. Es werden messbare Indikatoren für die Performanz in der Regelsetzung, den Föderalismusgrad und die Wirtschaftskraft definiert, um die Hypothesen empirisch zu überprüfen.
- Kapitel 6: Erste Plausibilisierung Dieses Kapitel prüft die Plausibilität der Theorien mithilfe einer Untersuchung von Selck/Kaeding, die eine Korrelation zwischen der Ausgangsposition von Staaten und dem Verhandlungsergebnis errechnet haben. Die Ergebnisse liefern einen ersten Eindruck über die Eignung der Theorien, die gewählte AV zu erklären.
- Kapitel 7: Fallbeispiel: Die Agenda 2000 Dieses Kapitel analysiert die deutsche Position in den Verhandlungen zur Agenda 2000 als Fallbeispiel, um die plausiblere Theorie weiter zu plausibalisieren oder zu verifizieren. Es werden der inhaltliche und zeitliche Kontext der Agenda 2000, die Mitwirkungen der Länder, die Länderinteressen, die deutsche Position und die Ergebnisse der Ratsverhandlung analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen dieser Arbeit sind: Performanz von EU-Mitgliedsstaaten, Regelsetzung auf europäischer Ebene, Mehrheits- und Konsensdemokratien, Intergouvernementalismus, Föderalismus, Wirtschaftskraft, Agenda 2000, Verhandlungsmacht, Interessenvertretung.
Häufig gestellte Fragen
Warum setzen sich manche EU-Staaten besser durch als andere?
Die Arbeit untersucht Faktoren wie Wirtschaftskraft, Föderalismusgrad und die Verhandlungsmacht im Ministerrat als Ursachen für unterschiedliche Performanz.
Was ist Intergouvernementalismus?
Ein Theorieansatz, der die EU-Integration als Ergebnis von Verhandlungen zwischen souveränen Nationalstaaten sieht, die ihre eigenen Interessen verfolgen.
Welchen Einfluss hat der Föderalismus auf die EU-Politik?
Staaten mit starkem Föderalismus (wie Deutschland) müssen oft interne Abstimmungsprozesse mit den Ländern berücksichtigen, was die nationale Verhandlungsposition beeinflussen kann.
Was war die Agenda 2000?
Ein umfangreiches Reformprogramm der EU zur Vorbereitung auf die Osterweiterung, das als Fallbeispiel für nationale Interessenverhandlungen dient.
Wie wird Performanz in der Regelsetzung gemessen?
Performanz wird oft über die Korrelation zwischen der ursprünglichen Ausgangsposition eines Staates und dem tatsächlichen Verhandlungsergebnis definiert.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Moritz Krell (Autor), 2006, Die Performanzquelle europäischer Staaten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87538