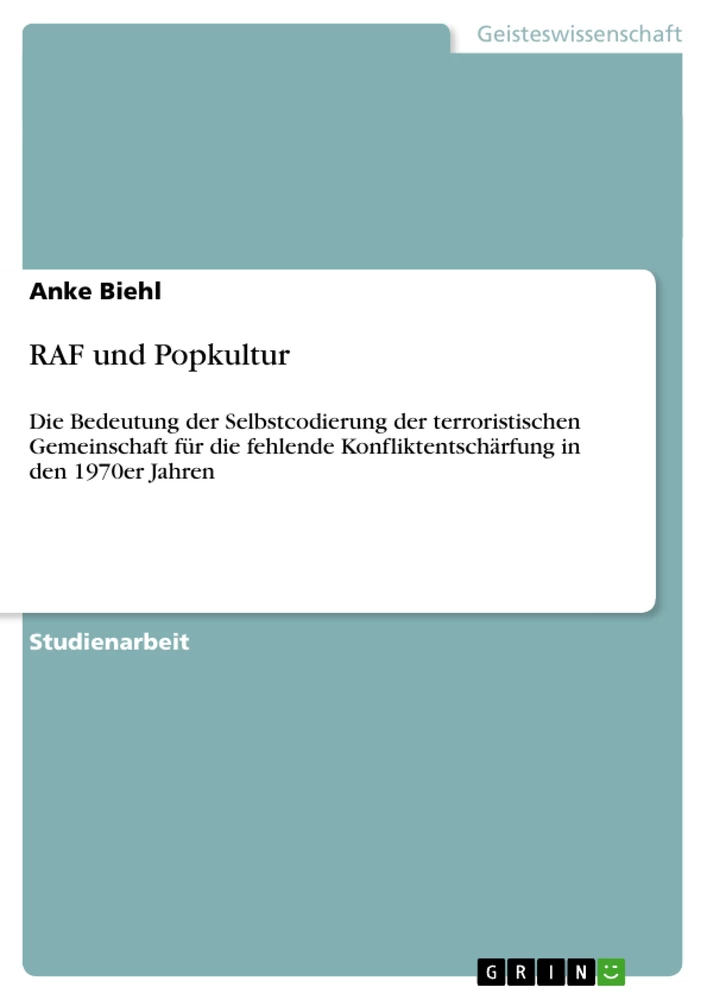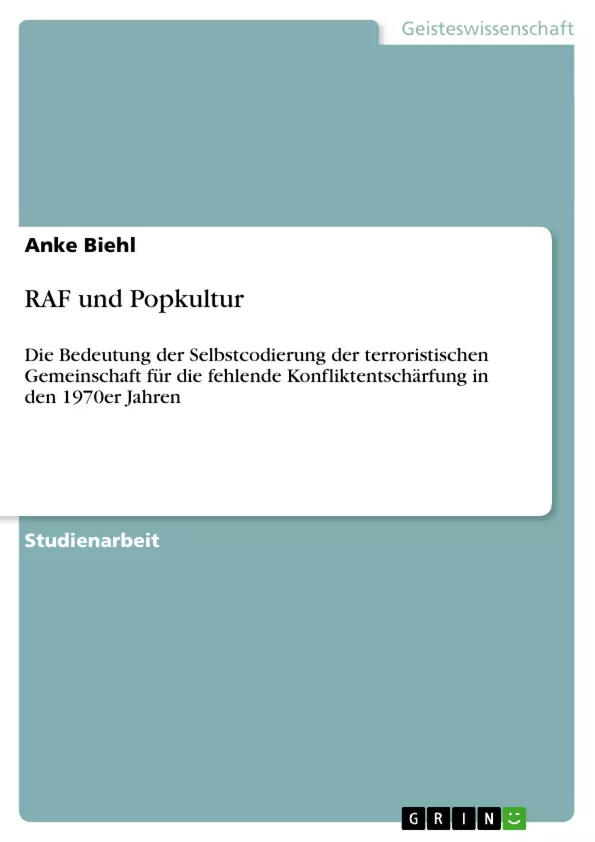Bei der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der „Roten Armee Fraktion“ im Zusammenhang mit der zunehmenden Konflikteskalation in den 1970er Jahren zwischen Staat und RAF in Deutschland stellt sich die interessante Frage nach dem Selbstbild der Gruppe. Denn die Zuschreibungen des Staates an die RAF als eine Organisation von gewalttätigen linken Terroristen, die das demokratische Fundament angreifen, wurden von den RAF-Mitgliedern und -Sympathisanten selbstverständlich nicht geteilt. Es soll im Folgenden herausgearbeitet werden, wie die Selbstcodierung der Gruppe eine Konfliktentschärfung verhindert, im Grunde unmöglich gemacht hat.
Um sich dem Selbstkonzept (der Selbstdarstellung, dem Selbstverständnis) der terroristischen Gemeinschaft anzunähern, ist zunächst zu fragen, wie sich eine Gemeinschaft formieren kann. Diese Formation erfolgt meist von zwei Seiten.
Zunächst einmal erfolgt Abgrenzung erfolgt von innen heraus durch geteilte Ideale, Vorstellungen und Feindbilder und eine bewusste Abgrenzung zur Umgebung. Zugleich kann die Entstehung einer Gemeinschaft außerdem von außen heraus gestärkt werden, durch Ausgrenzung der Gruppe, Ablehnung ihrer Vorstellungen und Ideale. Nicht zu vernachlässigen in diesem Formationsprozess ist die Stärkung des „Wir-Gefühls“ einer Gruppe durch eine Betonung der Differenzen mit der Umwelt, durch Konflikte zu den Anderen. So geschah es auch bei der RAF, deren Innenbild sich eklatant von dem Außenbild des Staates absetzte. Eine Annäherung war so schwer möglich. Was beiden Seiten in der Darstellung der Gruppe der RAF gemeinsam ist, lässt sich unter dem Phänomen der Überhöhung und Mystifizierung der Aktivisten fassen, auf Seiten des Staates durch eine übertriebene Staatsparanoia , auf der anderen Seite durch die zum Teil an die Popkultur angelehnte Codierung der RAF selbst, z.B. in Form von Heroisierung der Mitglieder.
Interessante Fragen sind also, ob sich die Terroristen selbst als „Terroristen“ wahrgenommen haben, was ihre Ideale, Vorstellungen, Erkennungsmerkmale darstellten, wie ihr Weltbild aufgebaut war und wieso daraus diese Eskalation besonders in den 1970er Jahren entstehen konnte.
Da die Selbstcodierung überwiegend über die Sprache verläuft – überspitzt lässt sich formulieren: „Ich bin, wie ich es sage!“ – finden sich viele Hinweise auf die Selbstsicht und Selbstperformance der RAF in ihrer Sprache, die daher im Folgenden als Grundlage einer Analyse untersucht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Selbstcodierung in der Terroristengemeinschaft
- Auf den Spuren der Selbstcodierung I: Geisslers kamalatta – romantisches fragment .....
- Auf den Spuren der Selbstcodierung II: Gudrun Ensslins Briefe
- Auf den Spuren der Selbstcodierung III: Thorwald Prolls Gedichte
- Zusammenfassung und weitere Wege der Selbstcodierung.
- Fazit........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstcodierung der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) in den 1970er Jahren und ihre Auswirkungen auf die Eskalation des Konflikts zwischen der Gruppe und dem Staat. Das Ziel ist es, zu verstehen, wie die Selbstwahrnehmung der RAF eine Konfliktentschärfung verhinderte und letztlich unmöglich machte.
- Die Rolle der Selbstcodierung in der Formation und Abgrenzung der Terroristengemeinschaft
- Die Sprache als Mittel der Selbstcodierung und Selbstperformance der RAF
- Die Entwicklung der Selbstcodierung von einer externen Kommunikation hin zu einer internen, „codierten“ Sprache
- Die Zielgruppe der RAF-Kommunikation und ihre Veränderung im Laufe der Zeit
- Die Auswirkungen der Selbstcodierung auf die Eskalation des Konflikts zwischen der RAF und dem Staat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Selbstbild der RAF im Kontext der Konflikteskalation in den 1970er Jahren. Sie beleuchtet die Abgrenzung der RAF vom Staat und die Überhöhung und Mystifizierung der Gruppe auf beiden Seiten.
- Die Rolle der Selbstcodierung in der Terroristengemeinschaft: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung der Selbstcodierung für die terroristische Gemeinschaft und wie sie die Kommunikation nach außen beeinflusst hat. Es zeigt, wie die RAF ihre Sprache und Kommunikation zunehmend für eine interne Zielgruppe angepasst hat.
- Auf den Spuren der Selbstcodierung I: Geisslers kamalatta – romantisches fragment .....: Dieses Kapitel analysiert den Roman „kamalatta“ von Christian Geissler als ein Beispiel für die Selbstcodierung der RAF. Es untersucht die Sprache und die Themen des Romans im Hinblick auf die Selbstdarstellung und das Selbstverständnis der Gruppe.
- Auf den Spuren der Selbstcodierung II: Gudrun Ensslins Briefe: Dieses Kapitel analysiert die Briefe von Gudrun Ensslin, die ebenfalls als Ausdruck der Selbstcodierung der RAF dienen. Es untersucht die Sprache und die Themen der Briefe im Hinblick auf die Selbstwahrnehmung und die Ziele der Gruppe.
- Auf den Spuren der Selbstcodierung III: Thorwald Prolls Gedichte: Dieses Kapitel analysiert die Gedichte von Thorwald Proll als weitere Quelle für die Selbstcodierung der RAF. Es untersucht die Sprache und die Themen der Gedichte im Hinblick auf die Selbstdarstellung und das Selbstverständnis der Gruppe.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Selbstcodierung, RAF, Terrorismus, Konflikteskalation, Selbstbild, Sprache, Kommunikation, Außenimage, Innenbild, Zielgruppe, „revolutionäre“ Sprache, „Randgruppenstrategie“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist mit der „Selbstcodierung“ der RAF gemeint?
Sie bezeichnet das Selbstverständnis und die sprachliche Selbstdarstellung der Gruppe, die sich eklatant vom Außenbild des Staates unterschied und eine Konfliktentschärfung unmöglich machte.
Welche Rolle spielt die Sprache in der RAF-Gemeinschaft?
Sprache diente als Mittel der Selbstperformance und Heroisierung der Mitglieder, wobei sie sich im Laufe der Zeit zu einer internen, hochgradig codierten Sprache entwickelte.
Welche Quellen werden zur Analyse der Selbstcodierung genutzt?
Analysiert werden unter anderem Christian Geisslers Roman „kamalatta“, Briefe von Gudrun Ensslin und Gedichte von Thorwald Proll.
Warum kam es in den 1970er Jahren zu einer Eskalation?
Die Arbeit zeigt auf, dass die gegenseitige Ausgrenzung und die mystifizierte Wahrnehmung auf beiden Seiten (Staatsparanoia vs. revolutionäre Heroisierung) den Dialog verhinderten.
Wie stärkte die RAF ihr „Wir-Gefühl“?
Durch die Betonung der Differenz zur Umwelt, geteilte Ideale und Feindbilder sowie die bewusste Abgrenzung von der bürgerlichen Gesellschaft.
- Citation du texte
- Anke Biehl (Auteur), 2006, RAF und Popkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87764