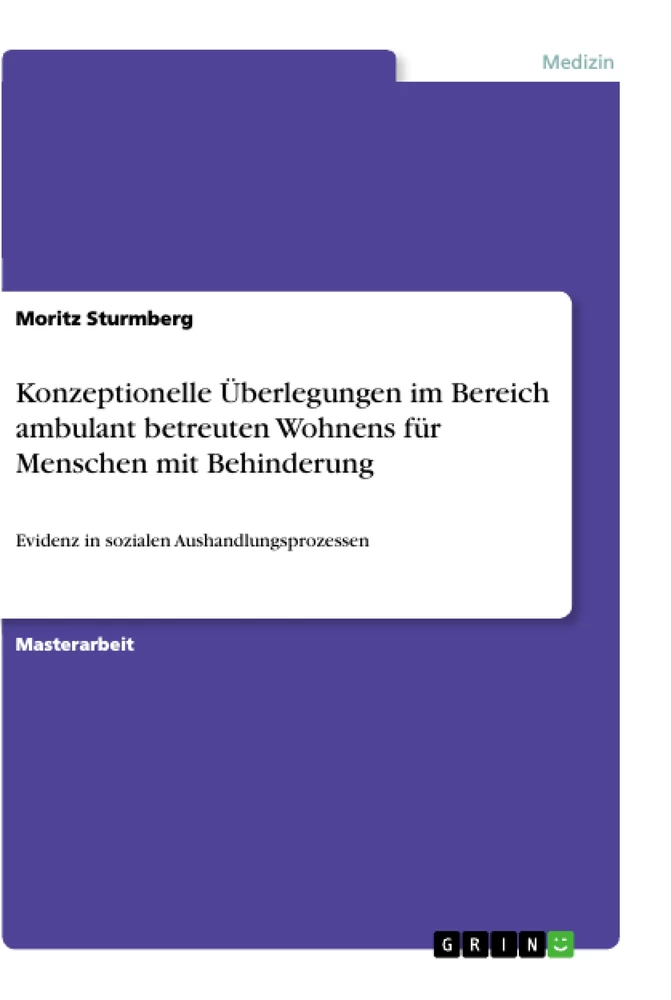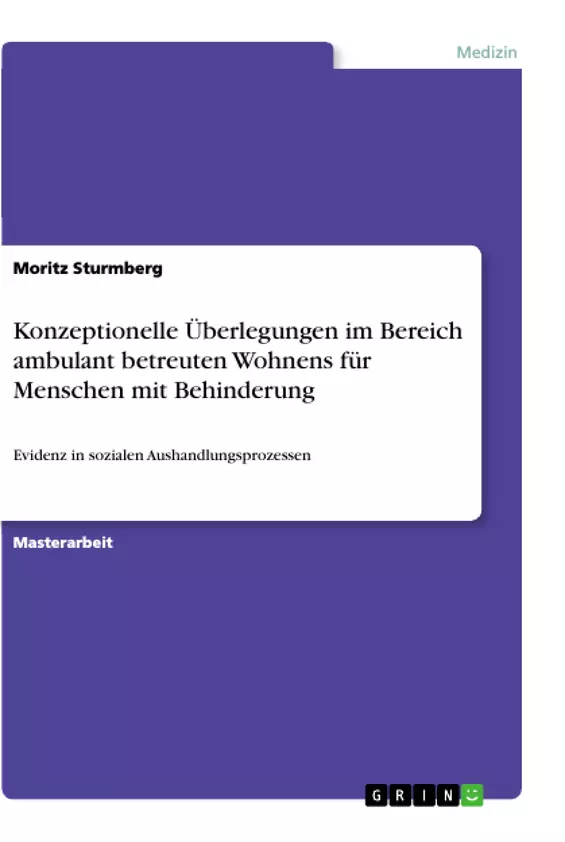Diese Arbeit untersucht, welche Rückschlüsse sich für eine "Evidenzbasierte Praxis" in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ziehen lassen. Es handelt sich bei dieser Arbeit ausdrücklich nicht um ein Konzept evidenzbasierter Praxis. Es besteht der Anspruch, einige relevante Felder für ein Modell eines im Sozialwesen integrierbaren Evidenzbegriffs aufzuzeigen. Somit wird hoffentlich ein kleiner Beitrag zum "sozialen Aushandlungsprozess" evidenzorientierter Leitbilder im Sozialsystem geleistet.
Das neuere Phänomen "Wohlfahrtpluralismus" muss als Balanceakt im Spannungsfeld verschiedener Wertehaltungen und Denkstile betrachtet werden, die innerhalb der professionellen Organisation und Gestaltung gesundheitsbezogener und sozialer Hilfen im Dritten Sektor je eine berechtigte Rolle spielen. Gleichzeitig erwachsen mit der Professionalismuskritik durch die Adressaten auch von "innen" Legitimationsansprüche, was die professionelle Arbeit zum grundsätzlichen Überdenken ihrer Wissensbasis und des Gebrauchswerts ihrer Handlungspraktiken zwingt.
Mithilfe der klinischen Epidemiologie und ihrer naturwissenschaftlich ausgerichteten Wissenskonzeption versteht sich die "Evidenzbasierte Praxis" (EbP) aus der Medizin (EbM) kommend als Anleitungsmodell der gezielten Implementation wissenschaftlichen Wissens und Abwehr gegenüber "eminenzbasierter" Deutungshoheit, Autorität und Tradition. Damit scheint professionelles Handeln begründet, denn „Evidenz“ verspricht, verstanden als "Beweis", die Bereitstellung gültigen wissenschaftlichen Wissens und das Konzept der EbP seine Übertragung in die Praxis.
"Evidenz" erweist sich jedoch als mehrdimensionales Konstrukt. Zunehmend gewinnen Kooperation und Koordination als professionelle Handlungstypen sowie die Verschachtelung informeller und formeller Hilfen als zentrale Qualitätsmerkmale des Sozialsystems an Bedeutung. Des Weiteren kann Forschung als gesellschaftliches System und "gültiges Wissen" als Produkt komplexer sozialer Aushandlungsprozesse um Werte beschrieben werden.
Unterschiedliche Qualitätsurteile und abweichende Präferenzen setzen vereinfachten InputOut-Relationen der Wirkungsforschung deutliche Grenzen. Verschiedene Bedeutungsebenen der Evidenz werden unter Realgegebenheiten vor allem dann deutlich, wenn "Evidenz" mit dem "Evidenten" in ein Passungsverhältnis gebracht werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Wohlfahrtspluralismus im Kontext sozialstaatlicher Umbaumaßnahmen
- 1.1.2 Solidarität
- 1.1 Wohlfahrtspluralismus: Der Dritte Sektor
- 1.1.1 Eine ordnungsschematische Betrachtung: Die Vier-Sektoren-Theorie
- 1.1.3 Interdependenzen und Interpenetrationen
- 1.2 Ökonomisierung und Ökonomismus
- 1.2.1 Effizienz und Effektivität
- 1.2.2 Selbstzweck des Markts
- 1.3 Sozialpolitische Umstrukturierung, Legitimationskrisen und Paradigmenwechsel im professionellen Hilfesystem
- 1.3.1 Umbau des Sozialstaats
- 1.3.2 Soziale Dienste unter Legitimierungsdruck
- 1.3.3 Neuorientierungen in der Heil- und Sonderpädagogik
- 2 Gültiges Wissen, Professionalität und Dienstleistung im Kontext sozialer Aushandlungsprozesse
- 2.1 Die Evidenzdiskussion im Gesundheits- und Sozialwesen
- 2.1.1 Wozu Evidenz?
- 2.1.2 Evidenz und evidence – eine semantische Hürde
- 2.1.3 Das Konzept der Evidenzbasierten Medizin (EbM) nach Sackett et al
- 2.1.4 Die Rezeption der EbM im Gesundheits- und Sozialwesen
- 2.1.5 Die beste verfügbare Evidenz
- 2.1.6 Evidenztypen: Externe, interne und externalisierte lokale Evidenz
- 2.1.7 Evidenz und evidence - ein Annäherungsversuch
- 2.2 Gültiges Wissen und Profession
- 2.2.1 Sozialität der Erkenntnis nach Fleck
- 2.2.2 Konsens, Legitimation und Innovation
- 3.2.3 Professionalität
- 2.2.4 Vom Transfermodell zum Kooperativen Wissensmodell
- 2.2.5 Reflexive Wirkungsorientierung
- 2.3 Personenbezogene Dienstleistung
- 2.3.1 Soziale Dienstleistung und Ko-Produktion
- 2.3.2 Partizipative Entscheidungsfindung in der Evidenzbasierten Medizin
- 2.3.3 Besondere Merkmale eines neueren Dienstleistungsverständnisses
- 2.3.4 Soziale Qualität
- 2.3.5 Qualitätsausschnitt 1: Helferqualität - wer darf helfen?
- 2.3.6 Qualitätsausschnitt 2: Vermittlung zwischen „Evidenz“ und dem „Evidenten“
- 2.3.7 Qualitätsausschnitt 3: Die (vermeintlich) aktive Rolle Professioneller
- 2.1 Die Evidenzdiskussion im Gesundheits- und Sozialwesen
- 3 Implikationen eines Motivs Evidenzbasierter Praxis in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
- 3.1 Erbringungsverhältnis und -kontext sozialer Dienstleistung als Spannungsfelder
- 3.1.1 Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis
- 3.1.2 Hilfe als komplexes Vertragsverhältnis
- 3.1.3 Aspekte der Limitation und Kritik des Dienstleistungsverständnisses
- 3.2 Case Management und Evidenzbasierte Praxis
- 3.3 Evidenz in lebensweltlichen Bezügen
- 3.3.1 Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung
- 3.3.2 Evidenz und Hilfe im Alltäglichen
- 3.3.3 Exkurs: Das Zeitproblem als Technologiedefizit – eine Skizze
- 3.3.4 Fallbeispiel: Konflikte der Vertrauensförderung und Entscheidungsfindung
- 3.4 Weitere Anmerkungen zur Akteurskonzeption im Dienstleistungsprozess
- 3.4.1 Notwendige Bedingungen einer Perspektivenöffnung
- 3.4.2 Entscheidungsfähigkeit als handlungstheoretische Grundlage
- 3.4.3 Der Capability Ansatz aus Sicht einer Befähigungsökonomie
- 3.4.4 Exkurs: Loyalitätsverhältnisse
- 3.5 Erkenntnistheoretische und ethische Perspektiven evidenzbasierter Entscheidungen
- 3.5.1 Drei erkenntnistheoretisch relevante Perspektiven nach Dederich
- 3.5.2 Ethische Entscheidungskriterien nach Schnell
- 3.6 Zur Evidenz des Selbsthilfegedankens
- 3.6.1 Historische Evidenz der Selbsthilfebewegungen in der Behindertenhilfe
- 3.6.2 Selbsthilfeförderung als Stärkung der Adressatenperspektive
- 3.1 Erbringungsverhältnis und -kontext sozialer Dienstleistung als Spannungsfelder
- 4 Fazit
- 5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema „Evidenz“ in sozialen Aushandlungsprozessen im Kontext von ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, die Bedeutung von „Evidenz“ im Rahmen sozialer Dienstleistungen zu beleuchten und die Spannungsfelder zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und lebensweltlichen Bezügen aufzuzeigen.
- Wohlfahrtspluralismus und die Rolle des Dritten Sektors
- Ökonomisierung und Effizienzsteigerung in der Sozialen Arbeit
- Evidenzbasierte Praxis und die Herausforderungen der Implementation in der Behindertenhilfe
- Die Bedeutung von Professionalität und Partizipation im Kontext von sozialer Dienstleistung
- Ethische und erkenntnistheoretische Aspekte evidenzbasierter Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Evidenz“ in sozialen Aushandlungsprozessen ein und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext des aktuellen Sozialstaatsdiskurses. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Wohlfahrtspluralismus und den Herausforderungen der Ökonomisierung im Sozialwesen. Es werden verschiedene Modelle der Wohlfahrtsstaatlichkeit sowie die Bedeutung von „Effizienz“ und „Effektivität“ im Rahmen der Sozialen Arbeit diskutiert. Das zweite Kapitel beleuchtet die Evidenzdebatte im Gesundheits- und Sozialwesen, fokussiert auf das Konzept der Evidenzbasierten Medizin und die Bedeutung von „Gültigem Wissen“ und „Professionalität“ in sozialen Aushandlungsprozessen. Es werden verschiedene Evidenztypen vorgestellt und die Herausforderungen der Implementation von „Evidenz“ in der Praxis diskutiert. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Implikationen eines Motivs Evidenzbasierter Praxis in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Es werden die Besonderheiten des Erbringungsverhältnisses sozialer Dienstleistungen im Kontext der Behindertenhilfe beleuchtet, sowie die Rolle von Case Management und die Bedeutung von lebensweltlichen Bezügen in der Praxis hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Evidenz, Wohlfahrtspluralismus, sozialer Aushandlungsprozess, Evidenzbasierte Praxis, Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe, Professionalität, Partizipation, Dienstleistung, Lebenswelt, Ethische Entscheidungskriterien, Selbsthilfe.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet evidenzbasierte Praxis in der Eingliederungshilfe?
Es ist der Ansatz, pädagogische und soziale Maßnahmen auf gesichertes wissenschaftliches Wissen zu stützen, statt nur auf Tradition oder Erfahrung (Eminenz).
Was ist der "Wohlfahrtspluralismus"?
Ein Modell, bei dem soziale Leistungen durch ein Zusammenspiel von Staat, Markt, Familie und gemeinnützigen Organisationen (Dritter Sektor) erbracht werden.
Welche Rolle spielt Partizipation bei evidenzbasierten Entscheidungen?
Echte Evidenz erfordert die Einbeziehung der Präferenzen der Betroffenen (Menschen mit Behinderung), um eine passgenaue und wirksame Hilfe zu gestalten.
Was ist der "Capability Ansatz"?
Ein Befähigungsmodell, das darauf abzielt, die tatsächlichen Möglichkeiten eines Menschen zu erweitern, ein selbstbestimmtes Leben nach seinen Vorstellungen zu führen.
Wie beeinflusst die Ökonomisierung die Soziale Arbeit?
Sie erhöht den Legitimationsdruck und fordert den Nachweis von Effizienz und Effektivität, was jedoch oft im Spannungsfeld zu individuellen Bedürfnissen steht.
- Citation du texte
- Moritz Sturmberg (Auteur), 2015, Konzeptionelle Überlegungen im Bereich ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/900935