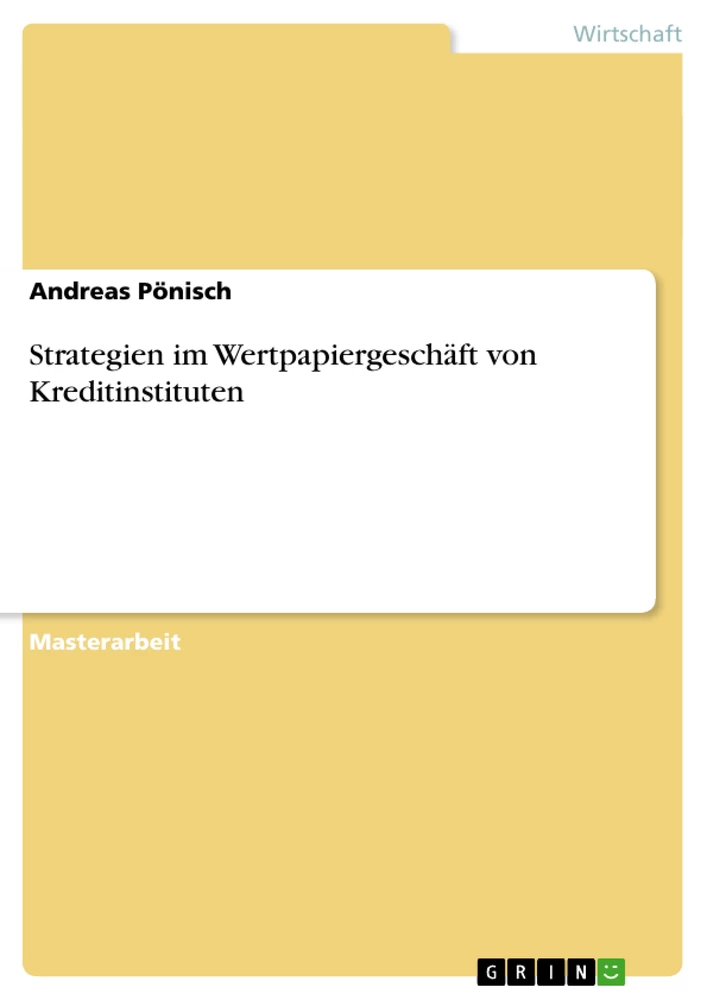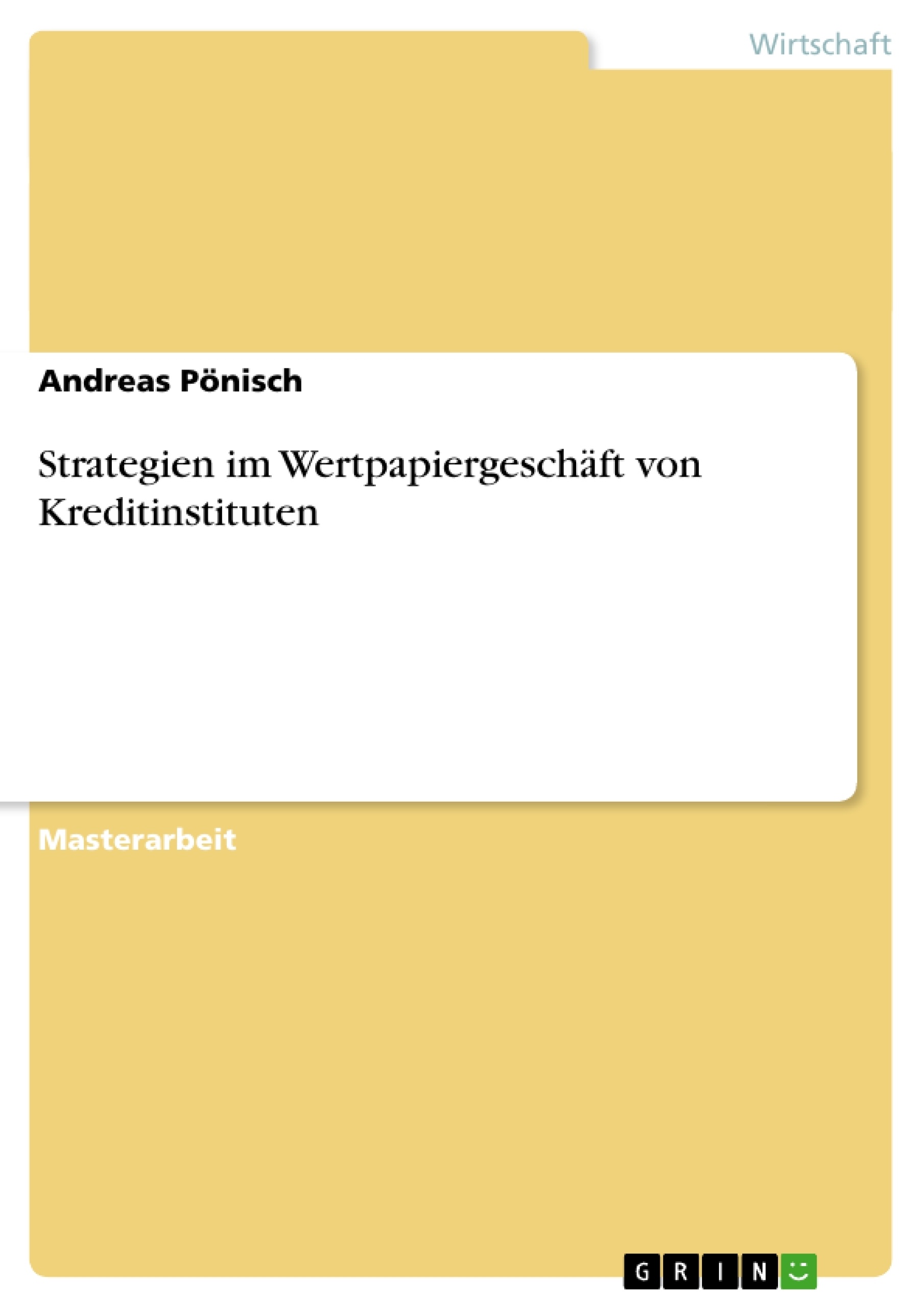Die vorliegende Arbeit soll das Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten aus strategischer
Sicht beleuchten. Dabei wird der Fokus auf deutsche Universalbanken gerichtet.
Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welche konzeptionellen Grundlagen stellt das strategische Management zur
Verfügung?
2. Welche Vorgehensweise ermöglicht eine Analyse des zu untersuchenden Wertpapiergeschäfts
von Kreditinstituten?
3. Welche Wettbewerbsstrategien können von den Kreditinstituten verfolgt werden?
4. Wie können die gewählten Strategien umgesetzt werden?
In diesem Zusammenhang sollen ausgewählte strategische Aspekte aufgegriffen und auf ihre Umsetzbarkeit im Wertpapiergeschäft hin untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einführung in die Thematik
1.1. Problemstellung und Ziel der Arbeit
1.2. Aufbau der Arbeit
1.3. Definitorische Grundlagen
1.3.1. Zum Strategiebegriff
1.3.2. Begriffsbestimmung „Strategisches Management“
1.3.3. Begriffsbestimmung, Wesen und Systematisierung von Kreditinstituten
1.3.4. Begriffsbestimmung „Wertpapiergeschäft“
1.4. Geschichtliche Entwicklung des strategischen Managements
1.5. Entwicklung der Theorie des strategischen Managements
2 Strategische Analyse des Wertpapiergeschäfts von Kreditinstituten
2.1. Die Analyse der Umwelt von Kreditinstituten
2.1.1. Die Analyse der globalen Umwelt
2.1.2. Die Analyse der Branchenstruktur
2.1.3. Die Analyse der Branchendynamik
2.1.4. Die Analyse der strategischen Gruppen
2.1.5. Die Konkurrenzanalyse
2.2. Die Analyse der Ressourcen von Kreditinstituten
2.2.1. Der ressourcenorientierte Ansatz
2.2.2. Die Kernkompetenzenperspektive
2.2.3. Die Metakompetenzenperspektive
2.2.4. Die Wertkette nach Porter
2.2.5. Gegenüberstellung und Verknüpfung des Porterschen Ansatzes und des resource-based view
3 Strategiefindung und -bewertung im Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten
3.1. Strategische Optionen im Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten
3.1.1. Die Strategie der Kostenführerschaft
3.1.2. Die Strategie der Differenzierung
3.1.3. Die Strategie der Nischenbildung
3.1.4. Mischstrategien im Wertpapiergeschäft
3.2. Bewertung und Auswahl von Strategien im Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten
3.2.1. Grundkonzept der Strategiebewertung und -auswahl
3.2.2. Methoden und Modelle der Strategiebewertung
4 Strategieimplementierung im Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten
4.1. Grundprinzipien der Strategieimplementierung
4.2. Umsetzung strategischer Maßnahmen im Rahmen der Strategie- implementierung
4.3. Durchsetzung strategischer Maßnahmen im Rahmen der Strategie-implementierung
4.4. Die Balanced Scorecard als Instrument zur Ableitung von Maßnahmen
5 Handlungsempfehlungen für Kreditinstitute
6 Schlussbemerkung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit
Abbildung 2: Ojekte des strategischen Managements
Abbildung 3: Systematisierung der Subtypen von Universalbanken
Abbildung 4: Übersichten der Universalbankengruppen in Deutschland
Abbildung 5: Entwicklungsphasen des strategischen Denkens in Unternehmen
Abbildung 6: „SWOT-Analyse“
Abbildung 7: Konzeption der Umweltanalyse
Abbildung 8: Segmente der globalen Umwelt
Abbildung 9: Vertriebswege von Banken im Überblick
Abbildung 10: Prozess des Gesetzgebungsverfahrens zur MiFID
Abbildung 11: Die Triebkräfte des Branchenwettbewerbs
Abbildung 12: Übersicht über Markteintrittsbarrieren
Abbildung 13: Konflikteskalation auf den Wettbewerbsarenen
Abbildung 14: Beispiel strategischer Gruppen im deutschen Bankensektor
Abbildung 15: Elemente einer Konkurrenzanalayse
Abbildung 16: Systematik der (distinktiven) Ressourcen
Abbildung 17: Wertkette nach Porter
Abbildung 18: Gegenüberstellung des Porterschen Ansatzes und des resource-based view
Abbildung 19: Typologien möglicher Geschäftsbereichsstrategien
Abbildung 20: Die generellen Wettbewerbsstrategien von Geschäftsbereichen
Abbildung 21: Kundensegmentierungsmodelle
Abbildung 22: Zusammenhang zwischen Rentabilität und Marktanteil nach Porter
Abbildung 23: Kausalkette zwischen Umsatz und Gewinn in einer Fondsgesellschaft
Abbildung 24: Beispiel zur Nutzwertanalyse für das Wertpapiergeschäft eines Kreditinstitutes
Abbildung 25: Bestandteile und Berechnung des Economic Value Added
Abbildung 26: Bestandteile der Bewertungskonzeption
Abbildung 27: Wertbeitragsmatrix nach Peschke
Abbildung 28: Beispiel für die Entscheidungssituation unter Risiko in einem Kreditinstitut
Abbildung 29: Beispiel einer Strategieimplementierung im Wertpapiergeschäft
Abbildung 30: Die Balanced Scorecard am Beispiel des Wertpapiergeschäftes in einem Kreditinstitut
1 Einführung in die Thematik
1.1. Problemstellung und Ziel der Arbeit
In den letzten Jahren vollzog sich ein bis heute andauernder dynamischer Veränderungsprozess in der Bankenlandschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese Entwicklung wird durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren begründet. Davon seien an dieser Stelle nur einige exemplarisch aufgeführt. Einerseits führten die informationstechnischen Fortschritte durch die Verbreitung des Internets zu einer Veränderung der Vertriebswege im Mengengeschäft. In diesem Zusammenhang sei auf die Einführung des Online-Bankings und des Online-Brokerages verwiesen.[1] Andererseits lässt sich ein kritischeres Kundenverhalten beobachten, dass mit einem erhöhten Renditebewusstsein und einer Abkehr vom Hausbankprinzip einhergeht. Darüber hinaus spielen sozio-demografische Entwicklungen eine Rolle, die zu einer Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge sowie zu einem wachsenden Geldvermögen führen. Diese Trends wirken auf eine im europäischen Maßstab stark fragmentierte Bankwirtschaft. In diesem Umfeld sind die deutschen Kreditinstitute aufgefordert, ihre Wettbewerbsposition durch adäquate Strategien zu verbessern. Dazu bietet sich neben dem klassischen Kredit- und Einlagengeschäft das provisionsträchtige Wertpapiergeschäft an. Für diese Untersuchung stellt das strategische Management durch seine markt- bzw. ressourcenbezogenen Sichtweisen den geeigneten Rahmen zur Verfügung.
Die persönliche Motivation des Verfassers leitet sich aus der Bedeutsamkeit der Thematik für die inländischen Universalbanken ab. Im bundesdeutschen Wirtschaftssystem nehmen Kreditinstitute eine herausragende Stellung als Finanzintermediäre ein. Umso wichtiger erscheint die zukünftige Entwicklung dieser Branche. Im Kontext dieser Arbeit sollen die Universalbanken beispielhaft für den in westlichen Industrieländern bereits dominierenden Dienstleistungsbereich untersucht werden.[2] Die eingangs beschriebenen Trends bewirken eine nachhaltige Veränderung in der deutschen Bankenstruktur. Die Fusionen und Konzentrationsprozesse der letzten Jahre belegen eindrucksvoll diese Tendenz. Für die verbliebenen Kreditinstitute stellt sich die Frage, wie in diesem Wettbewerbsumfeld die eigene Marktposition gesichert und ausgebaut werden kann.
Die vorliegende Arbeit soll das Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten aus strategischer Sicht beleuchten. Dabei wird der Fokus auf deutsche Universalbanken gerichtet. Ziel dieser Arbeit ist daher die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welche konzeptionellen Grundlagen stellt das strategische Management zur Verfügung?
2. Welche Vorgehensweise ermöglicht eine Analyse des zu untersuchenden Wertpapiergeschäfts von Kreditinstituten?
3. Welche Wettbewerbsstrategien können von den Kreditinstituten verfolgt werden?
4. Wie können die gewählten Strategien umgesetzt werden?
Ziel ist es zu prüfen, inwieweit das strategische Management einen Beitrag für eine nachhaltige Marktpositionierung von Kreditinstituten im Geschäftsfeld „Wertpapiergeschäft“ in einem sich verschärfenden Wettbewerb erbringen kann. In der Literatur finden sich bereits einige wertvolle Beiträge, welche die Banken in das Zentrum des strategischen Managements stellen. Die anzufertigende Master-Thesis stellt einen Versuch dar, strategische Überlegungen auf das Wertpapiergeschäft von inländischen Universalbanken zu fokussieren. Dabei kann es nicht um eine Übertragung des kompletten strategischen Wissens auf dieses Geschäftsfeld gehen. Vielmehr sollen ausgewählte Aspekte aufgegriffen und auf ihre Umsetzbarkeit im Wertpapiergeschäft hin untersucht werden.
1.2. Aufbau der Arbeit
Nachdem im vorhergehenden Abschnitt die Zielstellung der Arbeit aufgezeigt wurde, soll im Folgenden eine Veranschaulichung der Vorgehensweise und des Aufbaus dargestellt werden.
Das erste Kapitel ermöglicht einen Einstieg in die Thematik. In diesem Zusammenhang sollen die Grundlagen des strategischen Managements vermittelt sowie wichtige Begrifflichkeiten charakterisiert werden. Der zweite Teil widmet sich der strategischen Analyse des zu untersuchenden Geschäftsfeldes. An dieser Stelle sollen markt- und ressourcenbezogene Ansätze in die Betrachtung einbezogen werden. Im daran anschließenden dritten Abschnitt, der gleichsam einen thematischen Schwerpunkt der Arbeit bildet, werden mögliche Strategien untersucht, die zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition im Wertpapiergeschäft führen können. Die Bewertung und Auswahl von Strategiealternativen bildet den Abschluss dieses Kapitels. Der vierte Teil befasst sich mit möglichen Maßnahmen, die eine erfolgreiche Strategieimplementierung sicherstellen. Daraus leiten sich adäquate Handlungsempfehlungen ab, die im fünften Teil dargestellt werden. Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung, die einen Ausblick geben soll. Abbildung 1 verdeutlicht den prozessualen Charakter der Arbeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Aufbau der Arbeit
Quelle: eigene Darstellung
1.3. Definitorische Grundlagen
1.3.1. Zum Strategiebegriff
In der Literatur wird der Strategiebegriff nicht einheitlich charakterisiert. Die verschiedenen Systematisierungen sind auf die unterschiedlichen Vorstellungen der einzelnen Verfasser zurückzuführen. Seinen etymologischen Ursprung leitet der Begriff „Strategie“ von dem altgriechischen Wort „Strataegeo“ ab, welches sich aus den Begrifflichkeiten „Stratos“ (Das Heer) und „Agein“ (Führen) zusammensetzt. Das Wort „Strategos“ stand zunächst für die Funktion des Generals in der griechischen Armee und wurde erst im Zeitverlauf inhaltlich erweitert.[3] Gleiches galt auch für den deutschen Sprachraum, wo der Strategiebegriff auch im Militärwesen, insbesondere von Clausewitz, verwendet wurde. Er beschrieb eine Strategie als „den Gebrauch des Gefechts zum Zweck des Krieges“.[4] [5]
Ausgehend von der militärischen Verwendung des Strategiebegriffs fand dieser, begünstigt durch die Spieltheorie, Eingang in die Wirtschaftswissenschaften. Dort wird eine Strategie als ein vollständiger Plan verstanden, wobei jede Aktion hinsichtlich der eigenen und fremden Spielzüge durchdacht wird.[6] Aufbauend auf diesen Erkenntnissen fand zunächst eine betriebswirtschaftliche Verbreitung an den amerikanischen Hochschulen, vor allem der Harvard Business School, statt. Erste nennenswerte Forschungen erfolgten in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Chandler (1962), Ansoff (1965) und Andrews (1971).[7]
Hinsichtlich des Strategiebegriffs kann zwischen dem klassischen Strategieverständnis und der Gegenströmung in der Schule um Mintzberg unterschieden werden. Die Verfechter der erstgenannten Position definieren Strategie „als ein geplantes Maßnahmenbündel der Unternehmung zur Erreichung ihrer langfristigen Ziele.“[8] Dieses Verständnis wird durch folgende Merkmale charakterisiert:
- Strategien beinhalten eine Anzahl miteinander verbundener Einzelentscheidungen,
- Strategien stellen ein hierarchisches Konstrukt dar,
- Strategien determinieren die Positionierung einer Unternehmung[9],
- Strategien geben Auskunft zur Ressourcenallokation.
Durch die Einhaltung der genannten Kriterien werden Entscheidungen herbeigeführt, die dem Unternehmen Vorteile gegenüber Konkurrenten sichern und somit einen langfristigen Erfolg ermöglichen.[10] [11]
Dagegen kommt Mintzberg zu der Ansicht, dass Strategien nicht zwingend als Folge geplanter rationaler Planungen entstehen. Nach seiner Auffassung besteht ein deutlich weiter gefasstes Universum von Strategietypen in Unternehmen. Damit wird eine eher inkrementale Sichtweise bevorzugt.[12] Zu dieser Erkenntnis gelangt Mintzberg durch eine Reihe von empirischen Studien. Danach werden fünf unterschiedliche Strategieverständnisse abgeleitet:[13]
1. Strategien als Pläne (Plan)
Dieser Typus korrespondiert mit dem bereits erläuterten klassischen Strategieverständnis. Auf Grund der notwendigen stabilen Umweltbedingungen ist dieser Strategietyp eher selten anzutreffen.
2. Strategien als List (Ploy)
Mintzberg charakterisiert Strategien im Sinne einer „Kriegslist“, wonach diese von spontanen Maßnahmen begleitet werden, um die Wettbewerber zu überraschen.
3. Strategien als Muster (Pattern)
Dieser Strategietyp entwickelt sich eher zufällig aus dem Handeln der Unternehmen. Demnach entstehen diese Strategien meist unbeabsichtigt und sind erst im Nachhinein erkennbar, wenn sich ein nachhaltiges Entscheidungsmuster zeigt.
4. Strategien als Positionierungen (Position)
Bei diesem Typ beschränken sich die Strategien meist auf eine Positionierung des Unternehmens zur Umwelt. Ein Wettbewerbsvorteil kann entweder geplant oder zufällig, z.B. durch Fehlentscheidungen der Wettbewerber, erzielt werden.
5. Strategien als Denkhaltung (Perspective)
Danach sind Strategien nur als Philosophie im Management implementiert. Sie werden nicht schriftlich fixiert, sondern schlagen sich lediglich in einem gemeinsamen Verhaltensmuster nieder.[14][15]
Aus diesen Überlegungen ergibt sich ein Grundmuster von Strategietypen. Nach diesem Modell unterscheidet Mintzberg zwischen beabsichtigten und intuitiven Strategien.[16] In dieser Kategorisierung stellen geplante Strategien, die realisiert werden, die Ausnahme dar. Beabsichtigte Strategien, die nicht umgesetzt werden, sind z.B. auf eine unrealistische Einschätzung der Umwelt oder der unternehmenseigenen Ressourcen zurückzuführen. Realisierte Strategien, die nicht kalkuliert waren, entstehen eher zufällig durch die bereits weiter oben erwähnten Verhaltensmuster des Managements. Nach Mintzberg kann sich die Strategietypologie im Zeitablauf verändern. In einer solchen dynamischen Betrachtungsperspektive können diese einen emergenten Charakter erhalten. Derartig modifizierte Strategien werden von der Unternehmensführung rückwirkend zu geplanten Strategien erklärt.[17]
Mintzbergs Argumentation besticht durch seine konzeptionelle Offenheit. Er rückt insbesondere emergente Phänomene in das Blickfeld des Strategieverständnisses. Andererseits offenbart gerade dieser Aspekt eine Reihe von Kritikpunkten. So wird nicht erkennbar, welche emergenten Phänomene nicht betrachtet werden müssen. Zudem besitzen zufällige Strategien keinen Bezug hinsichtlich der Eigenschaften eines strategischen Managements. Es dürfte daher schwierig festzustellen sein, inwieweit emergente Strategien im Wettbewerbskontext stehen oder die Stärken und Schwächen eines Unternehmens berücksichtigen.[18]
Unter Beachtung der diskutierten Ansätze hinsichtlich der strategischen Planbarkeit, kann der Strategiebegriff nur in allgemeiner Form abgegrenzt werden. Danach können Strategien als Maßnahmen zur Sicherung des langfristigen Erfolgs einer Unternehmung definiert werden.[19] Ähnlich charakterisieren auch Welge und Al-Laham den Strategiebegriff, indem sie darunter eine langfristige Maßnahmenkombination eines Unternehmens gegenüber der Umwelt zur Durchsetzung der langfristigen Ziele verstehen. Zudem gehen sie davon aus, dass in der Praxis Strategien eine Kombination aus geplanten und zufälligen Verhaltensweisen darstellen.[20] Abschließend sei auf das Strategieverständnis von Hofer und Schendel verwiesen, wonach eine Strategie Aussagen zu folgenden Bereichen trifft:
- den Tätigkeitsbereich (scope/domain),
- den Unternehmensressourcen (distincitve competence),
- den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens (competitive advantage) sowie
- die Synergieeffekte, die durch strategische Entscheidungen herbeigeführt werden.[21]
1.3.2. Begriffsbestimmung „Strategisches Management“
Das „Strategisches Management“ korrespondiert mit dem bereits erläuteten Strategiebegriff. Durch die Komplexität der strategischen Problematik ergeben sich zwangsläufig umfangreiche Definitionsansätze. Die wissenschaftliche Diskussion zwischen dem klassischen Strategieverständnis und der Gegenposition von Mintzberg wurde exemplarisch aufgeführt. Aus diesem Grund soll der Begriff „Strategisches Management“ in allgemeiner Form definiert werden. Das strategische Management wird als eine Führungsaufgabe verstanden, die einen erheblichen Beitrag für den Unternehmenserfolg leistet.[22] Der Begriff „Führung“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert.[23] Das strategische Management hat das Ziel, die Marktstellung des Unternehmens sowie die Ressourcenbasis so zu gestalten, dass das Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten erzielen kann. Ein derartiger Vorteil ist dann gegeben, wenn ein Unternehmen den Nachfragern einen wahrnehmbaren und dauerhaften Nutzenvorteil gegenüber den Konkurrenten anbieten kann.[24] Dies geschieht unter Einbeziehung des Unternehmensumfeldes (Chancen/Bedrohungen) sowie einer internen Analyse (Stärken/Schwächen).[25] Zu den Objekten des strategischen Managements gehören Strategien, Strukturen und Systeme. Mittels einer Strategie wird die Richtung der Unternehmensentwicklung manifestiert. Dagegen stellen Strukturen und Systeme die wesentlichen Instrumente dar, um die Mitarbeiter auf das vorgegebene strategische Ziel zu fokussieren (vgl. Abb. 2). Der idealtypische Verlauf des strategischen Managements unterteilt sich in die Schritte Analyse, Formulierung und Auswahl sowie Implementierung. Weiterhin erstrecken sich die Aufgaben des strategischen Managements auf zwei Ebenen. Zum einen wird die Gesamtunternehmensebene fokussiert, zum anderen die Geschäftsfeldebene.[26] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die prozessuale Vorgehensweise auf der Geschäftsfeldebene angewendet werden. Abschließend sei eine allgemeine Definitionsformulierung von Knaese angeführt, die das strategische Management als eine aktive, bewusste Steuerung, Koordination und Kontrolle der langfristigen Entwicklung von Unternehmen unter Einbeziehung externer Umweltfaktoren und interner Unternehmensprozesse und -strukturen interpretiert.[27]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Objekte des strategischen Managements
Quelle: In Anlehnung an Hungenberg, H. (2000), S. 7.
1.3.3. Begriffsbestimmung, Wesen und Systematisierung von Kreditinstituten
„§1 Abs. 1 KWG definiert Kreditinstitute als Unternehmen, die Bankgeschäfte betreiben, sofern der Umfang dieser Geschäfte einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.“[28] Das KWG versteht unter Bankgeschäften z.B. Depot-, Einlagen-, Kredit-, Diskont-, Giro- und Effektengeschäfte.[29] Damit stellt der Terminus „Kreditinstitut“ den Oberbegriff für alle Unternehmen der verschiedenen Gruppen des deutschen Bankwesens dar, die mindestens eines der oben genannten Bankgeschäfte betreiben.[30] [31]
Diese Charakterisierung impliziert, dass auch Universalbanken in diesem Kontext eingeordnet werden können. Im weitesten Sinne zeichnet sich eine Universalbank dadurch aus, dass sie bei der Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit keinen Begrenzungen hinsichtlich quantitativer, regionaler, kundenbezogener, branchenmäßiger noch qualitativ-sachlicher Art unterliegt.[32] Im Rahmen dieser Arbeit soll der Universalbankbegriff verwendet werden, der dem historisch gewachsenen Begriffsverständnis folgt.[33] Danach sind Universalbanken solche Institute, die einerseits das Einlagen- und Kreditgeschäft, andererseits das Wertpapiergeschäft betreiben. Die Abgrenzung dieser Begrifflichkeiten beruht auf der historisch unterschiedlichen Entwicklung von kontinental-europäischen und angelsächsischen Banken. Bei den letztgenannten Instituten durfte das Einlagen- und Kreditgeschäft ausschließlich von sog. „commercial banks“ durchgeführt werden. Das Wertpapiergeschäft eröffnete sich lediglich den sog. „investment banks“. Somit war eine Verknüpfung beider Geschäftsfelder nicht vorgesehen. Aus diesem Grund werden als Universalbanken die Banken bezeichnet, die gleichermaßen commercial banking und investment banking betreiben.[34]
Darüber hinaus differenziert Börner zwischen dem „universalen Bankkonzern“ und der „integrierten Universalbank“. Unter dem erstgenannten Begriff werden die Unternehmensverbünde subsumiert, die commerical banking und investment banking betreiben, deren Mutterunternehmen aber keinen Universalbankcharakter besitzt. Unter einer „integrierten Universalbank“ versteht Börner die „klassische“ Universalbank, die alle Bankgeschäfte in einer juristischen Einheit bündelt.[35] In Anlehnung an Hahn systematisiert Börner die verschiedenen Untertypen von Universalbanken (vgl. Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Systematisierung der Subtypen von Universalbanken
Quelle: In Anlehnung an Börner, Ch. (2000), S. 182. und Hahn, O. (1981), S. 18.
An dieser Stelle sei eine genauere Betrachtung der Struktur der deutschen Universalbanken angebracht, da diese in den folgenden Kapiteln hinsichtlich strategischer Aspekte untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollen die wesentlichen Bankengruppen charakterisiert werden. Unter einer Bankengruppe wird die Gesamtheit der Universalbanken subsumiert, die über gemeinsame Eigenschaften verfügen, wodurch diese von den übrigen Bankengruppen abgegrenzt werden kann.[38]
Hinsichtlich einer Kategorisierung der Bankengruppen wird meist die Formalzielkonzeption angewendet. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Gruppen hinsichtlich betrieblicher und marktlicher Merkmale unterscheiden. Konkret können drei Universalbankgruppen entsprechend ihrer Formalzielkonzeption abgegrenzt werden:
- erwerbswirtschaftliche Universalbanken
- förderwirtschaftliche Universalbanken
- Universalbanken mit öffentlichen Auftrag[39]
Eine genaue Darstellung der genannten Bankengruppen ergibt sich in Abb. 4.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Übersicht der Universalbankengruppen in Deutschland
Quelle: Börner, Ch. (2000), S. 190.
1.3.4. Begriffsbestimmung „Wertpapiergeschäft“
Als Synonym für das „Effektengeschäft“ wird oftmals der Begriff „Wertpapiergeschäft“ verwendet. Das Effektengeschäft der Banken umfasst die Emission, den An- und Verkauf von Effekten für eigene und fremde Rechnung und die Aufbewahrung (Depotgeschäft) sowie Verwaltung von Effekten (Einlösung von Zins- und Gewinnscheinen). Effekten stellen den Oberbegriff für Kapitalwertpapiere, die neben Forderungs- oder Anteilsrechten einen Anspruch auf dauernde Erträge verbriefen und „vertretbar“ oder „fungibel“ sind. Zu den Wertpapieren gehören u. a. Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Anleihen und Investmentfondsanteile. Banknoten, Schecks und Wechsel stellen keine Effekten dar.[40] Von besonderem Interesse für diese Arbeit ist das Wertpapiergeschäft mit privaten Mengen- und Individualkunden. Eine genauere Abgrenzung
wird im Kapitel 2 vorgenommen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll der Begriff Wertpapiergeschäft synonym für das Effektengeschäft verwendet werden.
Nachdem in den bisherigen Abschnitten die wesentlichen Begrifflichkeiten definiert wurden, soll im folgenden Abschnitt die geschichtliche Entwicklung des strategischen Managements skizziert werden.
1.4. Geschichtliche Entwicklung des strategischen Managements
Bei der Entwicklung des strategischen Denkens von der Finanzplanung bis hin zum strategischen Management werden im Allgemeinen fünf Phasen unterschieden.[41]
Finanzplanung
Die ersten nennenswerten Ansätze eines systematischen Denkens im Unternehmenskontext erfolgten in der Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1950er Jahre. Diese Zeit war durch ein solides Wirtschaftswachstum und ein weitgehend stabiles Umfeld geprägt. Die Unternehmensführung fokussierte sich darauf, finanzielle Größen zu planen. Dabei stand die Finanzplanung im Zentrum der planerischen Überlegungen. Als Resultat derartiger Planungstätigkeiten wurden sog. Budgets festgelegt, die die geplanten finanziellen Größen für die nächste Planungsperiode, meist nicht länger als ein Jahr, umfassten. Die Budgetierung diente ebenfalls als Basis für die Kontrolle.[42]
Die Finanzplanung stieß im Zuge sich dynamisch verändernder Umweltbedingungen an ihre Grenzen.
Langfristplanung
Seit Mitte der 1950er Jahre sahen sich die Unternehmen immer höheren Wachstumsraten und einem sich verändernden Nachfragerverhalten gegenüber. Die Unternehmen erkannten, dass ein derartiges Umfeld einen längeren Planungshorizont erforderte. Als Folge wurden Langfristplanungen eingeführt, die in der Regel einen Zeitraum von fünf Jahren abdeckten. Die eingeschlagene Vorgehensweise konzentrierte sich weiterhin auf die Planung von Budgets, die nur teilweise mit ersten Ziel- und Maßnahmenplanungen verbunden wurden. Somit entwickelte sich eine mehrjährige Budgetierung, die sich durch die Fortschreibung vergangener Entwicklungstendenzen in die Zukunft auszeichnete.[43] Aus der nach innen gerichteten Planung in der Phase der Finanzplanung entstand eine zunehmende Berücksichtigung der Unternehmensumwelt. Zum wesentlichen Instrument der Langfristplanung entwickelten sich die Trendextrapolation und andere Verfahren zur Ableitung langfristiger Prognosen, die zur Begründung strategischen Entscheidungen hinzugezogen wurden.[44]
Strategische Planung
Zunehmende Instabilitäten, plötzliche Umbrüche, Konjunkturschwankungen und entscheidende technologische Veränderungen führten ab den 1970er Jahren dazu, dass eine Fortschreibung bisheriger Trends nicht mehr ausreichte. Vielmehr gelangten die Unternehmen zu der Erkenntnis, dass eine systematische Umweltanalyse die Basis bildete, um zukünftige Chancen und Risiken zu identifizieren. Insbesondere die Märkte wurden zum Ziel umfangreicher Analyseprozesse. Für die erfolgreiche Umwandlung der gewonnen Erkenntnisse in Nutzenpotentiale mussten adäquate Fähigkeiten im Unternehmen entwickelt werden. Aus diesem Grund wurde die Umweltanalyse um eine unternehmensinterne Potentialanalyse zur Identifizierung von unternehmensspezifischen Stärken und Schwächen erweitert. In diesem Zusammenhang erwiesen sich die Portfolio-Analyse sowie die Szenario-Technik als wirkungsvolle Instrumente.[45] Als Ergebnis dieses Veränderungsprozesses entwickelte sich die Planung vorwiegend finanzieller Größen zu einer unternehmensweiten Ziel- und Maßnahmenplanung.[46]
Strategisches Management
In den 1980er Jahren gelangten die Unternehmen zu der Erkenntnis, dass eine durchdachte Strategie noch keine Gewähr für deren Verwirklichung darstellt. Neben der Strategieformulierung und -auswahl wurde die Strategieimplementierung als essentieller Erfolgsfaktor identifiziert. Im Zentrum des strategischen Managements steht die Abstimmung („Fit“) zwischen unternehmensexternen und -internen Einflussfaktoren. Vorraussetzung hierfür ist eine umfangreichere Umweltanalyse, die nicht nur ökonomische, politisch-rechtliche und technologische Einflussgrößen, sondern auch sozio-kulturelle und ökologische Aspekte in die Betrachtung einbezieht. In diesem Kontext wurde die Unternehmensumwelt nicht mehr als hinzunehmende fixe Größe aufgefasst, sondern vielmehr als von der Unternehmensführung veränderbar und gestaltbar wahrgenommen.[47] Weiterhin erhielt die Gestaltung und Koordination von Organisationsstrukturen und Führungssubsystemen, aber auch die Unternehmenskultur und das Personalmanagement eine eigene strategische Relevanz. Auf diese Weise entwickelte sich die strategische Planung zum strategischen Management.[48]
Als Geburtsstunde des strategischen Managements als eigenständiges Forschungsgebiet gelten die 1960 Jahre, die durch die Ansätze von Chandler (1962), Ansoff (1965) und Andrews (1971) geprägt wurden. Einen weiteren Schritt stellt der Ansatz des Kernkompetenzmanagements dar, der in den 1990er Jahren von Hamel und Prahalad entwickelt wurde. Dieser Ansatz richtet seinen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation, die Modernisierung der verwendeten Technik, die Verbesserung der Organisation usw.[49] Abbildung 5 gibt einen Überblick über die einzelnen Entwicklungs- phasen des strategischen Denkens in Unternehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Entwicklungsphasen des strategischen Denkens in Unternehmen
Quelle: Hungenberg, H. (2000), S. 45. in Anlehnung an Henzler, H. (1988), S. 1289.
1.5. Entwicklung der Theorie des strategischen Managements
Das strategische Management stellt eine vergleichsweise junge wissenschaftliche Disziplin dar. Als eigenständiges akademisches Forschungsgebiet etablierte es sich erst in den 1960er Jahren. Daher soll die Darstellung der theoretischen Entwicklungsgeschichte des strategischen Managements hier beginnen.[50]
Dennoch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass im Vorfeld bereits einige Ansätze existierten, die das Management auf Betriebsebene oder für den Verwaltungsbereich thematisierten. Als Vertreter auf der Fabrikebene sei Taylor genannt, der durch die Gestaltung von Arbeitsabläufen die Arbeitsproduktivität in der industriellen Fertigung zu optimieren suchte. Die Untersuchungen des administrativen Bereichs durch Barnard, Simon und Selznick stellten ebenfalls vorrangig Aspekte des operativen Managements in das Zentrum der Forschung. Der langfristige Unternehmenserfolg wurde eher beiläufig betrachtet.[51] Die dynamischen Umfeldveränderungen in den 1950er und 1960er Jahren bereiteten den Boden für neue theoretische Denkweisen.
An dieser Stelle wären vor allem die Werke „Strategy and Structure“ von Chandler (1962), „Corporate Strategy“ von Ansoff (1965) sowie „The Concept of Corporate Strategy“ von Andrews (1972) zu nennen.[52] Diese Meilensteine des strategischen Managements behandeln wesentliche Fragen, die bis heute auf diesem Forschungsgebiet thematisiert werden.
Anhand von zahlreichen Analysen amerikanischer Unternehmen wies Chandler nach, dass sich die Organisationsstruktur der Unternehmensstrategie anpasst („structure follows strategy“). Mit dieser Erkenntnis wurde erstmals der Zusammenhang zwischen Strategie und Struktur verdeutlicht.[53]
Andrews vertiefte den Ansatz Chandlers dahingehend, dass für die Strategieentwicklung die Unternehmensumwelt, aber auch die unternehmensspezifischen Kompetenzen betrachtet werden mussten. Damit standen einerseits die externe Analyse von Veränderungen der Umwelt und andererseits die interne Analyse der Stärken und Schwächen von Unternehmen im Zentrum der Untersuchung.[54] Dieser Ansatz ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da hier der Grundgedanke des strategischen Managements auf die Geschäftsfeldebene bezogen wird (siehe Kapitel 2).
Auf der Unternehmensebene legte Ansoff den Grundstein für das strategische Management. Die Ergebnisse seiner Forschungen bildeten die Basis für die so genannte Ansoff-Matrix, welche die Möglichkeiten zur Veränderung des Produkt-Markt-Portfolios von Unternehmen systematisch darstellt. Daneben untersuchte er die Entstehung von Wettbewerbsvorteilen und inwieweit Synergieeffekte von Unternehmen genutzt werden können. Ansoff beschäftigte sich auch mit der Frage, bis zu welchen Grad ein Unternehmen eine vertikale Integration anstreben sollte.[55]
Obwohl durch diese Forschungen das theoretische Fundament für das strategische Management gelegt wurde, kamen diese zunächst nicht zur praktischen Anwendung. Erst in den 1970er Jahren wurde mit der Entwicklung des Erfahrungskurvenkonzepts[56] und des Marktwachstums-Marktanteils-Portfolios durch die Boston Consulting Group (BCG) eine praktische Anwendung dieser konzeptionellen Grundlagen ermöglicht. Damit wurde eine eindeutige Abgrenzung des operativen und strategischen Managements vollzogen.[57]
Eine empirische Basis für das noch junge Forschungsbiet wurde mit dem 1972 ins Leben gerufenen PIMS-Projekt erbracht, welches die verschiedenen strategischen Erfolgsfaktoren auf Unternehmens- und Geschäftsfeldebene untersuchte.[58]
Während dieser Zeit entwickelte sich ein völlig neuer Denkansatz, der das bisherige „Planungsmodell“ kritisierte. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Denkrichtung zählen Mintzberg und Quinn, die auf der Basis der Ansätze von Lindblom die so genannten „Inkrementalmodelle“ entwickelten. Im Gegensatz zum „Planungsmodell“ gehen die Vertreter dieses neuen Ansatzes davon aus, dass Strategieprozesse eher zufällig, unregelmäßig und dezentral entstehen. Damit stellen die Vertreter dieser Denkrichtung die grundsätzliche Strategieplanung in Frage. In Folge dessen rückte der Anpassungs- und Veränderungsprozess von Unternehmen in das Zentrum der Forschung.[59] [60]
Ein weiterer Meilenstein stellt die Weiterentwicklung des strategischen Managements durch Porter zu Beginn der 1980er Jahre dar. Porter verknüpfte theoretische Ansätze der Industrieökonomik mit strategisch relevanten Fragen.[61]
Diese spezielle Richtung der Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich insbesondere mit der Fragestellung, wann ein Wettbewerb innerhalb einer Branche funktionsfähig ist. In diesem Zusammenhang stellen die Forschungen von Mason und Bain eine wichtige Basis dar, die bereits in den 1940er Jahren das so genannte „Structure-Conduct-Performance“-Paradigma (SCP-Paradigma) entwickelten. Danach ist der Erfolg eines Unternehmens (Performance) maßgeblich von der Attraktivität der Branchenstruktur (Structure) und vom Verhalten des Unternehmens in dieser Branche (Conduct) abhängig.[62] [63] In diesem Zusammenhang lokalisierte Bain folgende Quellen von Wettbewerbsvorteilen: absolute Kostenvorteile, Economies of Scale, Kapitalintensität und Produktdifferenzierung.[64]
Aufbauend auf dieser wissenschaftlichen Grundlage entwickelte Porter das viel beachtete Konzept der „fünf Wettbewerbskräfte“. Porters Ansatz gründet sich darauf, dass die Branchenattraktivität durch die Wettbewerbskräfte - Verhandlungsmacht der Abnehmer, Verhandlungsstärke der Lieferanten, Bedrohung durch Substitutionsprodukte, Bedrohung durch potentielle Konkurrenten und den brancheninternen Wettbewerb - determiniert wird. Danach verliert eine Branche mit zunehmender Bedrohung durch die erwähnten Wettbewerbskräfte an Attraktivität, da ein Wettbewerbsvorteil nur unter erhöhten Schwierigkeiten erzielt werden kann.[65] Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen:
1. Unternehmen sollten in attraktiven Branchen tätig sein.
2. Die Positionierung innerhalb der Branche sollte so gewählt werden, dass die fünf Wettbewerbskräfte nur eine geringe Bedrohung darstellen.[66]
Zudem komprimierte Porter die vier weiter oben genannten Wettbewerbsvorteile nach Bain auf die zwei „generischen“ Strategiealternativen Kostenführerschaft und Differenzierung.[67]
Porters Theorien gelten als Geburtsstunde des marktorientierten Ansatzes. In den folgenden Jahren wurden diese Arbeiten insbesondere durch spieltheoretische Einflüsse ergänzt und weiterentwickelt.
Auch wenn Porters-Ansätze einen entscheidenden Fortschritt innerhalb des strategischen Managements darstellen, so bleiben sie in zahlreichen Aspekten zu einseitig. So erklärt er den langfristigen Unternehmenserfolg vor allem durch Unterschiede in der Branchenstruktur. Im Gegensatz dazu hatte bereits Andrews darauf aufmerksam gemacht, dass neben den Chancen und Risiken der Märkte, auch Stärken und Schwächen eines Unternehmens bedeutsam sind.[68]
Seit Mitte der 1980er Jahre setzte als Gegenposition zu Porter, aber auch als Ergänzung des marktorientierten Ansatzes, eine Fokussierung auf die unternehmensspezifischen Ressourcen ein. Der Begriff des „resource-based-view“ wurde erstmals durch Wernefelt geprägt.[69] Eine besondere Aufmerksamkeit erreichte der ressourcenorientierte Ansatz durch die Forschungen von Prahalad und Hamel, die aufbauend auf dem Kernkompetenzenansatz eine umfassende Managementkonzeption entwarfen.[70]
Die Vertreter dieses Ansatzes gehen davon aus, dass sich der Unternehmenserfolg auf eine einzigartige Ressourcenausstattung gründet, die als Ergebnis der historischen Entwicklung eines Unternehmens entsteht. Die Einzigartigkeit dieser Ressourcen stellt die Voraussetzung für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil dar. Insbesondere intangible Vermögenswerte, wie z.B. Know-how, Markenname, Patente sowie organisatorische Fähigkeiten können zu Wettbewerbsvorteilen führen, da diese wegen ihrer komplexen Struktur nur schwer imitierbar sind.[71] Der Erwerb und Erhalt von überlegenen Ressourcen gilt als eine essentielle Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Durch Informationsasymmetrien und Marktunvollkommenheiten können derartige Ressourcen erst entstehen bzw. erhalten werden.[72]
Zur Entwicklung des ressourcenorientierten Ansatzes haben aus ökonomischer Sicht insbesondere die Vertreter der „Neuen Institutionenökonomie“ beigetragen. Zu nennen wäre hier vor allem Williamson.[73] So erklären die Transaktionskostentheorie, die Principal-Agent-Theorie und die Property-Rights-Theorie wie unterschiedliche Ressourcen erworben bzw. erhalten werden können. Nachdem zunächst versucht wurde mittels empirischer Befunde die Überlegenheit des markt- bzw. des ressourcenorientierten Ansatzes nachzuweisen, gelten heute beide Ansätze als weitgehend komplementär und bilden gleichsam ein Fundament für weitere Forschungen des strategischen Managements.[74]
Seit Mitte der 1990er Jahre lässt sich eine Dynamisierung des strategischen Managements feststellen. Diese Entwicklung lässt sich durch den starken Wandel begründen, dem die Unternehmen ausgesetzt sind. Dieser Prozess kann auch als Kritik an den als zu statisch empfunden markt- und ressourcenorientierten Theorien betrachtet werden. Im Zuge dieser Entwicklung wurden einige wertvolle Ansätze entwickelt, die sich beispielsweise mit „dynamischen Fähigkeiten“ von Unternehmen, dem organisationalen Lernen sowie dem Wissensmanagement auseinandersetzen. Dennoch konnte bisher keine umfassende dynamische Theorie des strategischen Managements entwickelt werden.[75]
Daneben etablierte sich seit Beginn der 1990er Jahre ein Forschungsgebiet, das Bestandteile der Finanzierungstheorie integriert und sich mit Aspekten der Bewertung von strategischen Entscheidungen befasst. Diese Forschungen sind insbesondere im Kontext der stärker werdenden Shareholder-Value-Orientierung zu sehen.[76]
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Anzahl an theoretischen Ansätzen des strategischen Managements innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte eine erhebliche Bandbreite erreicht hat. Diese Vielfalt erweist sich vorteilhaft, wenn es darum geht, möglichst zahlreiche Aspekte im Rahmen des strategischen Managements zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite kann sie sich aber auch als hinderlich erweisen, da die Gefahr der „Paralyse durch Analyse“[77] besteht. Schließlich benötigen Unternehmen handhabbare Instrumente, um in komplexen Entscheidungssituationen Wettbewerbsvorteile generieren zu können.[78]
[...]
[1] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 1.
[2] Vgl. Knaese, B. (1996), S.2.
[3] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S.12.
[4] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 4.
[5] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 15.
[6] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 12.
[7] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 4.
[8] Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 13.
[9] An dieser Stelle sei auf das SWOT-Modell verwiesen, welches Stärken und Schwächen einer Unternehmung sowie Chancen und Risiken der Umwelt einbezieht.
[10] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 13 ff.
[11] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 4 ff.
[12] Vgl. Mintzberg, H. (1995), S. 36 ff. und S. 113 ff.
[13] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 16 ff.
[14] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 16-17. Vgl. Mintzberg, H. (1995), S. 36 ff. und S. 113 ff.
[15] Vgl. Barney, J. (1996), S. 18, zit. nach Börner, Ch. (2000), S. 18.
[16] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 17. Vgl. Mintzberg, H. (1995), S. 29 ff.
[17] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 17.
[18] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 18.
[19] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 17.
[20] Vgl. Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 19.
[21] Vgl. Hofer, C.W. / Schendel, D. (1978), S. 23. zit. nach Welge, M. / Al-Laham, A. (2001), S. 19.
[22] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 16.
[23] Vgl. Vgl. Knaese, B. (1996), S. 5. Vgl. Macharzina, K. (1993), S. 34 f.
[24] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 19..
[25] Vgl. Ansoff, H. I. (1980), S. 131-148. zit. nach Knaese, B. (1996), S. 5.
[26] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 16.
[27] Vgl. Knaese, B. (1996), S. 5.
[28] KWG, § 1, Abs. 1.
[29] Vgl. KWG, § 1, Abs. 1.
[30] Vgl. Büschgen, H.E. (1998), S. 11.
[31] Vgl. Knaese, B. (1996), S. 48.
[32] Vgl. Büschgen, H.E. (1998), S. 69.
[33] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 180 f.
[34] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 181.
[35] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 181.
[36] Unter retail banks werden die Universalbanken verstanden, die ein breit ausgerichtetes Geschäft für Privatkunden, Selbständige und Kleinfirmen mit standardisierten Produkten und Dienstleistungen betreiben. Vgl. Wicki , L. (1996), S. 34. zit. nach Börner, Ch. (2000), S. 183.
[37] Unter wholesale banks werden die Universalbanken verstanden, die über private und gewerbliche Individualkunden sowie institutionelle Kunden verfügen. Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 182.
[38] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 189.
[39] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 190.
[40] Vgl. Landesbank Berlin (2006)
[41] Vgl. Pfau, W. (2001), S. 4.
[42] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 44 f.
[43] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 46.
[44] Vgl. Pfau, W. (2001), S. 4.
[45] Vgl. Pfau, W. (2001), S. 5.
[46] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 46 f.
[47] Vgl. Pfau, W. (2001), S. 5.
[48] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 47.
[49] Vgl. Strohhecker, J. (2002a), S. 17 ff.
[50] Eine umfassende Darstellung und Würdigung der zahlreichen theoretischen Ansätze finden sich z.B. bei Knyphausen, Bresser und Mintzberg; Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. (1995); Vgl. Bresser, R. (1998); Vgl. Mintzberg, H. (1990).
[51] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 51.
[52] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 52.
[53] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 52.
[54] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 52.
[55] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 52.
[56] Durch Erfahrungskurveneffekte wird der Umstand beschrieben, dass bei steigender Erfahrung, die Stückkosten um einen bestimmten Prozentsatz sinken.
[57] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 53.
[58] PIMS steht für „Profit Impact of Market Strategies“; Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. 2000), S. 44.
[59] Vgl. Lindblom, C. (1969), S. 41 ff. zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 54
[60] Vgl. Mintzberg, H. / Waters, J. (1978), S. 934. ff. zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 54.
[61] Vgl. Porter, M. (1980) und Porter, M. (1985) zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 54.
[62] Vgl. Mason, E. (1939), S. 61 ff. zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 54.
[63] Vgl. Bain, J. (1968) zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 54.
[64] Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 42.
[65] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 52.; Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 54 ff.
[66] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 55.
[67] Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 42.
[68] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 55.
[69] Vgl. Wernefelt, B. (1984), S. 171 ff. zit. nach Hungenberg, H. (2000), S. 55.
[70] Vgl. Börner, Ch. (2000), S. 102.
[71] Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 48.
[72] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 56.
[73] Vgl. Williamson, O. (1991), S. 75 ff. zit. nach Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 50.
[74] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 56.
[75] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 57.
[76] Vgl. Hungenberg, H. (2000), S. 57.
[77] Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 59.
[78] Vgl. Knyphausen-Aufseß, D. (2000), S. 59.
Häufig gestellte Fragen
Welche Trends beeinflussen das Wertpapiergeschäft der Banken?
Wichtige Trends sind die Digitalisierung (Online-Brokerage), ein erhöhtes Renditebewusstsein der Kunden sowie sozio-demografische Entwicklungen, die private Altersvorsorge nötig machen.
Welche Wettbewerbsstrategien können Kreditinstitute verfolgen?
Banken können auf Kostenführerschaft (z.B. Direktbanken), Differenzierung durch Beratung oder auf Nischenbildung in speziellen Marktsegmenten setzen.
Was ist der Zweck einer SWOT-Analyse im Bankensektor?
Sie dient der strategischen Analyse der internen Ressourcen sowie der externen Umwelt (Chancen und Risiken), um die Marktpositionierung zu optimieren.
Wie hilft die Balanced Scorecard bei der Strategieumsetzung?
Die Balanced Scorecard übersetzt strategische Ziele in konkrete Kennzahlen und Maßnahmen aus verschiedenen Perspektiven (z.B. Finanzen, Kunden, Prozesse).
Was ist der ressourcenorientierte Ansatz (Resource-based view)?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Wettbewerbsvorteil einer Bank auf ihren einzigartigen internen Ressourcen und Kernkompetenzen basiert.
- Quote paper
- Andreas Pönisch (Author), 2007, Strategien im Wertpapiergeschäft von Kreditinstituten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91001