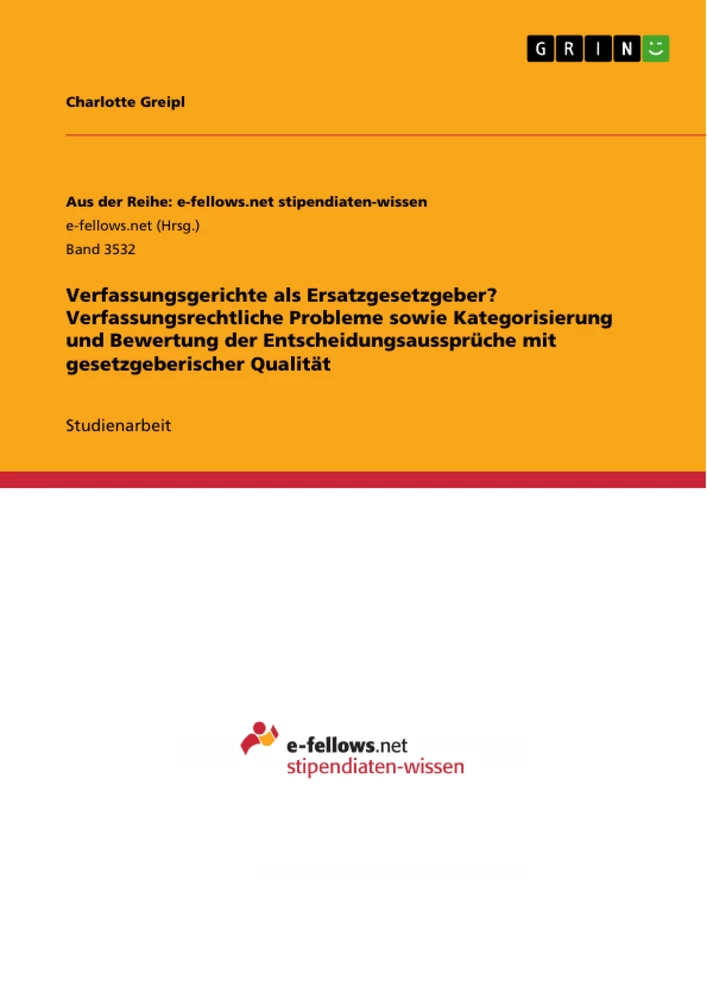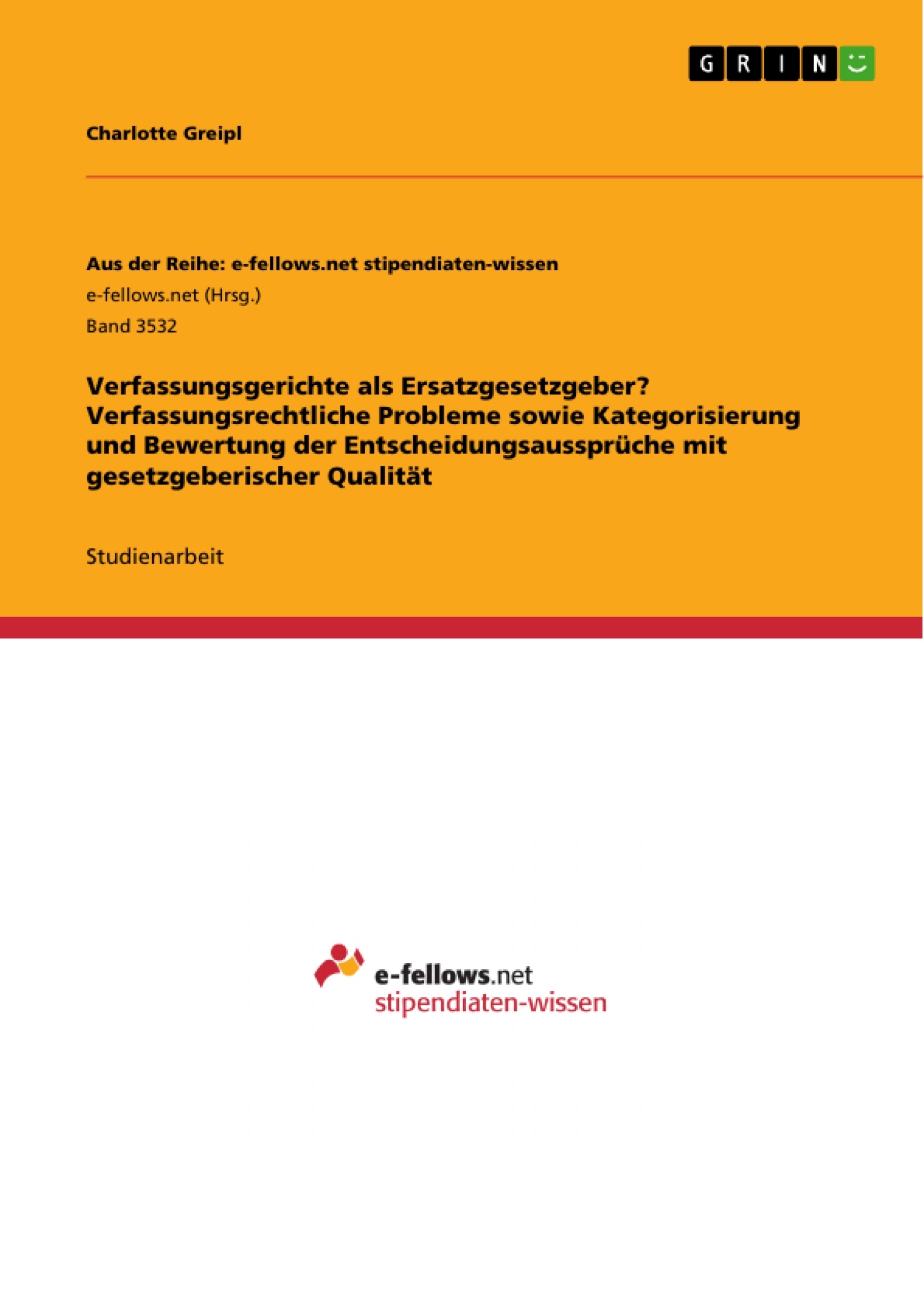Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll neben einer Kategorisierung und Bewertung der Entscheidungsaussprüche mit gesetzgeberischer Qualität darauf liegen, verfassungsrechtliche Probleme herauszuarbeiten: Die im Titel der Arbeit enthaltene Terminologie Ersatzgesetzgeberschaft weist bereits auf einen Konflikt mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz hin. Wo das Gericht wie ein Gesetzgeber handelt, stellt sich aber auch die Frage, inwieweit dadurch der Wille des Volkes verwirklicht werden kann, und ob nicht vielmehr ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip festzustellen ist.
Nicht erst seit Kurzem muss sich das Bundesverfassungsgericht den Vorwurf gefallen lassen, sich zum Ersatzgesetzgeber aufzuschwingen und selbst Politik zu betreiben. Durch politisch und juristisch höchst umstrittene Entscheidungen der letzten Jahre hat das Thema jedoch noch einmal an Brisanz gewonnen. Der Begriff "Ersatzgesetzgeber" wird sehr unterschiedlich verwendet: Er reicht von einer dem gesetzgeberischen Willen angeblich entgegenstehenden verfassungskonformen Auslegung (die m.E. noch keine Ersatzgesetzgeberschaft darstellt und in dieser Arbeit nicht behandelt wird) über teils sehr fordernde Appellentscheidungen und Unvereinbarkeitserklärungen bis hin zu bundesverfassungsgerichtlichen Übergangsregelungen, die am weitesten in den legislativen Aufgabenbereich hinübergreifen.
Das Bundesverfassungsgericht nimmt im Gefüge der Gewaltenteilung eine besondere Stellung ein: Es hat das Monopol zur Normverwerfung inne, zu der es im Verfahren der abstrakten und konkreten Normenkontrolle oder im unmittelbar oder inzident gegen Rechtsnormen gerichteten Verfassungsbeschwerdeverfahren kommen kann. Von der früheren Rechtsprechung, dass eine verfassungswidrige Norm nichtig und eine verfassungsmäßige Norm nicht zu beanstanden ist, weicht das Gericht immer weiter ab: In der Praxis wird die Nichtigerklärung zur Ausnahme und die, teils mit einer Weitergeltungsanordnung verbundene, Unvereinbarkeitserklärung zur Regel. Gerne nutzt das Bundesverfassungsgericht die Gelegenheit und schlägt im Rahmen dessen eine eigene Regelung vor – der Gesetzgeber folgt bereitwillig, um das Risiko einer erneuten Beanstandung zu minimieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Formen der Ersatzgesetzgeberschaft
- I. Appellentscheidung als bloß unverbindliche Aufforderung zur Nachbesserung
- II. Normenkontrolle als Gesetzgebung im materiellen Sinne bzw. als Akt negativer Gesetzgebung
- III. Unvereinbarkeitserklärung und Verpflichtung des Gesetzgebers zur verfassungskonformen Neuregelung
- IV. Weitergeltungsanordnung nach einer Unvereinbarkeitserklärung
- V. Formulierung einer verfassungsgerichtlichen Übergangsregelung nach einer Nichtig- oder Unvereinbarkeitserklärung
- C. Verfassungsrechtliche Probleme konkreter normativer Vorgaben
- I. Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG
- 1. Strukturelle Ungeeignetheit der Gerichte zur Setzung von Rechtsnormen, die über den Einzelfall hinaus Geltung beanspruchen
- 2. Justizielle Bevormundung des Gesetzgebers und vorauseilender Gehorsam der Politik
- II. Verstoß gegen das Demokratieprinzip, Art. 20 Abs. 1, 2, Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG
- 1. Allgemeiner Gesetzesvorbehalt, Art. 20 Abs. 3 GG und Wesentlichkeitstheorie
- 3. Öffentliche Akzeptanz, aber keine unmittelbare demokratische Legitimation der Verfassungsrichter
- 4. Herrschaft der Verfassung statt Demokratie?
- D. Ansätze zur Rechtfertigung der Ersatzgesetzgeberschaft
- I. Rückgriff auf § 35 BVerfGG als Irrweg
- II. Notkompetenz des Bundesverfassungsgerichts zur Vermeidung eines verfassungsentfernteren Zustands
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern Verfassungsgerichte als Ersatzgesetzgeber fungieren können. Die Arbeit analysiert verschiedene Formen der Ersatzgesetzgeberschaft und untersucht die verfassungsrechtlichen Probleme, die mit derartigem Vorgehen verbunden sind. Darüber hinaus werden Ansätze zur Rechtfertigung der Ersatzgesetzgeberschaft beleuchtet.
- Die verschiedenen Formen der Ersatzgesetzgeberschaft von Verfassungsgerichten
- Die verfassungsrechtlichen Probleme der Ersatzgesetzgeberschaft, insbesondere im Hinblick auf die Gewaltenteilung und das Demokratieprinzip
- Ansätze zur Rechtfertigung der Ersatzgesetzgeberschaft
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als Hüter der Verfassung und seine Möglichkeiten, in bestimmten Fällen normativ tätig zu werden
- Die Frage, ob und inwiefern die Tätigkeit von Verfassungsgerichten als Ersatzgesetzgeber mit dem demokratischen Prinzip vereinbar ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage definiert. Anschließend werden verschiedene Formen der Ersatzgesetzgeberschaft von Verfassungsgerichten dargestellt, darunter die Appellentscheidung, die Normenkontrolle und die Unvereinbarkeitserklärung.
Im dritten Kapitel werden die verfassungsrechtlichen Probleme der Ersatzgesetzgeberschaft diskutiert. Hierbei werden insbesondere die Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes und der Verstoß gegen das Demokratieprinzip thematisiert. Das vierte Kapitel widmet sich Ansätzen zur Rechtfertigung der Ersatzgesetzgeberschaft, beispielsweise die Argumentation aus der Notkompetenz des Bundesverfassungsgerichts.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Seminararbeit sind die Ersatzgesetzgeberschaft von Verfassungsgerichten, die Gewaltenteilung, das Demokratieprinzip, das Bundesverfassungsgericht, Normenkontrolle, Unvereinbarkeitserklärung, Verfassungskonformität und die Legitimation der Rechtsprechung.
- Quote paper
- Charlotte Greipl (Author), 2017, Verfassungsgerichte als Ersatzgesetzgeber? Verfassungsrechtliche Probleme sowie Kategorisierung und Bewertung der Entscheidungsaussprüche mit gesetzgeberischer Qualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914082