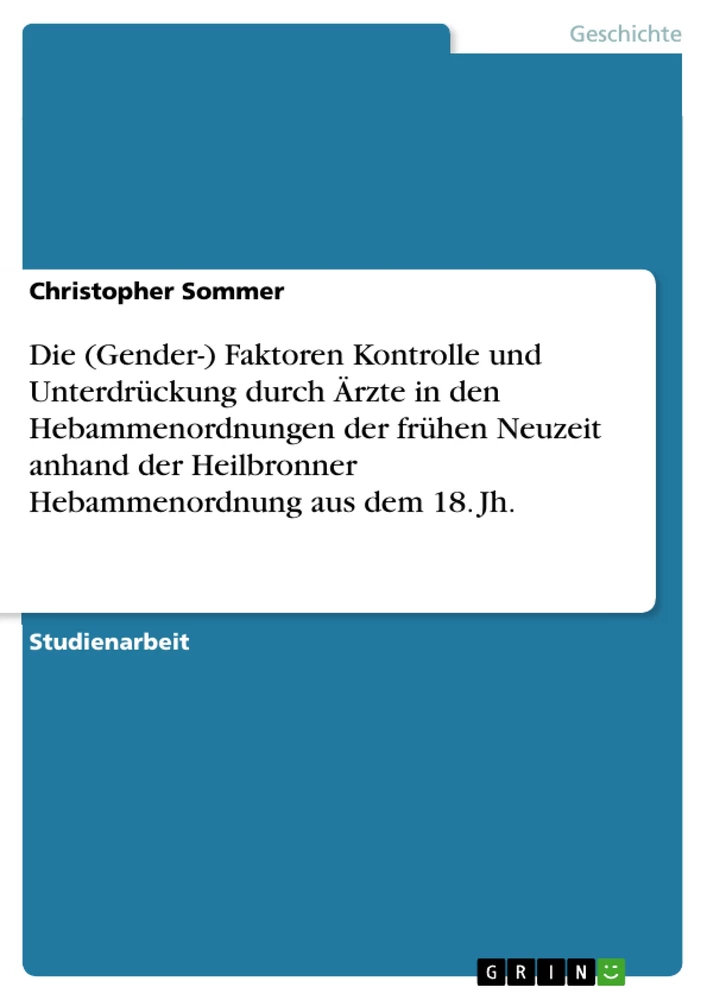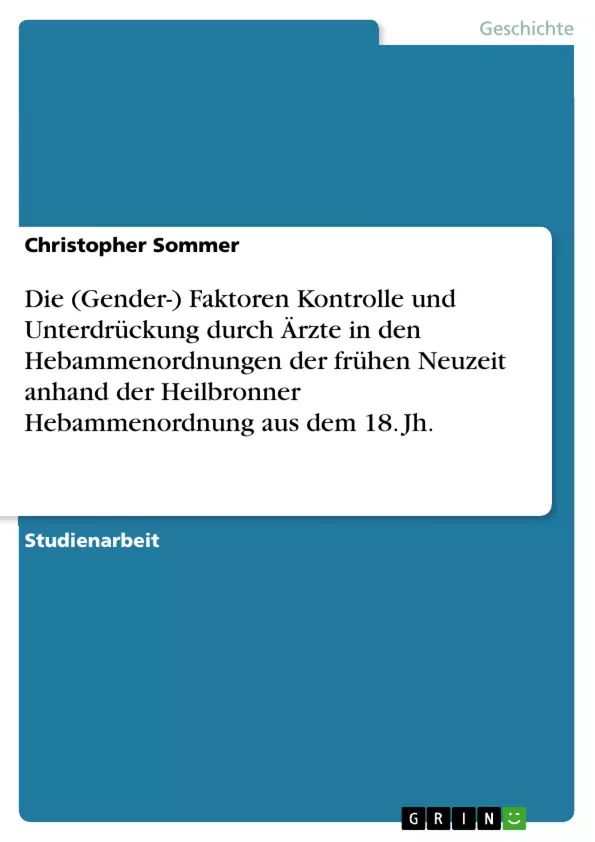Viele ältere Veröffentlichungen der Frauenforschung konstatieren eine schleichende Unterdrückung und Kontrolle der weiblichen Hebammen durch eine übermächtige männliche Ärzteschaft. Die ehemals freie Tätigkeit als Hebamme wäre nach und nach durch den Erlass von Hebammen-, Medizinal- und Policeyordnungen dem Reglement der studierten Mediziner unterstellt worden.
Die Aspekte Unterdrückung und Kontrolle scheinen stark geschlechtsorientiert zu sein. Kontrolle und Unterdrückung geht nur von einem Geschlecht aus: den Männern, wobei die Frauen als Opfer dieser Kontrolle erscheinen.
Das Argument der Unterdrückung bzw. Kontrolle der Hebammen wird durch die reichlichen normativen Quellen scheinbar belegt, wobei hier die Frage nach der Umsetzbarkeit der Verordnungen bzw. die Frage, ob diese Regelungen überhaupt befolgt wurden, meist ausgeklammert wird.
Das Anliegen dieser Arbeit ist es, anhand einiger Überlegungen zu Recht und Rechtswirklichkeit die Frage nach der scheinbaren Unterdrückung und Kontrolle des Hebammenberufs durch Hebammenordnungen neu zu bewerten.
Die grundlegende Fragestellung ist folglich, inwiefern normative Quellen zur Geschichte der Hebammenzunft, d.h. in diesem Fall der Hebammenordnungen, den Aspekt der Kontrolle durch eine aufstrebende männliche Ärzteschaft bzw. männliche Obrigkeit aufzeigen. Dies unter besonderer Berücksichtigung von ideellem und realem Recht.
Hierzu soll exemplarisch eine Hebammenordnung einer eingehenden Analyse unterzogen werden, vor allem im Hinblick auf die (Gender-)Faktoren Unterdrückung und Kontrolle. Dass die Behandlung nur einer Hebammenordnung methodische Schwierigkeiten mit sich bringt, ist nicht von der Hand zu weisen, jedoch in Anbetracht des geringen Umfangs dieser Arbeit erforderlich. Die Wahl fiel auf die Heilbronner Hebammenordnung, die in die Mitte des 18. Jh.s datiert wird.
Da sich die Hebammenordnungen der verschiedenen Zeiten und der verschiedenen Städte in ihren Grundzügen zwar ähneln, in den angesprochenen Punkten jedoch stark divergieren, kann die Untersuchung nur einer Ordnung nicht Allgemeingültigkeit für alle Städte und Zeiten beanspruchen. Da allerdings die Anmerkungen zu Recht und Rechtswirklichkeit allgemeine Gültigkeit besitzen, erweist sich, was diesen Punkt anbelangt, eine allgemeinere Sichtweise auf andere Hebammenordnungen als sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die (genderrelevanten-)Faktoren Kontrolle und Unterdrückung durch Ärzte in den Hebammenordnungen der frühen Neuzeit anhand der Heilbronner Hebammenordnung aus dem 18. Jh.
- 1. Kurzer Abriss des aktuellen Forschungsstandes zur Geschichte der Geburtshilfe
- 2. Recht- und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit
- 2.1 Recht und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit – allgemeine Tendenzen
- 2.2 Recht und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit – Tendenzen in der Geburtshilfe
- 3. Die Heilbronner Hebammenordnung – Quelleninterpretation
- 3.1 Die Heilbronner Hebammenordnung – Auswahlkriterien und Datierung
- 3.2 Analyse und Interpretation der Heilbronner Hebammenordnung
- 3.2.1 Physiologische und charakterliche Voraussetzungen
- 3.2.2 Examinierung und Ausbildung
- 3.2.3 Abergläubische Praktiken und schlechte Charaktereigenschaften
- 3.2.4 Meldung unverheiratet Schwangerer und alljährliche Befragung
- 3.2.5 Heiltätigkeiten, die über die Geburtshilfe hinausgehen
- 3.2.6 Verhalten im Falle einer schwierigen Geburt oder Tod der Gebärenden oder des Kindes
- 3.2.7 Anwesendheit während und nach der Geburt
- 3.2.8 Fortbildung
- 3.2.9 Landhebammen
- III. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Kontrolle und Unterdrückung von Hebammen durch Ärzte in der frühen Neuzeit, anhand der Heilbronner Hebammenordnung des 18. Jahrhunderts. Sie hinterfragt die gängige Darstellung einer einseitigen Unterdrückung und berücksichtigt die Aspekte von Recht und Rechtswirklichkeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ordnung und der Bewertung, inwieweit sie tatsächlich Kontrolle und Unterdrückung widerspiegelt oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten.
- Analyse der Heilbronner Hebammenordnung des 18. Jahrhunderts.
- Untersuchung des Verhältnisses von Recht und Rechtswirklichkeit im Kontext der Hebammenordnungen.
- Bewertung der These von der einseitigen Unterdrückung von Hebammen durch die männliche Ärzteschaft.
- Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Geburtshilfe.
- Differenzierung zwischen Stadt- und Landhebammen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Ausmaß der Kontrolle und Unterdrückung von Hebammen durch Ärzte in der frühen Neuzeit, basierend auf der Analyse von Hebammenordnungen, vor. Sie problematisiert die einseitige Darstellung einer männlichen Unterdrückung weiblicher Hebammen und kündigt die Analyse der Heilbronner Hebammenordnung als Fallbeispiel an. Der Fokus auf Recht und Rechtswirklichkeit wird als methodischer Ansatz hervorgehoben, um die tatsächliche Umsetzung der Ordnungen zu untersuchen und die gängige Interpretation zu hinterfragen.
II. Die (genderrelevanten-)Faktoren Kontrolle und Unterdrückung durch Ärzte in den Hebammenordnungen der frühen Neuzeit anhand der Heilbronner Hebammenordnung aus dem 18. Jh.: Dieses Kapitel bietet zunächst einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Geburtshilfe, wobei die divergierenden Perspektiven der traditionellen Medizingeschichte und der Frauenforschung herausgestellt werden. Anschließend werden allgemeine Tendenzen von Recht und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit und speziell im Kontext der Geburtshilfe beleuchtet. Der Hauptteil des Kapitels ist der detaillierten Analyse der Heilbronner Hebammenordnung gewidmet. Die Ordnung wird in Bezug auf verschiedene Aspekte untersucht, darunter die geforderten Voraussetzungen für Hebammen, Ausbildung, abergläubische Praktiken, die Meldung unverheirateter Schwangerer, Heiltätigkeiten, Verhalten bei schwierigen Geburten, Anwesenheit während und nach der Geburt, Fortbildung und die Situation von Landhebammen. Die Analyse zielt darauf ab, die in der Ordnung enthaltenen Regelungen hinsichtlich Kontrolle und Unterdrückung zu bewerten und deren tatsächliche Umsetzung zu hinterfragen.
Schlüsselwörter
Hebammenordnungen, Frühe Neuzeit, Geburtshilfe, Kontrolle, Unterdrückung, Recht, Rechtswirklichkeit, Gender, Heilbronner Hebammenordnung, 18. Jahrhundert, Medizingeschichte, Frauenforschung, Stadt- und Landhebammen.
Häufig gestellte Fragen zur Heilbronner Hebammenordnung des 18. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kontrolle und Unterdrückung von Hebammen durch Ärzte in der frühen Neuzeit, anhand der Heilbronner Hebammenordnung des 18. Jahrhunderts. Sie hinterfragt die gängige Darstellung einer einseitigen Unterdrückung und berücksichtigt Aspekte von Recht und Rechtswirklichkeit.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Inwieweit spiegelt die Heilbronner Hebammenordnung tatsächlich Kontrolle und Unterdrückung von Hebammen wider, oder spielten andere Faktoren eine Rolle? Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Recht und Rechtswirklichkeit im Kontext der Hebammenordnungen und bewertet die These von der einseitigen Unterdrückung von Hebammen durch die männliche Ärzteschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist die Heilbronner Hebammenordnung des 18. Jahrhunderts. Zusätzlich wird der aktuelle Forschungsstand zur Geschichte der Geburtshilfe herangezogen, um verschiedene Perspektiven (traditionelle Medizingeschichte und Frauenforschung) zu berücksichtigen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Hauptteil mit der Analyse der Heilbronner Hebammenordnung und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Der Hauptteil umfasst einen Überblick über den Forschungsstand, eine Betrachtung von Recht und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit und eine detaillierte Analyse der Heilbronner Hebammenordnung in Bezug auf verschiedene Aspekte (Ausbildung, Praktiken, Verhalten in Notfällen etc.).
Welche Aspekte der Heilbronner Hebammenordnung werden analysiert?
Die Analyse der Heilbronner Hebammenordnung umfasst die geforderten Voraussetzungen für Hebammen, die Ausbildung, abergläubische Praktiken, die Meldung unverheirateter Schwangerer, Heiltätigkeiten, das Verhalten bei schwierigen Geburten, die Anwesenheit während und nach der Geburt, Fortbildung und die Situation von Landhebammen im Vergleich zu Stadthebammen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die in der Ordnung enthaltenen Regelungen hinsichtlich Kontrolle und Unterdrückung zu bewerten und deren tatsächliche Umsetzung zu hinterfragen. Sie untersucht, ob die gängige Interpretation einer einseitigen Unterdrückung durch Ärzte gerechtfertigt ist, oder ob weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hebammenordnungen, Frühe Neuzeit, Geburtshilfe, Kontrolle, Unterdrückung, Recht, Rechtswirklichkeit, Gender, Heilbronner Hebammenordnung, 18. Jahrhundert, Medizingeschichte, Frauenforschung, Stadt- und Landhebammen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit der Geschichte der Geburtshilfe, der Frauen- und Geschlechtergeschichte, der Medizingeschichte und dem Verhältnis von Recht und Rechtswirklichkeit in der frühen Neuzeit befassen.
- Citation du texte
- Bakkelaureus Artium Christopher Sommer (Auteur), 2006, Die (Gender-) Faktoren Kontrolle und Unterdrückung durch Ärzte in den Hebammenordnungen der frühen Neuzeit anhand der Heilbronner Hebammenordnung aus dem 18. Jh., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91851