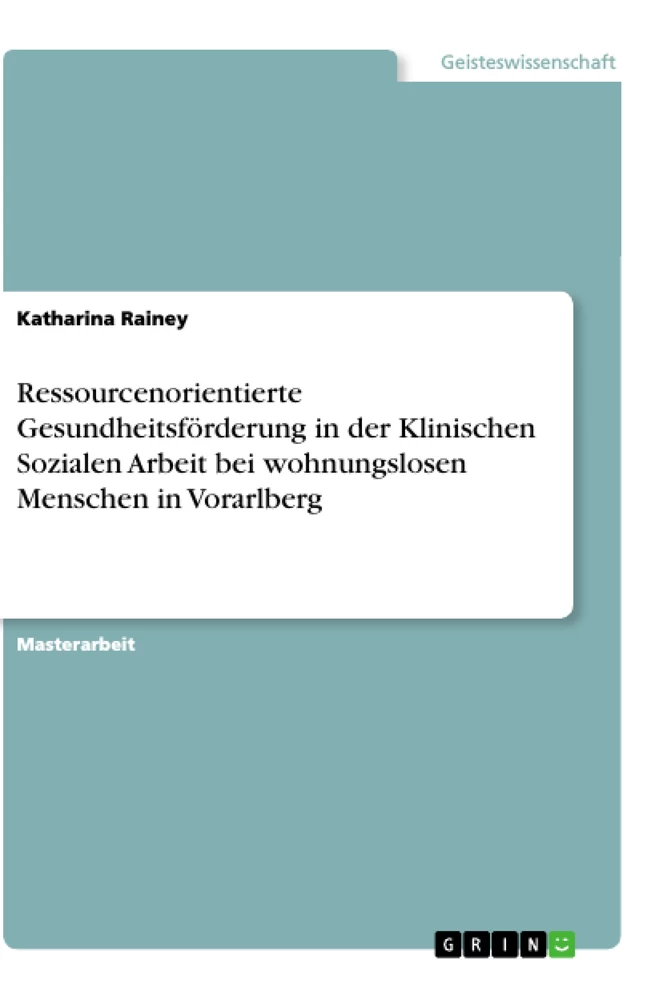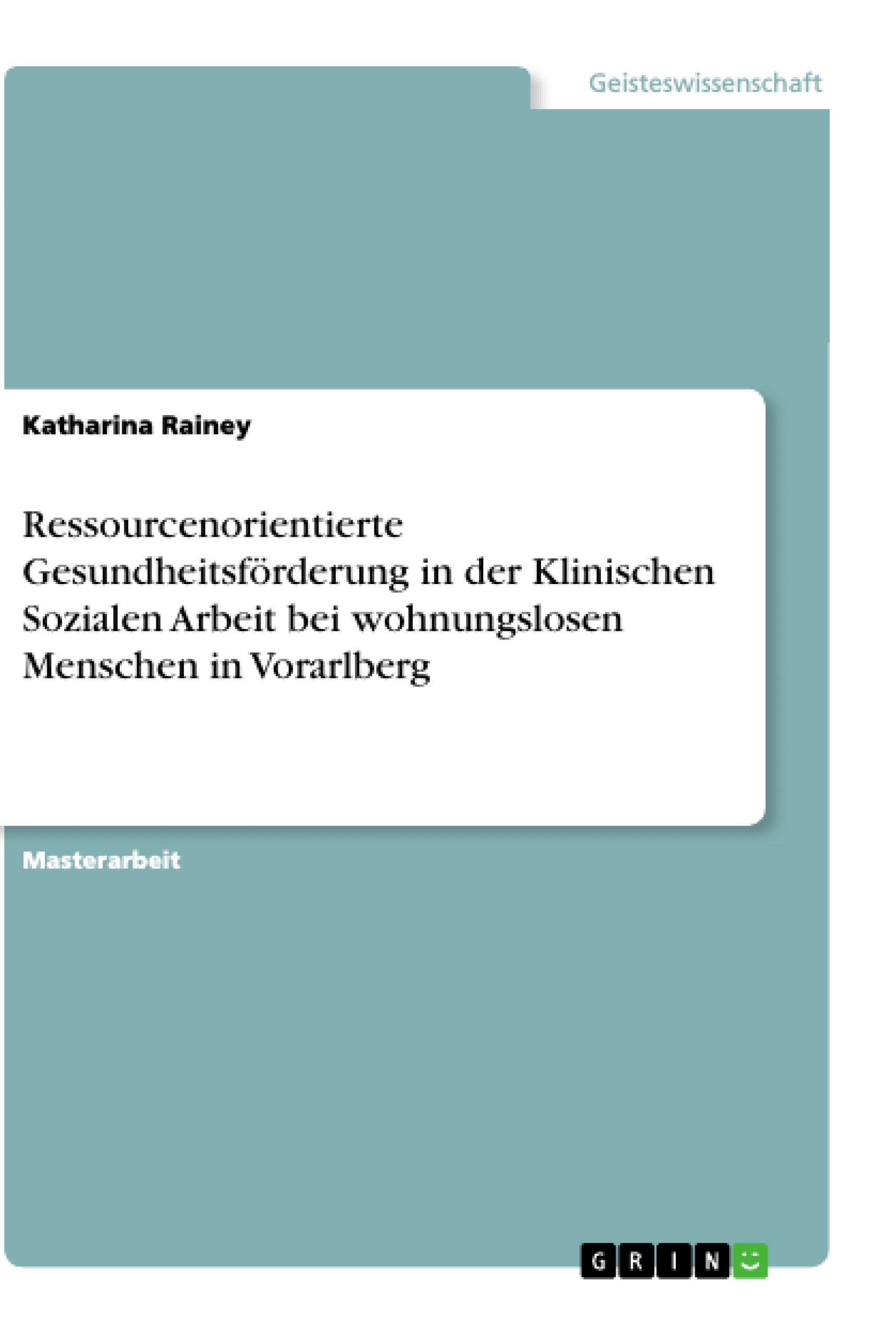Inwieweit fördern subjektiv wahrgenommene personale, soziale und strukturelle Ressourcen stationär untergebrachter, wohnungsloser Personen ihre selbstbeurteilte biopsychosoziale Gesundheit und von welchen soziodemografischen Merkmalen hängen sie ab?
Wohnungslose Menschen sind einer Vielzahl an biopsychosozialen Gesundheitsfolgen ausgesetzt. Personale, soziale und strukturelle Ressourcen sind dabei für die Entwicklung und den Erhalt der Gesundheit von großer Bedeutung, da mit ihrer Hilfe sowohl Stressoren konstruktiv bewältigt als auch Grundbedürfnisse angemessen befriedigt werden können. Bereits die Stärkung der Ressourcen-Wahrnehmung kann gesundheitsfördernd wirken und helfen Wohnungslosigkeit zu überwinden.
In dieser nicht repräsentativen Querschnittuntersuchung wurden insgesamt 44 wohnungslose, stationär untergebrachte Frauen (n=19) und Männer (n=25) zwischen 18 und 68 Jahren mündlich befragt. Mit unterschiedlichen (teil-)standardisierten Selbstbeurteilungsfragebögen, wurden vorhandene personale, soziale und strukturelle Ressourcen (ERI, ASKU), biopsychosoziale Gesundheit (SF-12v2) und soziodemografische Daten erfasst.
Am stärksten sind bei den Befragten personale Ressourcen, vor allem Autonomiebestreben ausgeprägt und am schwächsten die strukturellen Ressourcen. Vorhandene Ressourcen wirken sich signifikant positiv auf die subjektive biopsychosoziale Gesundheit der Befragten aus, insbesondere wirken vorhandene personale Ressourcen signifikant positiv auf ihre subjektive psychische und körperliche Gesundheit. Subjektive soziale Gesundheit hängt signifikant positiv mit vorhandenen sozialen und auch trendhaft mit strukturellen Ressourcen zusammen. Die Aufenthaltsdauer in den Einrichtungen korreliert hingegen signifikant negativ mit vorhandenen personalen wie auch sozialen Ressourcen der Befragten.
Frühe, umfassende Förderung der Ressourcen von stationär untergebrachten wohnungslosen Frauen und Männern ist eine wichtige und notwendige gesundheitsfördernde Intervention. Eine Kombination aus Ressourcenaktivierung und Wohnungsvermittlung kann die subjektive biopsychosoziale Gesundheit wohnungsloser Menschen lang anhaltend fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Grundlagen zur Wohnungslosigkeit
- Definition
- Erscheinungsformen
- Ursachen
- Biopsychosoziale Gesundheitsfolgen
- Risikofaktoren
- Biologische Folgen
- Psychische Folgen
- Soziale Folgen
- Wohnungslosigkeit und Klinische Soziale Arbeit
- Ressourcen und Wohnungslosigkeit
- Was sind Ressourcen?
- Begriffserklärung
- Personale Ressourcen
- Soziale Ressourcen
- Strukturelle Ressourcen
- Ressourcen-Merkmale
- Gesundheitsfördernde Funktion der Ressourcen
- Stressbewältigung mithilfe der Ressourcen (Antonovsky)
- Bedürfnisbefriedigung mithilfe der Ressourcen (Grawe)
- Ressourcen von wohnungslosen Menschen
- Was sind Ressourcen?
- Biopsychosoziale Gesundheit und Gesundheitsförderung
- Salutogenetische Orientierung
- Gesundheitsdefinition
- Ressourcenorientierte Gesundheitsförderung
- Forschungsziel, Fragestellung und Hypothesen
- Forschungsziel
- Fragestellung und Hypothesen
- Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Ressourcen auf die biopsychosoziale Gesundheit von wohnungslosen Menschen in Vorarlberg. Ziel ist es, zu untersuchen, inwieweit subjektiv wahrgenommene personale, soziale und strukturelle Ressourcen die selbstbeurteilte Gesundheit von stationär untergebrachten, wohnungslosen Personen fördern.
- Die Bedeutung von Ressourcen für die Bewältigung von Stress und die Befriedigung von Bedürfnissen bei wohnungslosen Menschen
- Die Auswirkungen von personalen, sozialen und strukturellen Ressourcen auf die biopsychosoziale Gesundheit von wohnungslosen Menschen
- Die Rolle der soziodemografischen Merkmale im Zusammenhang mit Ressourcen und Gesundheit
- Die Bedeutung von Ressourcenaktivierung und Wohnungsvermittlung für die langfristige Förderung der Gesundheit wohnungsloser Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung liefert einen kurzen Überblick über die Relevanz des Themas Wohnungslosigkeit und Ressourcen in der Klinischen Sozialen Arbeit.
- Allgemeine Grundlagen zur Wohnungslosigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Wohnungslosigkeit, beleuchtet verschiedene Erscheinungsformen, analysiert die Ursachen sowie die biopsychosozialen Folgen und stellt den Zusammenhang zur Klinischen Sozialen Arbeit dar.
- Ressourcen und Wohnungslosigkeit: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von Ressourcen erläutert, die Rolle von Ressourcen für die Gesundheit betont und die spezifischen Ressourcen von wohnungslosen Menschen betrachtet.
- Biopsychosoziale Gesundheit und Gesundheitsförderung: Dieses Kapitel beleuchtet die salutogenetische Orientierung, die Definition von Gesundheit und die Bedeutung der Ressourcenorientierung in der Gesundheitsförderung.
- Forschungsziel, Fragestellung und Hypothesen: Hier wird das Forschungsziel der Arbeit sowie die zugrundeliegende Fragestellung und die dazugehörigen Hypothesen dargelegt.
- Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der Forschungsarbeit, einschließlich der Stichprobe, des Datenerhebungs- und -analyseprozesses.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Wohnungslosigkeit, Ressourcen, biopsychosoziale Gesundheit, Gesundheitsförderung, Klinische Soziale Arbeit, Ressourcenaktivierung, Wohnungsvermittlung und soziodemografische Merkmale.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Ressourcen für wohnungslose Menschen?
Personale, soziale und strukturelle Ressourcen helfen dabei, Stressoren konstruktiv zu bewältigen und Grundbedürfnisse zu befriedigen, was für den Erhalt der Gesundheit essenziell ist.
Was sind "personale Ressourcen" im Kontext dieser Studie?
Dazu zählen individuelle Fähigkeiten und Einstellungen wie das Autonomiebestreben, die in der Untersuchung bei den Befragten am stärksten ausgeprägt waren.
Wie wirkt sich die Aufenthaltsdauer in Einrichtungen aus?
Die Studie zeigt eine signifikant negative Korrelation: Je länger Personen in stationären Einrichtungen untergebracht sind, desto schwächer werden ihre personalen und sozialen Ressourcen wahrgenommen.
Was ist das Ziel der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung?
Ziel ist es, die Wahrnehmung vorhandener Ressourcen zu stärken, um die biopsychosoziale Gesundheit zu verbessern und die Überwindung der Wohnungslosigkeit zu unterstützen.
Welche Kombination an Maßnahmen wird empfohlen?
Die Arbeit empfiehlt eine Kombination aus frühzeitiger Ressourcenaktivierung und aktiver Wohnungsvermittlung für einen langfristigen Erfolg.
Wie wurde die Gesundheit der Probanden gemessen?
Es wurden standardisierte Selbstbeurteilungsfragebögen wie der SF-12v2 für die biopsychosoziale Gesundheit sowie ERI und ASKU für die Ressourcen verwendet.
- Citar trabajo
- Katharina Rainey (Autor), 2015, Ressourcenorientierte Gesundheitsförderung in der Klinischen Sozialen Arbeit bei wohnungslosen Menschen in Vorarlberg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922981