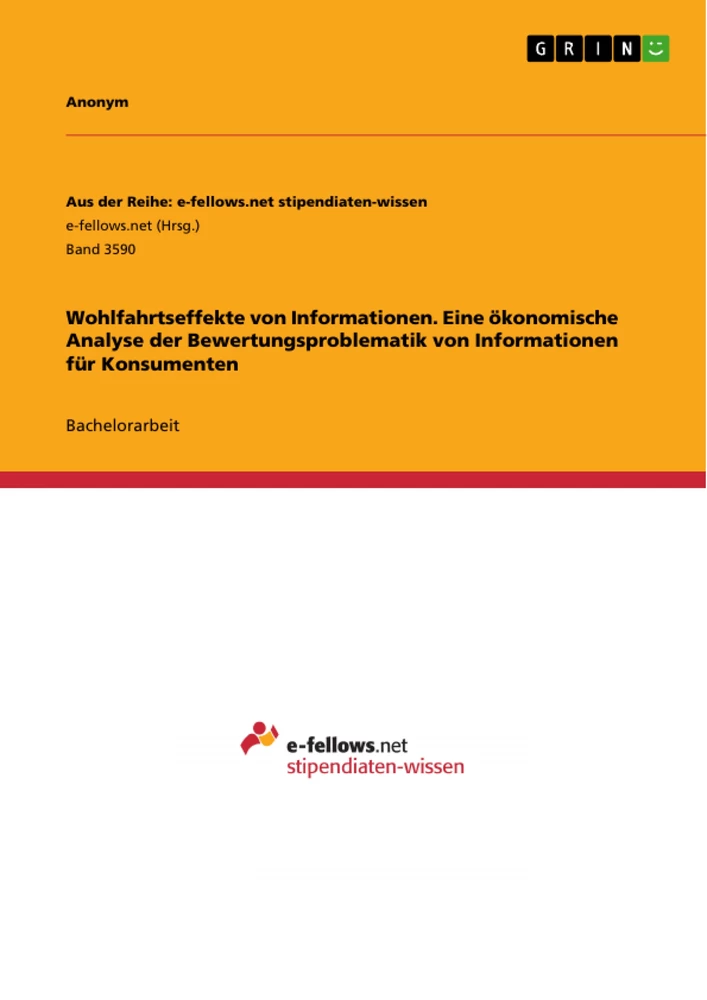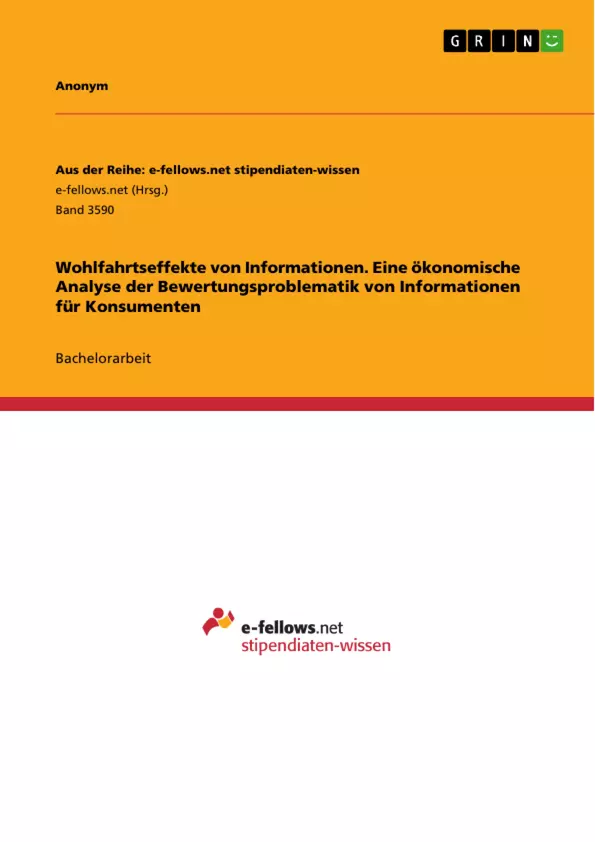Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Umgang von Informationen gegenüber dem Verbraucher sowie den Wohlfahrtseffekten von Informationen. Ziel dieser Arbeit ist es zu klären, ob Verbraucher aus wohlfahrtsökonomischer Sicht blind informiert werden sollten, wie es teilweise der Fall ist, oder ob es manchmal besser ist, Konsumenten nicht zu informieren. Damit sollen Anreize zu einer kritischeren Hinterfragung des Informierungsinstruments gegeben werden, um sich einem idealen Informierungssystem annähern zu können.
Diese Arbeit konzentriert sich auf individuelle Renten, nur teilweise auf die aggregierte Konsumentenrente. Sie behandelt keinen Nutzen und keine Kosten aus Produzenten- oder staatlicher Seite, da dies für die prinzipielle Problemstellung irrelevant ist. Ethische Bedenken werden in einem Exkurs aufgefasst. In dieser Fragestellung ist es essenziell, interdisziplinär – ethisch, juristisch, ökonomisch, politisch – vorzugehen, da diese nicht rein ökonomisch angegangen werden kann, zumal das Wohl von Menschen, das in einem gesellschaftlichen System eingebettet ist, im Zentrum steht.
Um die Zielsetzung zu verfolgen, wird im ersten Teil der Arbeit angeschnitten, wieso sich Information von anderen Gütern unterscheidet und ein handliches, jedoch nicht unumstrittenes Wohlfahrtsmaß vorgeschlagen, dessen Grenzen später beschrieben werden. In Kapitel drei wird weiterhin an die Rationalitätsannahme angelehnt und aufgezeigt, wie sich Information in einem Entscheidungskalkül bemerkbar macht, und dass auch hier durch diverse weitergehende Überlegungen zur Schlussfolgerung gekommen werden kann, dass Information nicht strikt positiv bewertet werden muss. In Kapitel vier wird von der Rationalitätsannahme abgesehen und ein verhaltensökonomischer Ansatz geboten, der die These eines negativen Werts mancher Informationen zusätzlich untermauert. Gleichzeitig werden in diesem Zusammenhang Folgen für die Informationsbewertung angeschnitten, sodass im fünften Kapitel Konzepte zur Informationsbewertung erörtert werden können und dabei retrospektiv auf die Bewertungsproblematiken des vierten Kapitels Bezug genommen werden kann. Im sechsten und letzten Teil werden – trotz eines Netzes von Problematiken – vereinzelt gewonnene Erkenntnisse in der Bewertung von Informationen für die Verbraucherpolitik normativ ausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Informationsökonomische Grundlagen
- Ökonomische Charakterisierung von Information
- Information und rationale Entscheidungsfindung
- Wohlfahrtsmessung nach Kaldor und Hicks (1939)
- Folgen von Informationen auf das Entscheidungskalkül rationaler Konsumenten
- Verhaltensökonomische Folgen von Informationen auf das Entscheidungskalkül
- Bounded Rationality und Informationsumgehung
- Ausgewählte Biases und Framing
- Verzerrte Interpretationen öffentlicher Informationen
- Intertemporalität und Reue
- Suchtverhalten – „Gefangensein in den eigenen Präferenzen“
- Quantifizierungsproblematik bei der Folgenbewertung von Informationen
- Unbewertete Informierungsmaßnahmen
- Endpunktbewertung
- Break-Even-Analyse
- Problematik der Aggregierung ordinaler Wohlfahrtsmaße
- Willingness-to-Pay/ Willingness-to-Accept als empirisches Bewertungsmaß
- Implementierung der Erkenntnisse in verbraucherpolitische Maßnahmen
- Zusammenfassung
- Ethischer Exkurs: ein natürliches „Right to Know“?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Wohlfahrtseffekte von Informationen für Konsumenten aus ökonomischer Sicht. Sie analysiert die Problematik der Bewertung von Informationen und deren Folgen für rationale Entscheidungsfindungen.
- Ökonomische Charakterisierung von Information und ihre Rolle in rationalen Entscheidungsprozessen
- Bewertung von Information und ihre Auswirkungen auf das Wohlfahrtsniveau von Konsumenten
- Verhaltensökonomische Aspekte der Informationsverarbeitung und ihre Implikationen für Konsumentenentscheidungen
- Methoden zur Quantifizierung der Folgen von Information auf Konsumentenentscheidungen
- Ethische Implikationen des "Right to Know" im Kontext von Konsumenteninformation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Wohlfahrtseffekte von Informationen ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie erläutert die Relevanz des Themas und stellt die methodische Vorgehensweise vor.
- Informationsökonomische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die ökonomischen Eigenschaften von Informationen und deren Einfluss auf rationale Entscheidungen. Es wird die Wohlfahrtsmessung nach Kaldor und Hicks (1939) vorgestellt.
- Folgen von Informationen auf das Entscheidungskalkül rationaler Konsumenten: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von Informationen auf das Entscheidungsverhalten rationaler Konsumenten. Es werden die Folgen von Informationen auf Präferenzen, Nutzen und Entscheidungen betrachtet.
- Verhaltensökonomische Folgen von Informationen auf das Entscheidungskalkül: Dieses Kapitel widmet sich verhaltensökonomischen Aspekten der Informationsverarbeitung. Es werden verschiedene Biases und Framing-Effekte untersucht, die die Entscheidungsfindung beeinflussen können.
- Quantifizierungsproblematik bei der Folgenbewertung von Informationen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, die Folgen von Informationen quantitativ zu bewerten. Es werden verschiedene Methoden und ihre Grenzen diskutiert, einschließlich der Willingness-to-Pay/ Willingness-to-Accept-Methode.
- Implementierung der Erkenntnisse in verbraucherpolitische Maßnahmen: Dieses Kapitel analysiert, wie die Erkenntnisse der Arbeit in verbraucherpolitische Maßnahmen implementiert werden können. Es werden Möglichkeiten zur Verbesserung der Konsumenteninformation und -bildung diskutiert.
- Ethischer Exkurs: ein natürliches "Right to Know"?: Dieses Kapitel befasst sich mit der ethischen Dimension des "Right to Know" im Kontext von Konsumenteninformation. Es werden ethische Argumente für und gegen ein Recht auf Information diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Wohlfahrtseffekte, Information, Konsumenten, Entscheidungsfindung, Verhaltensökonomie, Biases, Framing, Quantifizierung, Willingness-to-Pay, Willingness-to-Accept, Verbraucherpolitik, ethische Implikationen, Right to Know.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Wert von Informationen für Konsumenten kritisch hinterfragt?
Die Arbeit untersucht, ob Informationen immer wohlfahrtssteigernd sind oder ob Konsumenten durch zu viel oder falsch aufbereitete Information ("Information Overload" oder Biases) schlechtere Entscheidungen treffen.
Welche Rolle spielt die Verhaltensökonomie in dieser Analyse?
Sie liefert Erklärungsansätze wie "Bounded Rationality", Framing-Effekte und kognitive Verzerrungen (Biases), die zeigen, dass Menschen Informationen oft nicht rein rational verarbeiten.
Was bedeutet das "Right to Know" im Kontext der Verbraucherpolitik?
Es bezeichnet den ethischen und rechtlichen Anspruch von Konsumenten auf Information, wobei die Arbeit abwägt, wann dieses Recht tatsächlich dem Wohlbefinden dient.
Wie lassen sich Wohlfahrtseffekte von Informationen messen?
Die Studie diskutiert Methoden wie die Zahlungsbereitschaft (Willingness-to-Pay), die Break-Even-Analyse und Wohlfahrtsmaße nach Kaldor und Hicks.
Können Informationen einen negativen Wert haben?
Ja, wenn Informationen zu Reue, Suchtverhalten oder Fehlentscheidungen führen, können sie die individuelle Wohlfahrt senken, statt sie zu erhöhen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Wohlfahrtseffekte von Informationen. Eine ökonomische Analyse der Bewertungsproblematik von Informationen für Konsumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924076