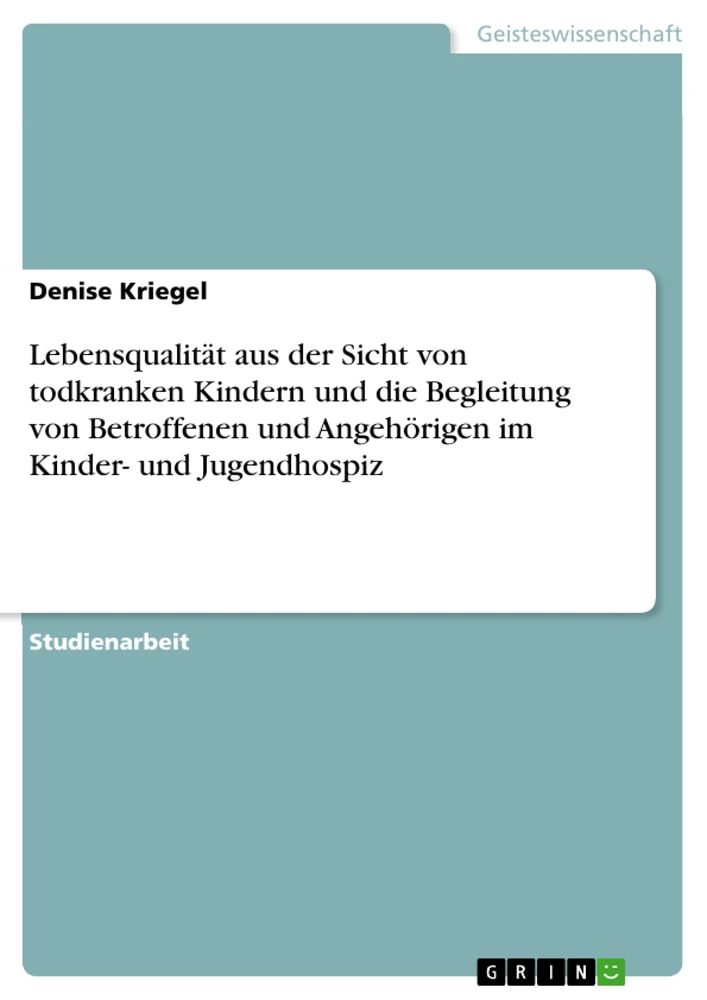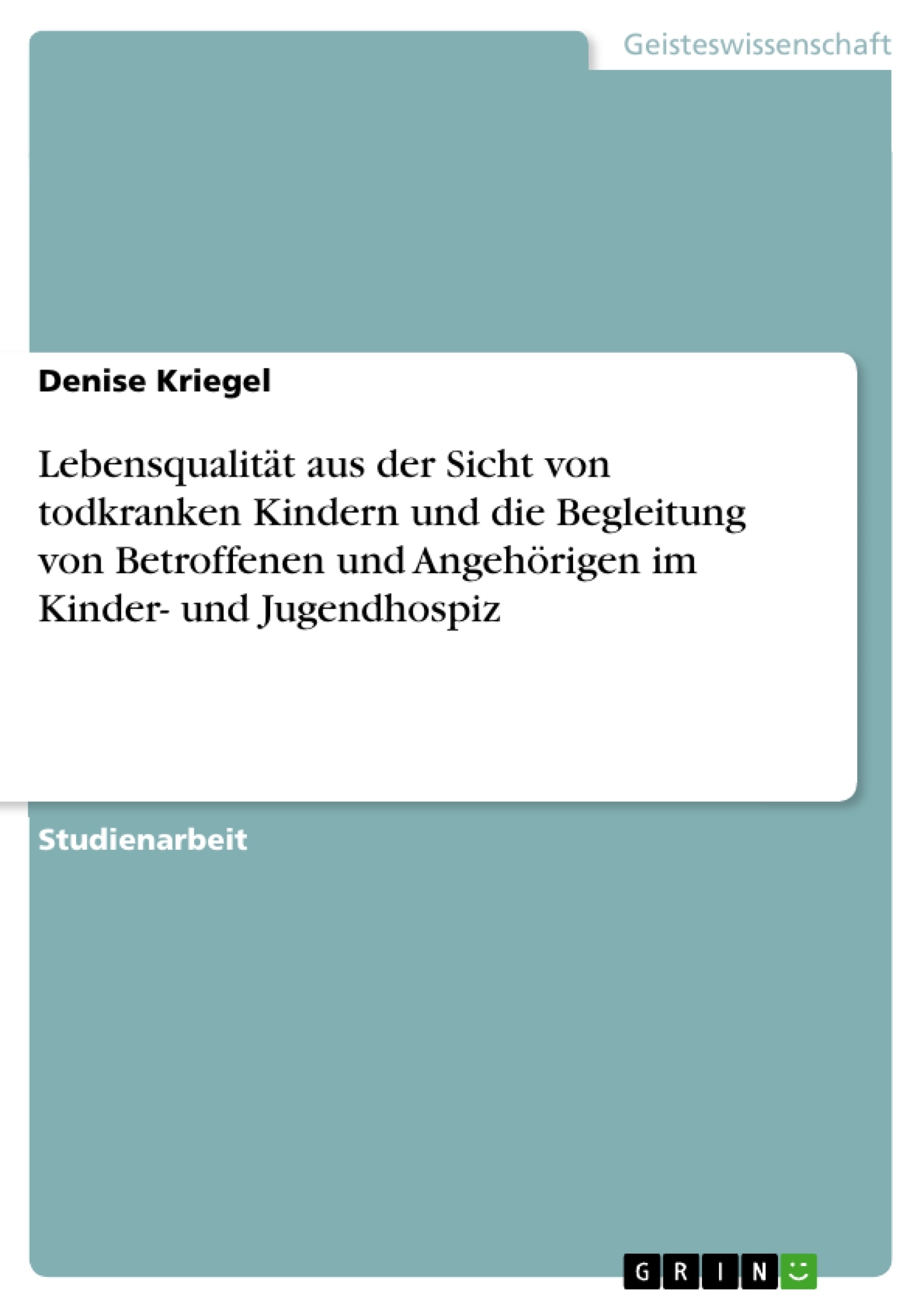Die Arbeit stellt sich die Frage, welche Bedürfnisse und Wünsche Kinder und ihre Familien in Lebenslagen im Hospiz zeigen. Anhand folgender Frage strukturiert sich die Arbeit: Welche Maßnahmen können in Kinder- und Jugendhospizen getroffen werden, um positiv auf die Situation von Familien einzuwirken?
In der folgenden Studie wurden 1605 Probanden gefragt, inwieweit sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Die Befragungen wurden über computergestützte Interviews durchgeführt. Die Ergebnisse waren dabei positiv. Im Frühjahr 2016 gaben zum Beispiel nur 11% der Befragten an, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben zu sein.
Dazu wird zu Beginn die Bedeutung von Lebensqualität bei Kindern mit schweren Krankheiten erläutert. Daraufhin wird näher auf die Arbeit in Kinder- und Jugendhospizen eingegangen und speziell die Arbeit der Palliativsorge erklärt. Zuletzt folgt ein Kapitel zur bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Hospiz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Lebensqualität
- Definition und Bedeutung für Kinder mit schweren Krankheiten
- Angst Abschied nehmen zu müssen – eingeschränkte Lebensqualität und dringende Thematisierung des Sterbens
- Soziale Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz
- Bedeutung der Sozialen Arbeit im Palliative Care
- Bedürfnisorientierte Begleitung am Beispiel Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Lebensqualität aus der Sicht von todkranken Kindern und beleuchtet die Bedeutung der bedürfnisorientierten Begleitung durch Sozialarbeiter im Kinder- und Jugendhospiz.
- Definition und Bedeutung von Lebensqualität im Kontext lebensverkürzender Erkrankungen bei Kindern
- Die Auswirkungen der Krankheit auf die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Palliative Care und die Bedeutung der bedürfnisorientierten Begleitung im Kinder- und Jugendhospiz
- Beispiele für die praktische Umsetzung der Begleitung von Familien in Kinder- und Jugendhospizen
- Die Herausforderungen und Chancen der Sozialen Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Lebensqualität bei todkranken Kindern und der Bedeutung der Begleitung von Betroffenen und Angehörigen im Kinder- und Jugendhospiz ein.
Der Begriff der Lebensqualität
Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Bedeutung von Lebensqualität im Kontext von schweren Erkrankungen bei Kindern. Es werden die Auswirkungen der Krankheit auf die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien beleuchtet, sowie die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung und der persönlichen Werte für die Lebensqualität hervorgehoben.
Soziale Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz
In diesem Kapitel werden die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Palliative Care sowie die praktische Umsetzung der bedürfnisorientierten Begleitung von Familien in Kinder- und Jugendhospizen behandelt. Es werden beispielhaft die Aufgaben und Tätigkeiten von Sozialarbeitern im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz dargestellt.
Schlüsselwörter
Lebensqualität, todkranke Kinder, Kinder- und Jugendhospiz, Soziale Arbeit, Palliative Care, Bedürfnisorientierung, Begleitung, Familien, Abschied, Sterben, Vergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Lebensqualität bei todkranken Kindern definiert?
Lebensqualität ist subjektiv und umfasst das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden. Bei schwerstkranken Kindern steht die Erfüllung individueller Bedürfnisse trotz körperlicher Einschränkungen im Vordergrund.
Welche Aufgaben hat die Soziale Arbeit im Kinderhospiz?
Sozialarbeiter unterstützen Familien bei der Krankheitsbewältigung, bieten psychosoziale Beratung, helfen bei bürokratischen Hürden und begleiten den Abschiedsprozess.
Was ist das Ziel von Palliative Care bei Kindern?
Ziel ist die bestmögliche Lebensqualität für das Kind und seine Familie durch Schmerzlinderung, Symptomkontrolle und ganzheitliche Begleitung, wenn Heilung nicht mehr möglich ist.
Warum ist die Thematisierung des Sterbens für betroffene Kinder wichtig?
Kinder spüren oft ihre Situation. Eine offene, altersgerechte Kommunikation kann Ängste abbauen und dem Kind helfen, sich sicher und verstanden zu fühlen.
Was leistet das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz beispielhaft?
Es bietet eine bedürfnisorientierte Begleitung, die sowohl die medizinische Pflege als auch die emotionale Unterstützung der gesamten Familie in den Fokus rückt.
- Citation du texte
- Denise Kriegel (Auteur), 2018, Lebensqualität aus der Sicht von todkranken Kindern und die Begleitung von Betroffenen und Angehörigen im Kinder- und Jugendhospiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924181