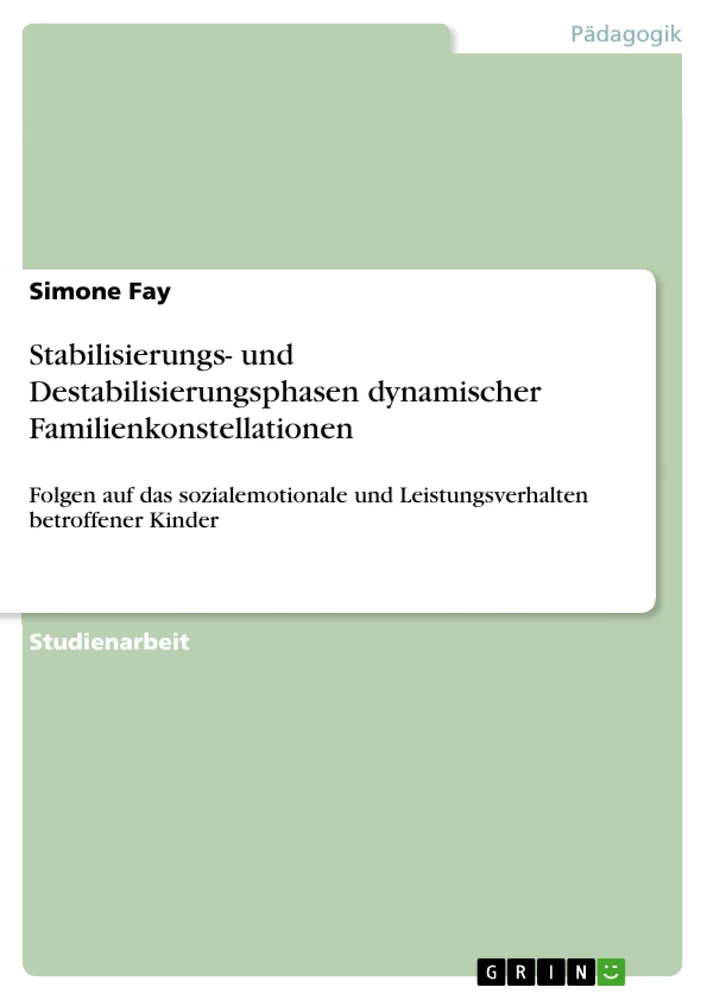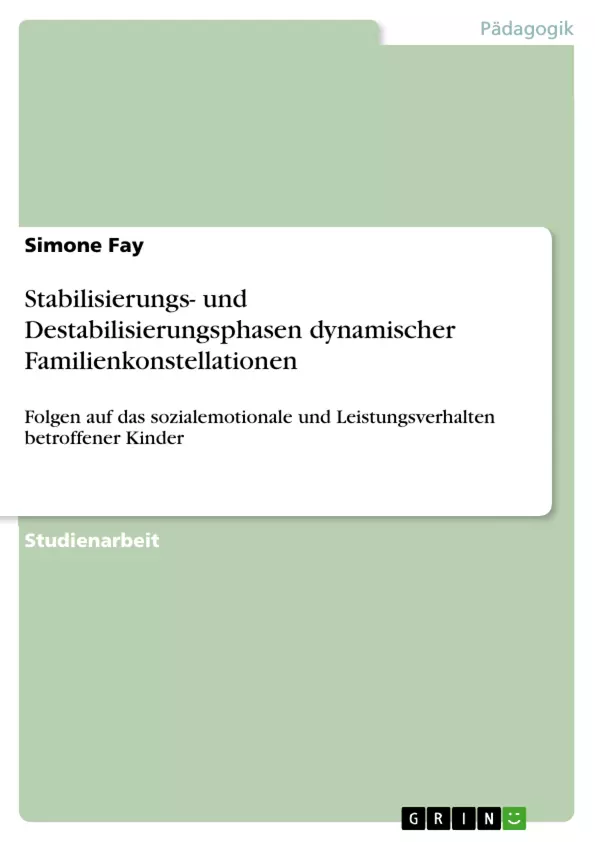Diese Arbeit beleuchtet primär die Familienereignismodelle der Bamberger Studie (Schlemmer 2004), welche mögliche Sequenzen dynamischer Familienkonstellationen und ihre Folgen hinsichtlich des sozialemotionalen sowie Leistungsverhalten und Schulerfolg empirisch beleuchtet.
Zunächst wird hierzu das methodische Vorgehen der Bamberger Studie sowie ihre Zielsetzung dargestellt. Ferner werden die zwei Familienereignismodelle beschrieben und damit verbundene Konsequenzen für betroffene Kinder auf sozialemotionaler Ebene sowie die Schulleistungen betreffend herausgestellt. Überdies wird die Bewältigung familialer Diskontinuität seitens der Kinder in beiden Modellen dargestellt und mit der Kölner Längsschnittstudie (Schmitz/Schmid-Denter 1999) verglichen. Ein Fazit bildet gemeinsam mit den für diese Modulleistung erforderlichen Modulanbindungen zu den Seminaren „Research for the use of media at school“, „Kolloquium zur forschungsmethodischen Qualifizierung“ und „Einführung in die Schulsozialarbeit“ den Schluss dieser Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Familie und Diskontinuität - Familienereignismodelle (Schlemmer 2004)
- 2.1 Aufbau und Zielsetzung der Bamberger Studie
- 2.2 Das Trennungskind-Modell
- 2.3 Das Waisenkind-Modell
- 2.4 Bewältigungsverläufe – Zusammenfassung, Fazit und Empfehlungen für Lehrkräfte
- 3. Ein Vergleich zur Kölner Studie (Schmitz/Schmidt-Denter 1999)
- 3.1 Aufbau und Zielsetzung der Kölner Studie
- 3.2 Ergebnisse des HAVEL-Tests & Vergleich zu den vorherigen Erhebungen
- 3.3 Vergleichende Betrachtung der Studien sowie ihrer Ergebnisse
- 3.4 Kritische Betrachtung der Studien sowie mögliche Verbesserungsvorschläge
- 4. Fazit
- 5. Modulanbindungen - Schulsozialpädagogik, Medien im Schulkontext und forschungsmethodische Qualifizierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss dynamischer Familienkonstellationen auf das sozial-emotionale und Leistungsverhalten von Kindern. Sie fokussiert auf die Bamberger Studie (Schlemmer 2004), welche Familienereignismodelle entwickelt hat, um diese Zusammenhänge empirisch zu beleuchten. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse mit der Kölner Studie (Schmitz/Schmidt-Denter 1999) und zieht Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis.
- Einfluss von Familiendiskontinuität auf Kinder
- Analyse der Familienereignismodelle der Bamberger Studie
- Vergleich der Bamberger und Kölner Studien
- Folgen für sozial-emotionales und Leistungsverhalten von Kindern
- Implikationen für die pädagogische Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Wandel des traditionellen Familienbildes hin zu dynamischen Familienkonstellationen. Sie hebt die Bedeutung der Familienereignisse und deren potenziell negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Familienereignismodelle der Bamberger Studie und deren Vergleich mit der Kölner Studie.
2. Familie und Diskontinuität – Familienereignismodelle (Schlemmer 2004): Dieses Kapitel beschreibt die Bamberger Studie, ihre methodische Vorgehensweise und Zielsetzung. Es analysiert die zwei zentralen Familienereignismodelle, das Trennungskind- und das Waisenkind-Modell, im Detail, und beleuchtet die Auswirkungen auf das sozial-emotionale Verhalten und die Schulleistungen der Kinder. Der Fokus liegt auf der empirischen Untersuchung der Folgen von Familienereignissen und deren Bewältigung durch die Kinder aus der Perspektive der Eltern.
3. Ein Vergleich zur Kölner Studie (Schmitz/Schmidt-Denter 1999): Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Bamberger Studie mit denen der Kölner Längsschnittstudie. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den methodischen Ansätzen und den gewonnenen Ergebnissen bezüglich des Einflusses von Familiendiskontinuität auf Kinder. Kritische Betrachtungen der Studien und mögliche Verbesserungsvorschläge werden ebenfalls diskutiert. Der Vergleich dient dazu, ein umfassenderes Bild der Auswirkungen dynamischer Familienstrukturen auf Kinder zu zeichnen und die Aussagekraft der einzelnen Studien zu bewerten.
Schlüsselwörter
Familienereignismodelle, dynamische Familienkonstellationen, Trennung, Tod eines Elternteils, sozial-emotionales Verhalten, Leistungsverhalten, Schulerfolg, Bamberger Studie, Kölner Studie, Längsschnittstudie, empirische Forschung, pädagogische Implikationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss dynamischer Familienkonstellationen auf Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss dynamischer Familienkonstellationen, insbesondere Trennung und Tod eines Elternteils, auf das sozial-emotionale und Leistungsverhalten von Kindern. Sie analysiert und vergleicht zwei empirische Studien (Bamberger und Kölner Studie) zu diesem Thema und leitet daraus Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis ab.
Welche Studien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Bamberger Studie (Schlemmer 2004) mit der Kölner Studie (Schmitz/Schmidt-Denter 1999). Die Bamberger Studie entwickelt Familienereignismodelle (Trennungskind- und Waisenkind-Modell), während die Kölner Studie ebenfalls den Einfluss von Familiendiskontinuität auf Kinder untersucht. Der Vergleich umfasst methodische Ansätze und Ergebnisse beider Studien.
Was sind die zentralen Familienereignismodelle der Bamberger Studie?
Die Bamberger Studie präsentiert zwei zentrale Modelle: das Trennungskind-Modell und das Waisenkind-Modell. Diese Modelle analysieren die Auswirkungen von Trennung der Eltern bzw. dem Tod eines Elternteils auf die Kinder, insbesondere deren sozial-emotionales Verhalten und ihre Schulleistungen.
Wie werden die Auswirkungen von Familiendiskontinuität untersucht?
Die Auswirkungen werden anhand der Ergebnisse der Bamberger und Kölner Studien untersucht. Die Studien betrachten empirisch das sozial-emotionale Verhalten und die Schulleistungen von Kindern in unterschiedlichen Familienkonstellationen. Der Vergleich beider Studien ermöglicht eine umfassendere Bewertung der Auswirkungen von Familiendiskontinuität.
Welche Schlussfolgerungen werden für die pädagogische Praxis gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis, indem sie die Ergebnisse der Studien analysiert und in Bezug zu den Herausforderungen der Arbeit mit Kindern aus dynamischen Familien stellt. Konkrete Empfehlungen für Lehrkräfte sind Teil des Abschlusses.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Familie und Diskontinuität (Bamberger Studie), Vergleich zur Kölner Studie, Fazit und Modulanbindungen (Schulsozialpädagogik, Medien im Schulkontext und forschungsmethodische Qualifizierung).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Familienereignismodelle, dynamische Familienkonstellationen, Trennung, Tod eines Elternteils, sozial-emotionales Verhalten, Leistungsverhalten, Schulerfolg, Bamberger Studie, Kölner Studie, Längsschnittstudie, empirische Forschung, pädagogische Implikationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss dynamischer Familienkonstellationen auf das sozial-emotionale und Leistungsverhalten von Kindern zu untersuchen und daraus praxisrelevante Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit abzuleiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Simone Fay (Author), 2017, Stabilisierungs- und Destabilisierungsphasen dynamischer Familienkonstellationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925587