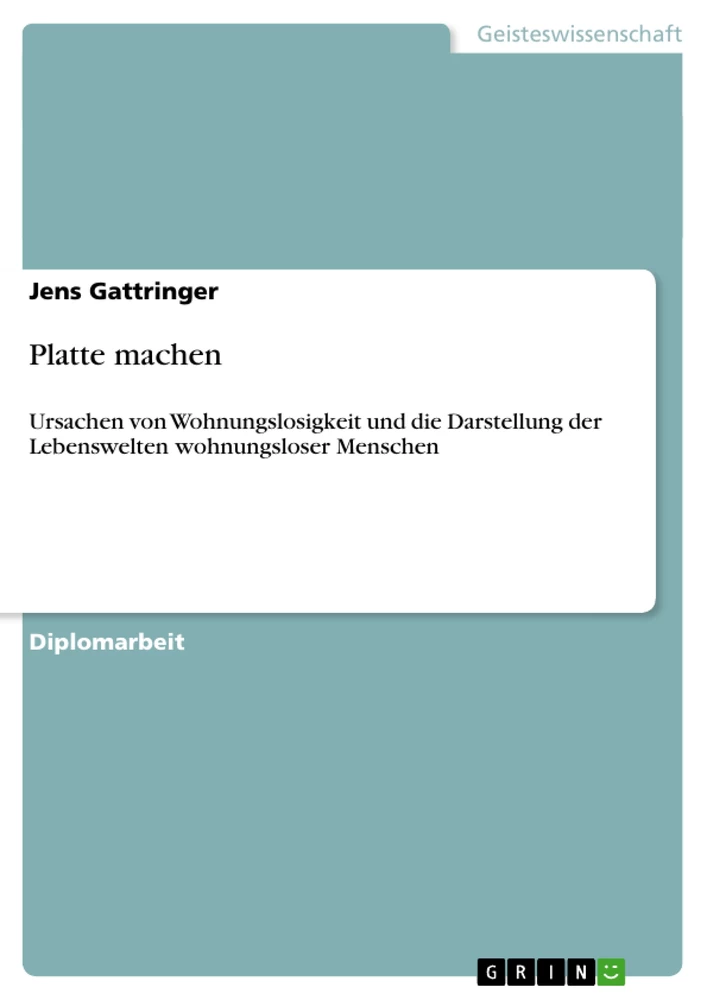Armut gehört heute noch zu den größten ungelösten Problemen in der Gesellschaft. Auch in den wohlhabenden Wohlfahrtsstaaten ist soziale Mindestsicherung nicht für jeden Menschen selbstverständlich und eine gesellschaftliche Ausgrenzung existent. Armut und Reichtum stehen in Kausalität zueinander und beides wird vom Menschen, eingebettet in gesellschaftlichen Strukturen, hervorgerufen. U.a. kann Armut nach dem so genannten Lebenslagenkonzept gemessen werden. Wohlergehen und Zurechtkommen mit entsprechenden materiellen und immateriellen Ressourcen, nach subjektivem Urteil der Betroffenen in ihren individuellen Lebenssituationen, stehen im Vordergrund. So sind z.B. manche Menschen in den Bereichen Arbeit, Gesundheit, Bildung oder Wohnen benachteiligt bzw. ganz ausgeschlossen. Hiermit wird u.a. auf folgende Menschengruppe angespielt: Personen, die über keinen eigenen Wohnsitz verfügen. Diese äußerst prekäre Lebenssituation Betroffener, gehört zur extremsten Form der Armut. Der Anteil der wohnungslosen Menschen die tatsächlich „Platte machen“, ist in den letzten Jahren deutschlandweit wieder deutlich angestiegen. Diese fatale Lebensweise hat verheerende Folgen vor Allem bezogen auf Gesundheit und Leben der Betroffenen. Daraus ergibt sich u.a. folgende Frage: Welche Ursachen und Gründe sind für die Wohnungslosigkeit Betroffener verantwortlich?
Anfangs wird die Einrichtung "Julius-Itzel-Haus" und die dort geleistete Arbeit vorgestellt. Aus dieser Institution konnten die drei später interviewten Klienten gewonnen werden. Außerdem wird in die Theorie des lebensweltlichen Ansatzes nach Hans Thiersch (2002,2005) eingeführt. Es wird vor allem anhand von Mayrings Werken (2002,2003) eine Einführung in die darauf folgende empirische Untersuchung von Langzeitwohnungslosigkeit gegeben. U.a. wird anhand des aktuellen Statistikberichts der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) ein kurzer, statistischer Überblick über die Gründe von Wohnungsverlusten und Auslöser dieser Lage dargestellt. Durch theoretische Erklärungsansätze u.a. durch ein Werk von Stefan Gillich und Frank Nieslony (2000), wird eine mögliche Verursachung von Wohnungslosigkeit und deren denkbare längere Existenz dargelegt. Es werden durch subjektive Interviewaussagen dreier Langzeitwohnungslosen einzelne, ihrer Biografie entsprechenden Einflüsse aufgezeigt, die eine derartige Lebensweise verursachen und festigen können. Am Ende wird dargestellt, wie den Menschen innovativ geholfen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die Wohnungslosenhilfe im Julius-Itzel-Haus Bruchsal
- Die Ambulante Fachberatung für Wohnungslose und ihre Ursprünge
- Entstehung der Begriffe Wohnungslosigkeit, Wohnungslosenhilfe
- Definition einheitlich verwendeter Begriffe
- Der „Lebensweltliche Ansatz“
- Die empirische Untersuchung
- Meine Interviewpartner
- Dieter P.: „(..)wegen einer Wohnung meinen Hund aufgeben?!“
- Andreas O.: „(..)in der Schulzeit habe ich auch schon mitgetrunken!“
- Ralf A.: „(…)obwohl ich eigentlich ein wohl behütetes Kind war, hat sie mich einfach ins Leben geschmissen!“
- Meine Interviewpartner
- Erklärungsversuche, die Wohnungslosigkeit und Verlauf begründen
- Theoretische individuumorientierte Ansätze früherer Studien in der „Nichtsesshaftenhilfe“
- Psychiatrisch-neurologische Erklärungen zur Wohnungslosigkeit
- Der psychologische Ansatz für die Ursachenerklärung von Wohnungslosigkeit
- Moderne, gesellschaftlich-strukturelle Erklärungen für Wohnungslosigkeit nach soziologischen Forschungen
- Ursachenerklärung von Wohnungslosigkeit anhand des Armutsansatzes
- Verdeutlichung des Entstehens und der Aufrechterhaltung von Wohnungslosigkeit anhand des Unterversorgungsansatzes
- Darstellung der Manifestierung von Wohnungslosigkeit anhand des Etikettierungs- bzw. Stigmatisierungsansatzes
- Neuste Erkenntnisse
- Zusammenfassende Darstellung von Anwendbarkeit und Brauchbarkeit der beschriebenen theoretischen Erklärungsansätze
- Theoretische individuumorientierte Ansätze früherer Studien in der „Nichtsesshaftenhilfe“
- Auswertung der subjektiven Interviewaussagen Wohnungsloser
- Zum Anteil der Herkunftsfamilie an der wohnungslosen Lebensweise
- Die Auswirkungen des Verlustes von sozialen Beziehungen auf Betroffene
- Die Verursachung der Wohnungslosigkeit durch entsprechende Beschäftigungsbereiche oder Arbeitslosigkeit
- Krankheiten und Süchte als Einflussfaktoren
- Der Beitrag von Obdachlosenunterkünften zu einer dauerhaften Wohnungslosigkeit
- Die Auswirkungen eines dauerhaften Straßenlebens auf das weitere Leben
- Abriss der Untersuchungsergebnisse und Interpretation
- Zusammenfassung und Reflexion
- Ausblick für die Wohnungslosenhilfe am Beispiel des Julius-Itzel-Hauses
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Ursachen von Wohnungslosigkeit und der Darstellung der Lebenswelten wohnungsloser Menschen. Die Arbeit basiert auf Selbstthematisierungen betroffener Männer und sozialpädagogischen Erfahrungen aus der ambulanten Wohnungslosenhilfe.
- Ursachen von Wohnungslosigkeit
- Lebenswelten wohnungsloser Menschen
- Theorie des lebensweltlichen Ansatzes
- Empirische Untersuchung von Langzeitwohnungslosigkeit
- Soziologische und individuelle Erklärungsansätze für Wohnungslosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Vorstellung der Wohnungslosenhilfe im Julius-Itzel-Haus Bruchsal, insbesondere des ambulanten Bereichs, sowie eine Darstellung der gesetzlichen Grundlagen und Begrifflichkeiten.
- Kapitel 2: Einführung in die empirische Untersuchung von Langzeitwohnungslosigkeit, Darstellung der Methodik und Vorstellung der Interviewpartner.
- Kapitel 3: Darstellung theoretischer Erklärungsansätze für Wohnungslosigkeit, sowohl individuumorientierte Ansätze früherer Studien als auch moderne, gesellschaftlich-strukturelle Erklärungen nach soziologischen Forschungen.
- Kapitel 4: Auswertung der subjektiven Interviewaussagen von drei Langzeitwohnungslosen anhand der zuvor entwickelten Hypothesen.
- Kapitel 5: Zusammenfassung und Reflexion der Ergebnisse der Diplomarbeit.
- Kapitel 6: Ausblick für die Wohnungslosenhilfe am Beispiel des Julius-Itzel-Hauses, mit Fokus auf die Verbesserung der Situation von Menschen in Obdachlosenunterkünften und die Unterstützung bei der Wohnungssuche.
Schlüsselwörter
Wohnungslosigkeit, Langzeitwohnungslosigkeit, Lebenswelt, Lebensweltorientierung, Soziale Arbeit, Ambulante Wohnungslosenhilfe, Empirische Untersuchung, Interviews, Theorien, Soziologie, Armut, Unterversorgung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Obdachlosenunterkünfte, Julius-Itzel-Haus, Bruchsal.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Platte machen“?
„Platte machen“ ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für das Leben auf der Straße ohne festen Wohnsitz, also Obdachlosigkeit im engsten Sinne.
Welche Ursachen führen laut der Arbeit zu Wohnungslosigkeit?
Es werden individuelle Gründe (Süchte, Krankheiten, Verlust sozialer Bindungen) sowie gesellschaftlich-strukturelle Faktoren (Armut, Arbeitslosigkeit, Unterversorgung am Wohnungsmarkt) genannt.
Was ist das Julius-Itzel-Haus?
Eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Bruchsal, die ambulante Fachberatung anbietet und als Basis für die empirische Untersuchung in dieser Arbeit diente.
Was besagt der „lebensweltliche Ansatz“ nach Hans Thiersch?
Dieser Ansatz stellt die individuelle Lebenssituation und das subjektive Urteil der Betroffenen in den Vordergrund, um passgenaue Hilfe innerhalb ihrer sozialen Realität zu ermöglichen.
Wie wirken sich Obdachlosenunterkünfte auf die Langzeitwohnungslosigkeit aus?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Unterkünfte in manchen Fällen zur Manifestierung der Wohnungslosigkeit beitragen können, anstatt den Weg zurück in eigenen Wohnraum effektiv zu ebnen.
- Citation du texte
- Jens Gattringer (Auteur), 2007, Platte machen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92594