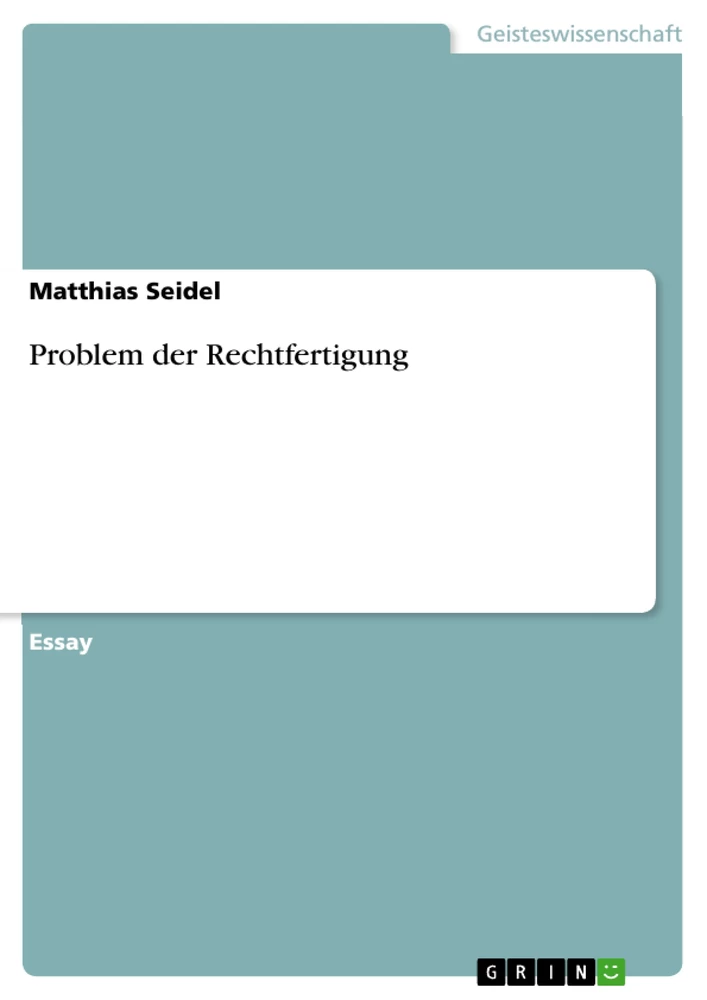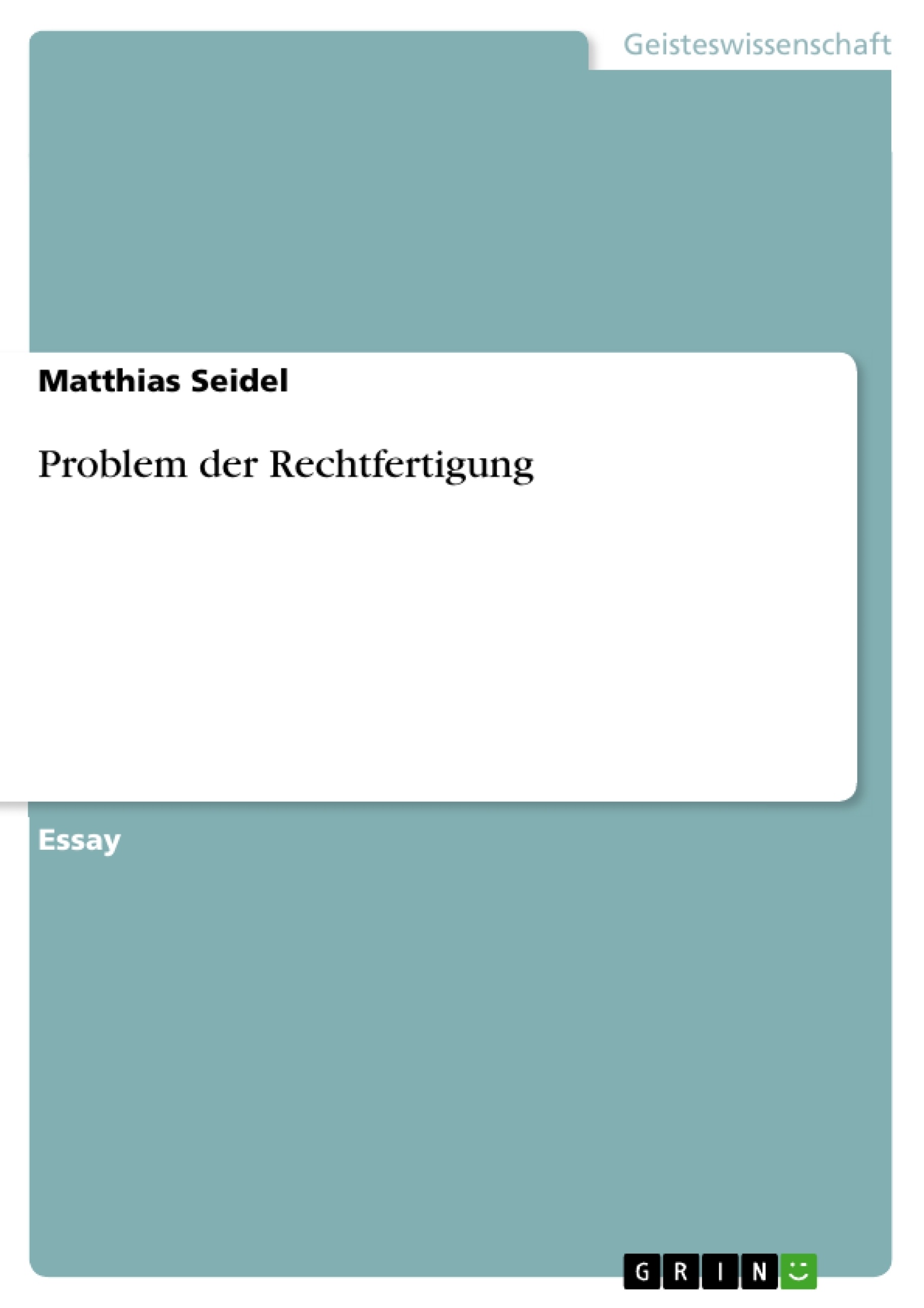Als Edmund Gettier 1963 seinen Aufsatz über die Frage, ob gerechtfertigter wahrer Glaube Wissen ist, veröffentlichte, wusste er noch nicht, welche Auswirkungen dies haben kann. Bis heute werden diese sog. „Gettier-Cases“ diskutiert und es gibt nach wie vor keine anerkannte Auslegung, was denn nun Wissen ist.
In diesem Essay möchte ich einen kurzen Überblick über die Fälle von Gettier geben und anhand dieser aufzeigen, dass der Begriff der Rechtfertigung in der Erkenntnistheorie immer noch mangelhaft ist. Danach möchte ich meine Theorie anführen, wann etwas gerechtfertigt sein kann, um etwas wissen zu können und anhand von Beispielen erläutern. Zum Schluss werde ich noch auf mögliche Kritikpunkte, die mit meiner Theorie aufkommen können, eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Problem der Rechtfertigung
- Gettier-Cases
- Fall 1: Smith und Jones
- Fall 2: Smith, Jones und Brown
- Definition von „Rechtfertigung“
- Vollständigkeit
- Wahrheitsgetreue
- Unanzweifelbare Evidenz
- Kritikpunkte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, ob gerechtfertigter wahrer Glaube Wissen ist. Anhand der von Edmund Gettier eingeführten „Gettier-Cases“ wird die Problematik der Rechtfertigung in der Erkenntnistheorie aufgezeigt. Der Autor stellt seine eigene Definition von „Rechtfertigung“ vor und untersucht die damit verbundenen Kriterien der Vollständigkeit, Wahrheitstreue und Unanzweifelbarkeit. Abschließend werden mögliche Kritikpunkte an der Theorie diskutiert.
- Die Problematik der Rechtfertigung in der Erkenntnistheorie
- Die „Gettier-Cases“ und ihre Bedeutung für die Definition von Wissen
- Eine neue Definition von „Rechtfertigung“
- Die Kriterien der Vollständigkeit, Wahrheitstreue und Unanzweifelbarkeit
- Mögliche Kritikpunkte an der Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Problem der Rechtfertigung
Der Essay beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Rechtfertigung in der Erkenntnistheorie. Der Autor stellt die Frage, ob gerechtfertigter wahrer Glaube Wissen ist und erläutert die „Gettier-Cases“, die diese Frage aufwerfen. Er verdeutlicht, wie die bloße Annahme oder Vermutung nicht ausreichend sind, um Wissen zu begründen.
Gettier-Cases
Die zwei „Gettier-Cases“ werden in diesem Abschnitt detailliert dargestellt. Der Autor analysiert die Fallbeispiele und zeigt auf, wie die Rechtfertigung in den jeweiligen Situationen unzureichend ist, da sie auf bloßen Annahmen und nicht auf gesichertem Wissen basiert. Die Fälle verdeutlichen, dass eine bloße Rechtfertigung alleine nicht ausreicht, um Wissen zu begründen.
Definition von „Rechtfertigung“
Der Autor präsentiert seine eigene Definition von „Rechtfertigung“ als vollständige, wahrheitsgetreue und unanzweifelbare Evidenz. Die einzelnen Kriterien werden anhand von Beispielen erläutert. So wird die Vollständigkeit am Beispiel der „Flüsterpost“ veranschaulicht, während die Wahrheitstreue anhand von Gerichtsverhandlungen und dem Wunsch nach sachlicher Schilderung der Ereignisse erläutert wird.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit zentralen Themen der Erkenntnistheorie, insbesondere mit der Frage nach der Rechtfertigung von Wissen. Zentrale Begriffe sind „Gettier-Cases“, „Rechtfertigung“, „Wissen“, „Vollständigkeit“, „Wahrheitsgetreue“ und „Unanzweifelbarkeit“. Der Essay greift zudem auf klassische Philosophen wie Platon und Galilei Galilei zurück und diskutiert Themen wie Wahrnehmung, Beweisführung und die Rolle der Kirche in der Wissensgeschichte.
- Citar trabajo
- Matthias Seidel (Autor), 2008, Problem der Rechtfertigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93102