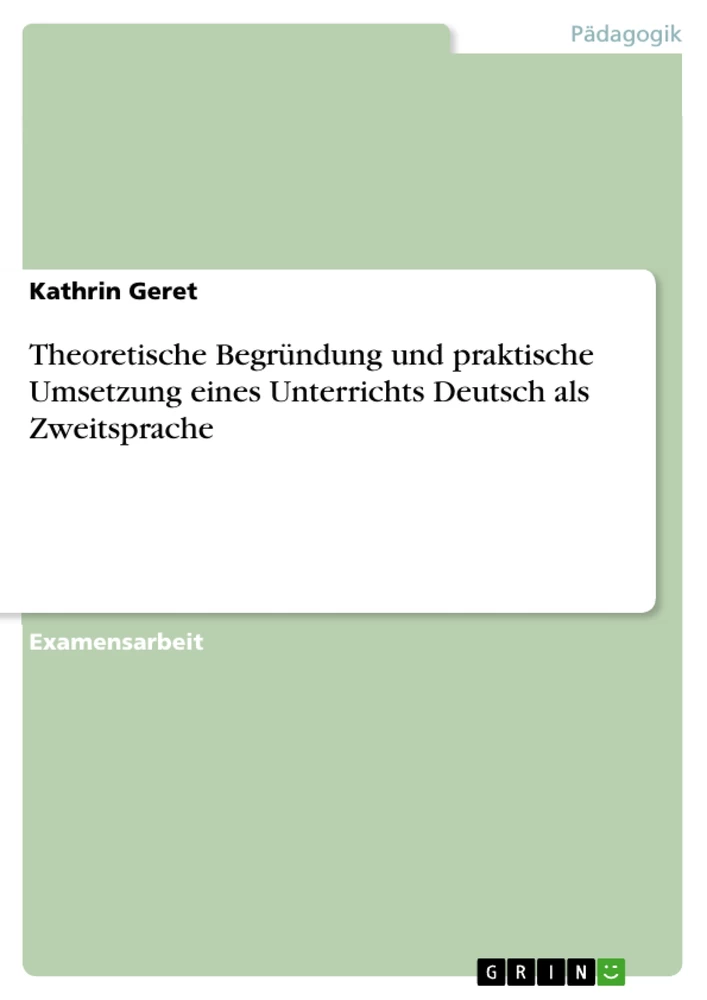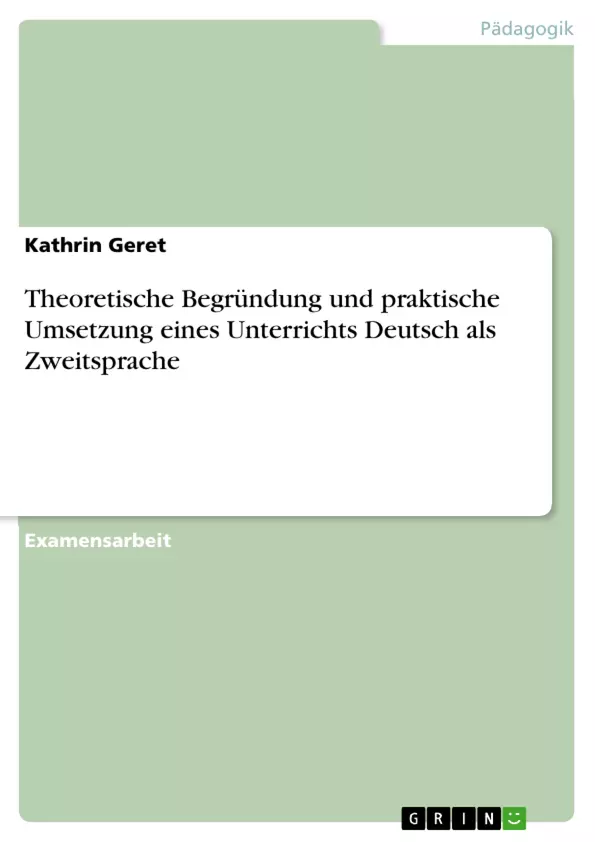Zafer Şenocak - 1961 in Ankara geboren, in Istanbul und München aufgewachsen – bringt in seinem Gedicht „Flammentropfen“ das „Dilemma“ der Mehrsprachigkeit zur Sprache. Mehrsprachigkeit wird nicht selten als negative Erfahrung, die mit dem „Gefühl der Zerrissenheit, der Bedrohung, des Wanderns zwischen den Welten und des Traumes der Rückkehr“ , verstanden. Viele Autoren – vor allem der ersten Migrantengeneration – stellen ihre Erfahrungen mit der Zweitsprache als problematisch dar, dessen Erwerb als Zwang, um das Überleben zu sicheren. Zweisprachigkeit als Verlust der „eigentlichen“ Identität , deren Grenze mitten durch die Zunge verläuft. „Und obwohl im Laufe der Zeit sich nicht nur das Selbstverständnis deutsch schreibender Autoren nichtdeutscher Herkunft sehr verändert hat […], behält das Thema Identität für die ,Migrantenliteratur‘ […] [weiterhin eine] übergeordnete Bedeutung […].“
Doch „demographisch betrachtet ist Mehrsprachigkeit keine Ausnahme sondern Normalität, d.h. im Grunde ist der einsprachige Mensch eine Ausnahme. Überhaupt ist aus sprachwissenschaftlicher Perspektive Einsprachigkeit eigentlich eine Fiktion. Die deutschsprachigen Muttersprachler unter uns beherrschen nicht nur eine Variante des Deutschen; viele von uns sprechen mehrere Dialekte und verfügen über unterschiedliche Stile und fachsprachliche Ressourcen, in Abhängigkeit von Interessen, Bildungswegen und Berufen.“
So darf die vorrangige Frage nicht mehr lauten, ob es überhaupt möglich ist in mehr als einer Sprache zu leben , sondern eher warum es so schwer ist in einem anderen Land zu leben und dabei gleiche Chancen auf einen qualifizierten Schulabschluss zu erhalten und die Möglichkeit zu haben gut ausgerüstet ins Berufsleben starten zu können.
„Es ist seit Jahren bekannt, ohne dass dies bislang beunruhigte, dass Migrantenkinder schulisch überdurchschnittlich erfolglos sind“ : Vor allem 15-jährige Jugendliche mit türkischem Hintergrund besuchen am häufigsten eine Hauptschule, während Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund in der Regel die Realschule oder das Gymnasium besuchen. Was sich wiederum in einer starken Unterrepräsentanz der Migranten unter der Gesamtheit aller Studienberechtigten abzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Zweitspracherwerb – Theoretische und Didaktische Überlegungen
- 2.1. Zweitsprachentheorien
- 2.1.6 Grundgrößen des Zweitspracherwerbs
- 2.1.6.1 Der Antrieb
- 2.1.6.2 Das Sprachvermögen
- 2.1.6.2.1 Biologische Determinanten
- 2.1.6.2.2 Das verfügbare Wissen
- 2.1.6.3 Der Zugang
- 2.1.6.4 Kennzeichen des Spracherwerbsprozesses
- 2.1.7 Der gesteuerte und ungesteuerte Zweitspracherwerb
- 2.1.8 Didaktisch – methodische Konsequenzen für den Zweitsprachenunterricht
- 3. Ausgewählte Tests zur Diagnose von Schulleistungen
- 3.1 Der Hamburger Schulleistungstest (HST)
- 3.2 Fehleranalyse von freien Texten
- 4. Die praktische Umsetzung
- 4.1 Die Individuallage meiner Förderschüler
- 4.2 Kontrastive Sprachbetrachtung Türkisch – Deutsch
- 4.3 Durchführung und Auswertung des HST 4/5 (Form A) und der freien Texte meiner Förderschüler
- 4.4 Fragestellungen und Hypothesen
- 4.5 Mein Förderkonzept
- 4.6 Konkrete Beispiele pädagogischen Handelns
- 4.7 Durchführung und Auswertung des HST 4/5 (Form B) und der freien Texte meiner Förderschüler
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die theoretischen Grundlagen des Zweitspracherwerbs und deren praktische Umsetzung im Deutschunterricht für Schüler mit Türkisch als Muttersprache. Ziel ist die Entwicklung eines individuellen Förderkonzeptes, das den spezifischen Herausforderungen dieser Lerngruppe gerecht wird.
- Theorien des Zweitspracherwerbs
- Diagnostik von Schulleistungen im DaZ-Unterricht
- Kontrastive Analyse von Türkisch und Deutsch
- Entwicklung und Evaluation eines individuellen Förderkonzepts
- Einfluss der Sprachförderung auf den Lernerfolg in anderen Fächern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Zweitspracherwerbs bei Migrantenkindern ein und thematisiert die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit im Kontext von Bildung und Integration. Sie verweist auf die Diskrepanz zwischen der demografischen Realität der Mehrsprachigkeit und den schulischen Schwierigkeiten von Migrantenkindern, insbesondere im Hinblick auf den Erwerb der deutschen Sprache. Das Projekt „Integration durch Bildung“ wird vorgestellt als ein Ansatz zur Förderung von Chancengleichheit.
2. Der Zweitspracherwerb – Theoretische und Didaktische Überlegungen: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Zweitsprachentheorien (Schwellenniveau- und Interdependenzhypothese, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguagehypothese) und diskutiert deren Relevanz für den DaZ-Unterricht. Es werden wichtige Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb analysiert, wie z.B. der Antrieb (Motivation), das Sprachvermögen (biologische und kognitive Voraussetzungen) und der Zugang (Input und Kommunikationsmöglichkeiten). Der Unterschied zwischen gesteuertem und ungesteuertem Zweitspracherwerb wird erläutert, und es werden didaktisch-methodische Konsequenzen für den Unterricht abgeleitet.
3. Ausgewählte Tests zur Diagnose von Schulleistungen: Dieses Kapitel beschreibt den Hamburger Schulleistungstest (HST) als ein Instrument zur quantitativen Diagnose von Schulleistungen in verschiedenen Bereichen (Sprachverständnis, Leseverständnis, Informationsentnahme, Mathematik). Die Grenzen des HST im Bereich Rechtschreibung werden aufgezeigt, und ein informelles Diagnoseverfahren anhand von freien Texten und dem Kategorienschema nach Annegret von Wedel-Wolff wird vorgestellt.
4. Die praktische Umsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung des Förderkonzepts mit einer Gruppe von fünf Förderschülern mit türkischem Migrationshintergrund. Es umfasst eine kontrastive Sprachbetrachtung von Türkisch und Deutsch, die Durchführung und Auswertung des HST, die Analyse von freien Schülertexten, die Formulierung von Fragestellungen und Hypothesen, die Darstellung des Förderkonzepts, und die Präsentation von konkreten Beispielen aus dem Unterricht. Die Ergebnisse werden diskutiert und die Hypothesen überprüft.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Migrantenkinder, Mehrsprachigkeit, Interferenz, Förderunterricht, Diagnostik, Hamburger Schulleistungstest (HST), Fehleranalyse, kontrastive Linguistik, individuelles Förderkonzept, Integration durch Bildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zweitspracherwerb von Schülern mit Türkisch als Muttersprache im Deutschunterricht. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung eines individuellen Förderkonzepts, das auf theoretischen Grundlagen des Zweitspracherwerbs basiert und die spezifischen Herausforderungen dieser Lerngruppe berücksichtigt.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Zweitsprachentheorien (z.B. Schwellenniveau- und Interdependenzhypothese, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguagehypothese) und analysiert Einflussfaktoren wie Motivation, Sprachvermögen und Zugang zum Input. Der Unterschied zwischen gesteuertem und ungesteuertem Zweitspracherwerb wird ebenfalls erläutert.
Welche diagnostischen Instrumente werden eingesetzt?
Die Diagnostik der Schulleistungen erfolgt mittels des Hamburger Schulleistungstests (HST) und der Fehleranalyse von freien Schülertexten nach einem Kategorienschema (Annegret von Wedel-Wolff). Die Grenzen des HST, insbesondere im Bereich Rechtschreibung, werden kritisch betrachtet.
Wie wird das individuelle Förderkonzept umgesetzt?
Das Förderkonzept wird in der Praxis mit fünf Förderschülern mit türkischem Migrationshintergrund umgesetzt. Es beinhaltet eine kontrastive Sprachbetrachtung von Türkisch und Deutsch, die Durchführung und Auswertung des HST und der freien Texte, die Formulierung und Überprüfung von Hypothesen sowie die Präsentation konkreter Beispiele aus dem Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische und didaktische Überlegungen zum Zweitspracherwerb, Ausgewählte Tests zur Diagnose von Schulleistungen, Praktische Umsetzung des Förderkonzepts und Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Migrantenkinder, Mehrsprachigkeit, Interferenz, Förderunterricht, Diagnostik, Hamburger Schulleistungstest (HST), Fehleranalyse, kontrastive Linguistik, individuelles Förderkonzept und Integration durch Bildung.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Entwicklung und Evaluation eines individuellen Förderkonzepts für Schüler mit Türkisch als Muttersprache, das ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht wird und ihren Lernerfolg im Deutschunterricht und in anderen Fächern positiv beeinflusst.
Welche methodischen Ansätze werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Auseinandersetzung mit empirischen Daten, die durch die Durchführung und Auswertung des HST und die Analyse von Schülertexten gewonnen werden. Es handelt sich um eine qualitative und quantitative Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Geret (Autor:in), 2007, Theoretische Begründung und praktische Umsetzung eines Unterrichts Deutsch als Zweitsprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93228