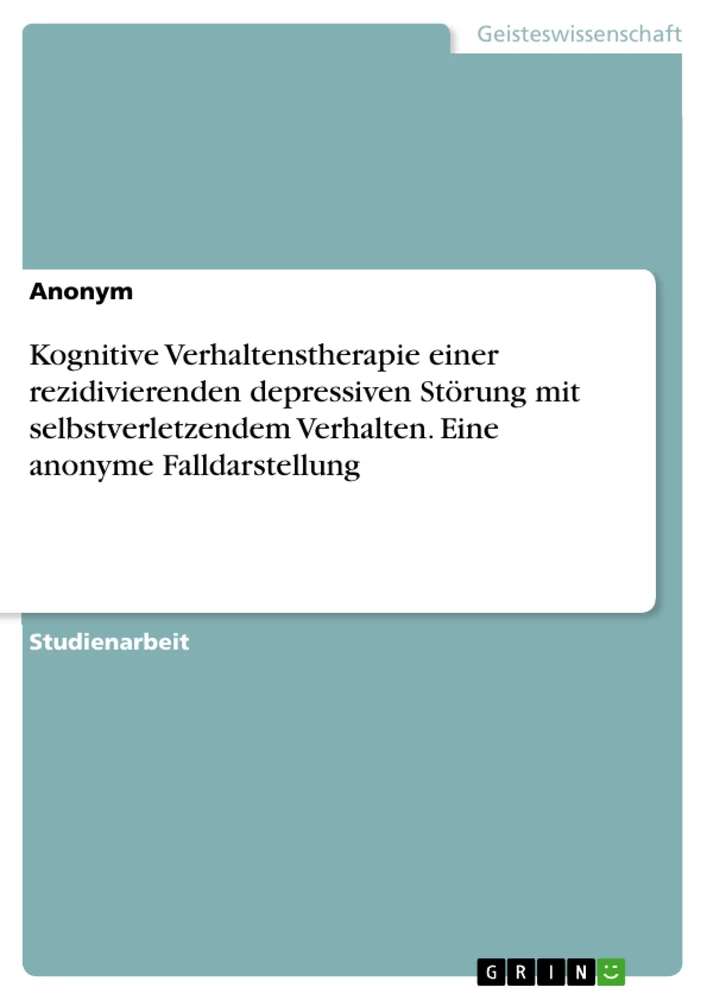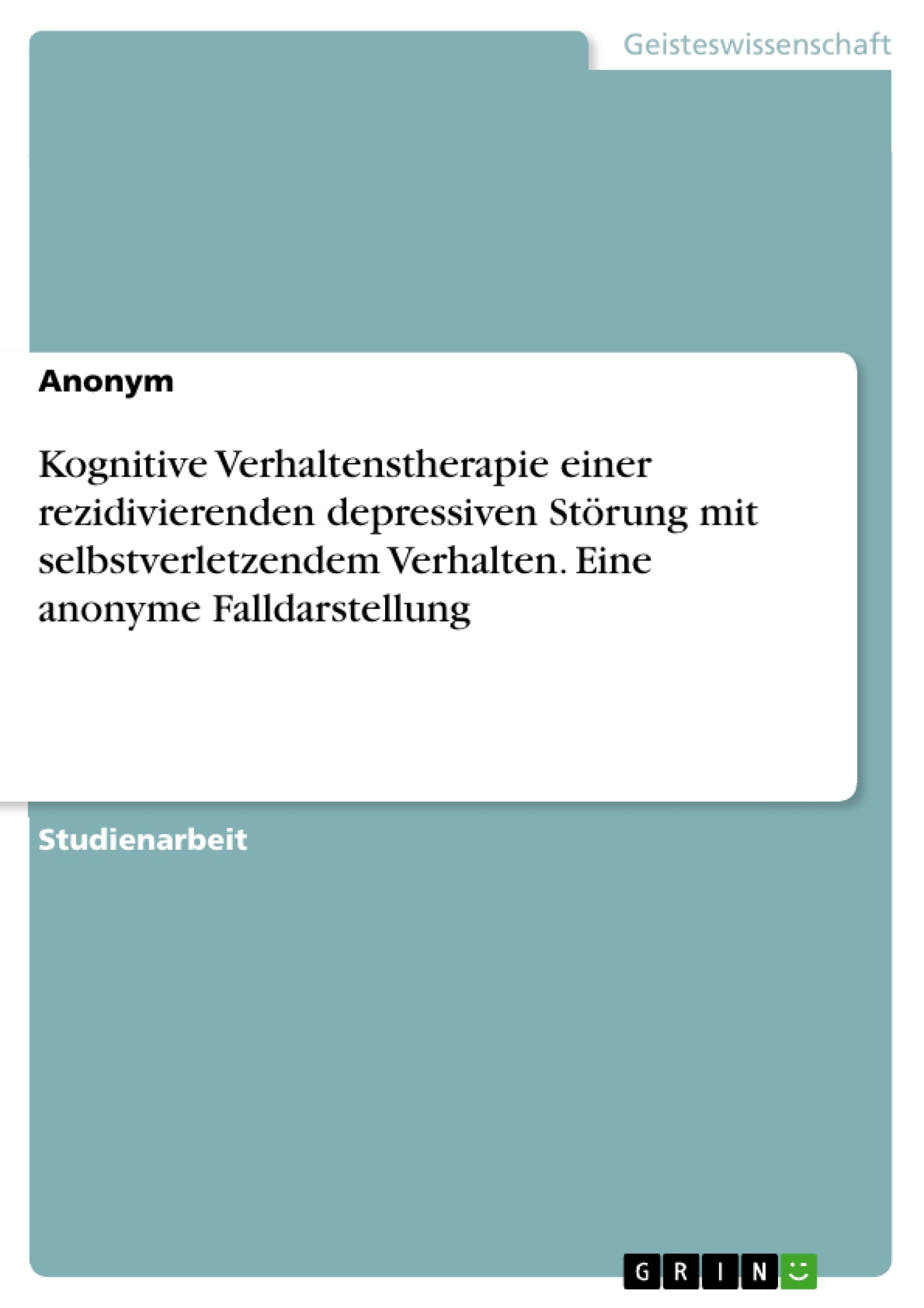Der anonyme Fallbericht beschreibt die stationäre, ganztägig ambulante sowie die ambulante Langzeittherapie einer zu Behandlungsbeginn 18-jährigen Patientin mit der Diagnose einer rezidivierenden depressiven Störung, gegenwärtig eine schwere Episode ohne psychotische Symptome. Es wurde eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung der Depression durchgeführt. Gegen Behandlungsende konnte eine Remission der depressiven Symptome und eine signifikante Verbesserung der Handlungskompetenz, der allgemeinen Lebenszufriedenheit und des psychophysischen Gesamtbefindens erreicht werden.
Bei Antritt der stationären Behandlung berichtet Frau S., dass sie überhaupt nicht mehr belastbar sei und ihren Alltag nicht mehr ausreichend bewältigen könne. Sie leide unter einer stark depressiven Stimmung und breche bei jeder Gelegenheit plötzlich in Tränen aus. Die meiste Zeit des Tages verbringe sie in ihrem Bett. Insbesondere am Morgen wache sie häufig viel zu früh auf und fühle sich sehr erschöpft. Dies habe dazu geführt, dass ihr gesamter Tag-Nacht-Rhythmus durcheinandergeraten sei. Sie könne sich zu nichts mehr aufraffen, leide unter Kopfschmerzen, innerer Leere und starker Antriebslosigkeit. Gleichzeitig verspüre sie eine nahezu „unerträgliche“ innere Unruhe und innere Anspannung. Ihre Beschwerden, die sich außerdem in Form von ausgeprägter Freud- und Hoffnungslosigkeit, gesteigertem Appetit, starken Konzentrationsschwierigkeiten, Insuffizienzerleben und Unentschlossenheit äußern würden, hätten sich in den letzten sechs Monaten fortschreitend verschlechtert. Sie sei überzeugt, eine „überflüssige Versagerin“ zu sein und mache sich große Vorwürfe, das Abitur abgebrochen zu haben. Früher habe sie gerne Sport gemacht und Zeit mit Freunden verbracht. Nichts davon würde ihr noch Spaß bereiten.
Inhaltsverzeichnis
- Überweisungskontext
- Diagnostik und Indikationsstellung
- Aktuelle Anamnese
- Sozialanamnese, Familienanamnese, Schulanamnese
- Problemanalyse
- Therapieplanung
- Therapieverlauf
- Evaluation
- Kritische Reflektion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die psychische Verfassung der Patientin Frau S. im Rahmen eines stationären und anschließend teilstationären Akutbehandlungssettings zu beleuchten. Dabei werden die Überweisungskontexte, die Diagnostik und Indikationsstellung sowie die relevanten Anamnesedaten (aktuelle, soziale, familiäre, schulische) detailliert dargestellt.
- Depressive Symptomatik und Suizidgedanken
- Negative Beziehungserfahrungen in der Familie
- Verhaltensprobleme und familiäre Konflikte
- Selbstschädigung und emotionale Instabilität
- Mögliche Auslöser und die Rolle der Umgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt den Überweisungskontext von Frau S. in die stationäre psychosomatische Akutbehandlung. Es werden die relevanten medizinischen Vorgeschichte und der Verlauf der Behandlung dargestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Diagnostik und Indikationsstellung. Dabei werden die aktuellen Beschwerden der Patientin im Detail beschrieben, sowie die relevante Anamnese aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Problemanalyse. Hier werden die Hintergründe und Zusammenhänge der psychischen Beschwerden der Patientin im Kontext der familiären Situation und ihrer eigenen Lebensgeschichte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Depression, Suizidgedanken, Selbstverletzung, familiäre Belastung, negative Beziehungserfahrungen, affektive Beschwerden, und psychosomatische Akutbehandlung. Die Arbeit konzentriert sich auf den Fall von Frau S. und beleuchtet ihre psychische Verfassung und die Zusammenhänge zwischen ihrer emotionalen Instabilität und ihren sozialen und familiären Lebensumständen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Kognitive Verhaltenstherapie einer rezidivierenden depressiven Störung mit selbstverletzendem Verhalten. Eine anonyme Falldarstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935486