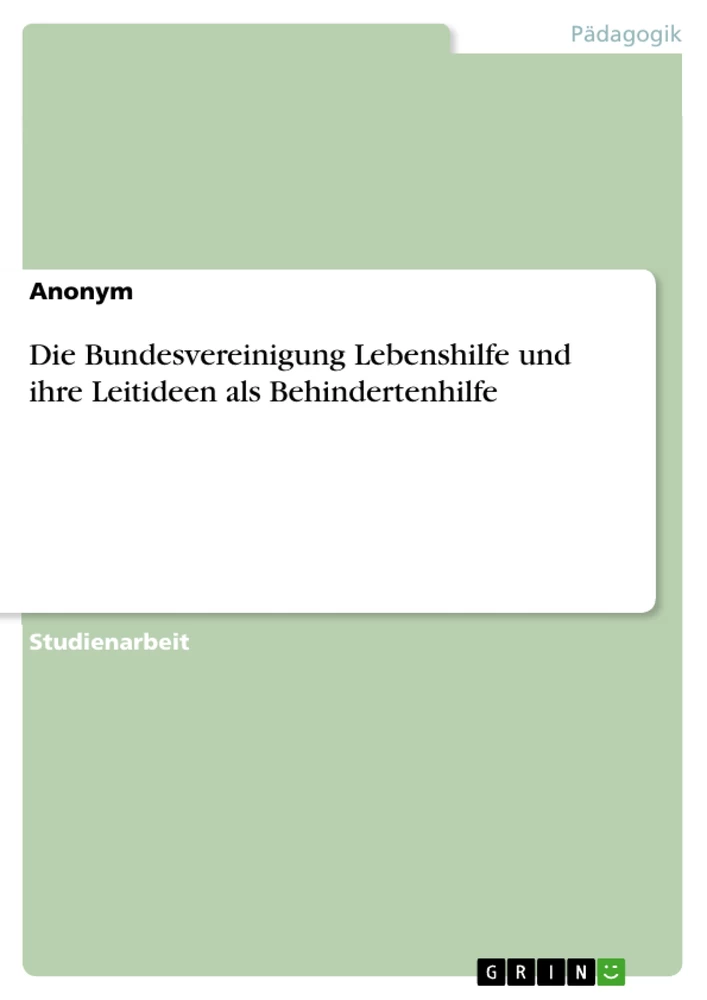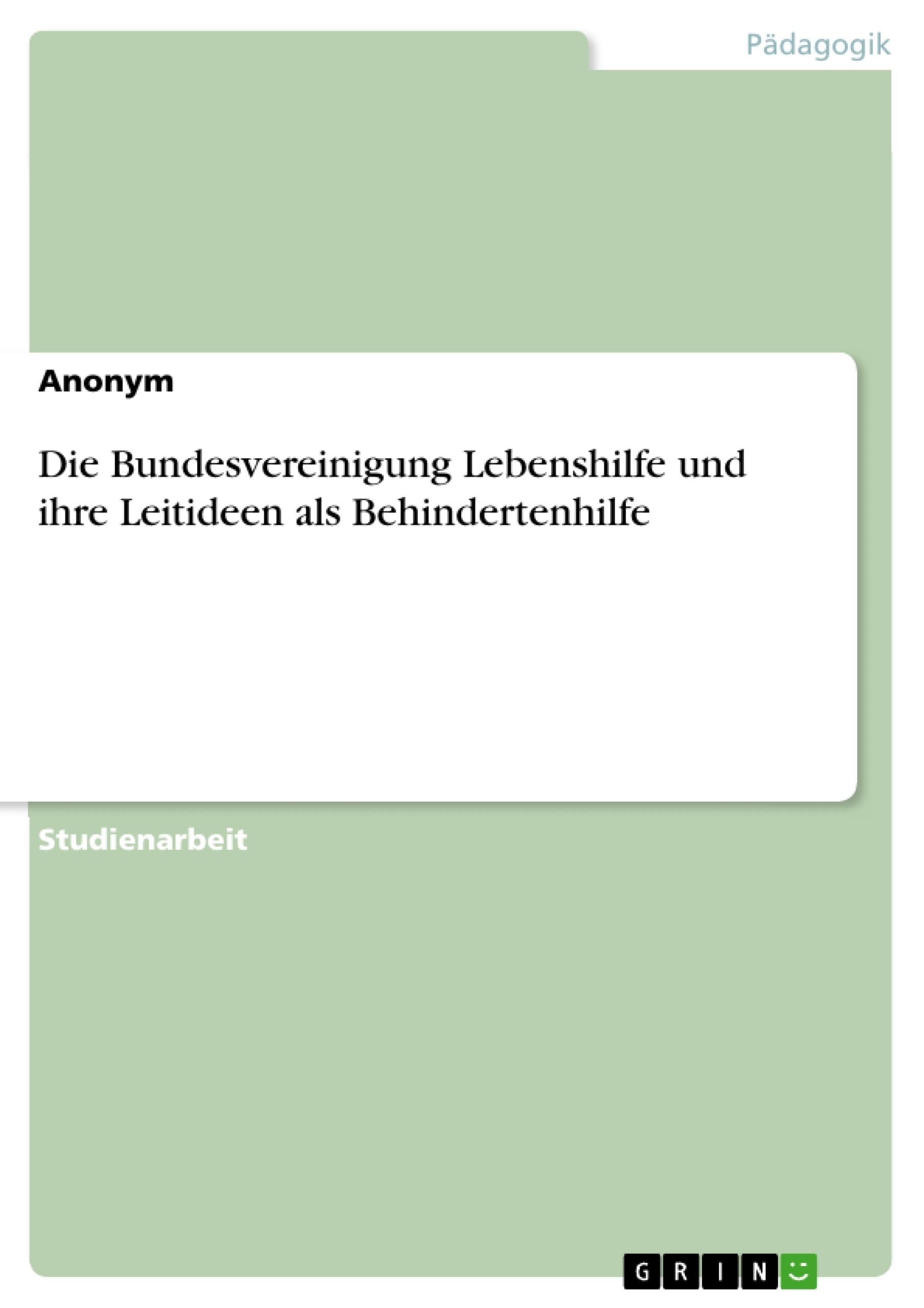Wie setzt die Bundesvereinigung Lebenshilfe Formate wie das Normalisierungsprinzip oder die Selbstbestimmung um? Schafft Sie mit ihren Leitideen dem gesellschaftlichen Auftrag der Behindertenhilfe gerecht zu werden? Diesen Frage möchte der Autor in der Arbeit nachgehen.
In der Arbeit wird zunächst versucht auf die Definition der geistigen Behinderung einzugehen. Dabei wird besonders Bezug auf den Wandel des Begriffes genommen. Daraufhin wird das Thema der Bundesvereinigung Lebenshilfe behandelt. Hierzu werden die historischen Entwicklungen sowie die Grundhaltung und Ziele dargestellt. Im Anschluss wird auf das Prinzip der Normalisierung eingegangen. Weiterführend im Kapitel wird ebenso die Bedeutung der Inklusion und Teilhabe sowie die Begriffe Empowerment und Selbstbestimmung behandelt. Im letzten Kapitel beurteilt die Arbeit, ob die Lebenshilfe mit Hilfe ihrer Leitideen und Prinzipien, welche im vorherigen Kapitel dargestellt wurden, dem heutigen Auftrag der Behindertenhilfe gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von geistiger Behinderung
- Lebenshilfe allgemein
- Geschichtliche Entwicklung
- Grundhaltung und Ziele
- Leitideen der Behindertenhilfe
- Normalisierungsprinzip
- Inklusion und Teilhabe
- Empowerment und Selbstbestimmung
- Die Leitideen der Lebenshilfe als Behindertenhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe und ihren Leitideen im Kontext der Behindertenhilfe. Ziel ist es, die Rolle der Lebenshilfe in der Förderung und Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung zu analysieren und die Wirksamkeit ihrer Leitideen in Bezug auf den gesellschaftlichen Auftrag der Behindertenhilfe zu beurteilen.
- Definition und Wandel des Begriffs der geistigen Behinderung
- Historische Entwicklung und Grundprinzipien der Lebenshilfe
- Leitideen der Behindertenhilfe, insbesondere Normalisierung, Inklusion, Teilhabe, Empowerment und Selbstbestimmung
- Bewertung der Leitideen der Lebenshilfe im Hinblick auf ihren Beitrag zur Inklusion und Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Analyse der Rolle der Lebenshilfe in der aktuellen Behindertenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der geistigen Behinderung ein und zeigt die Relevanz der Lebenshilfe in diesem Kontext auf. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der geistigen Behinderung definiert, wobei der Wandel des Begriffs und seine gesellschaftliche Bedeutung im Fokus stehen. Kapitel drei beleuchtet die Lebenshilfe als Elternvereinigung mit ihrem historischen Hintergrund, ihrer Grundhaltung und ihren Zielen. Die Leitideen der Behindertenhilfe, wie das Normalisierungsprinzip, Inklusion, Teilhabe, Empowerment und Selbstbestimmung, werden im vierten Kapitel umfassend erläutert. Der fünfte Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung dieser Leitideen durch die Lebenshilfe und bewertet deren Wirksamkeit im Hinblick auf den heutigen Auftrag der Behindertenhilfe.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Hausarbeit sind geistige Behinderung, Behindertenhilfe, Lebenshilfe, Normalisierung, Inklusion, Teilhabe, Empowerment, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Auftrag, Förderung, Unterstützung, Integration, und Inklusionspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Bundesvereinigung Lebenshilfe?
Die Lebenshilfe setzt sich als Elternvereinigung für die Förderung, Unterstützung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien ein.
Was versteht man unter dem Normalisierungsprinzip?
Es besagt, dass Menschen mit Behinderung ein Leben führen können sollten, das dem Alltag von Menschen ohne Behinderung so weit wie möglich entspricht (z. B. Trennung von Wohn- und Arbeitsraum).
Was bedeuten Empowerment und Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe?
Empowerment zielt darauf ab, Menschen mit Behinderung zu befähigen, ihre eigenen Interessen zu vertreten und ihr Leben nach eigenen Vorstellungen autonom zu gestalten.
Wie hat sich der Begriff der geistigen Behinderung gewandelt?
Der Begriff hat sich von einer rein medizinisch-defizitorientierten Betrachtung hin zu einem sozialen Verständnis entwickelt, das die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt betont.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Während Integration Menschen in ein bestehendes System eingliedert, fordert Inklusion, dass sich das System von vornherein so gestaltet, dass jeder Mensch gleichberechtigt teilhaben kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Bundesvereinigung Lebenshilfe und ihre Leitideen als Behindertenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941672