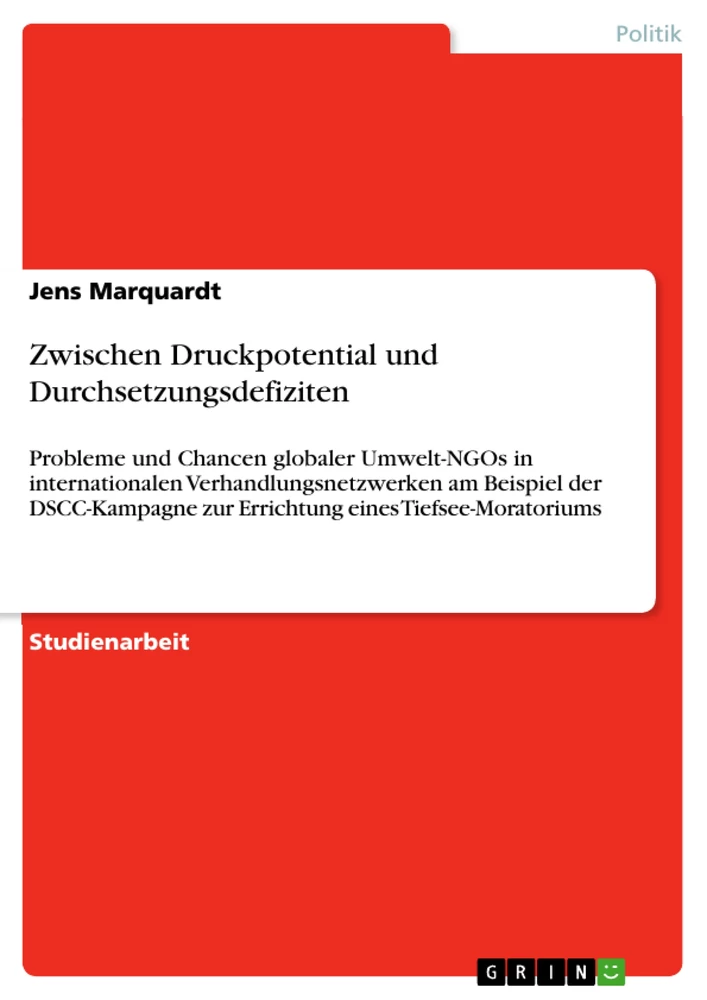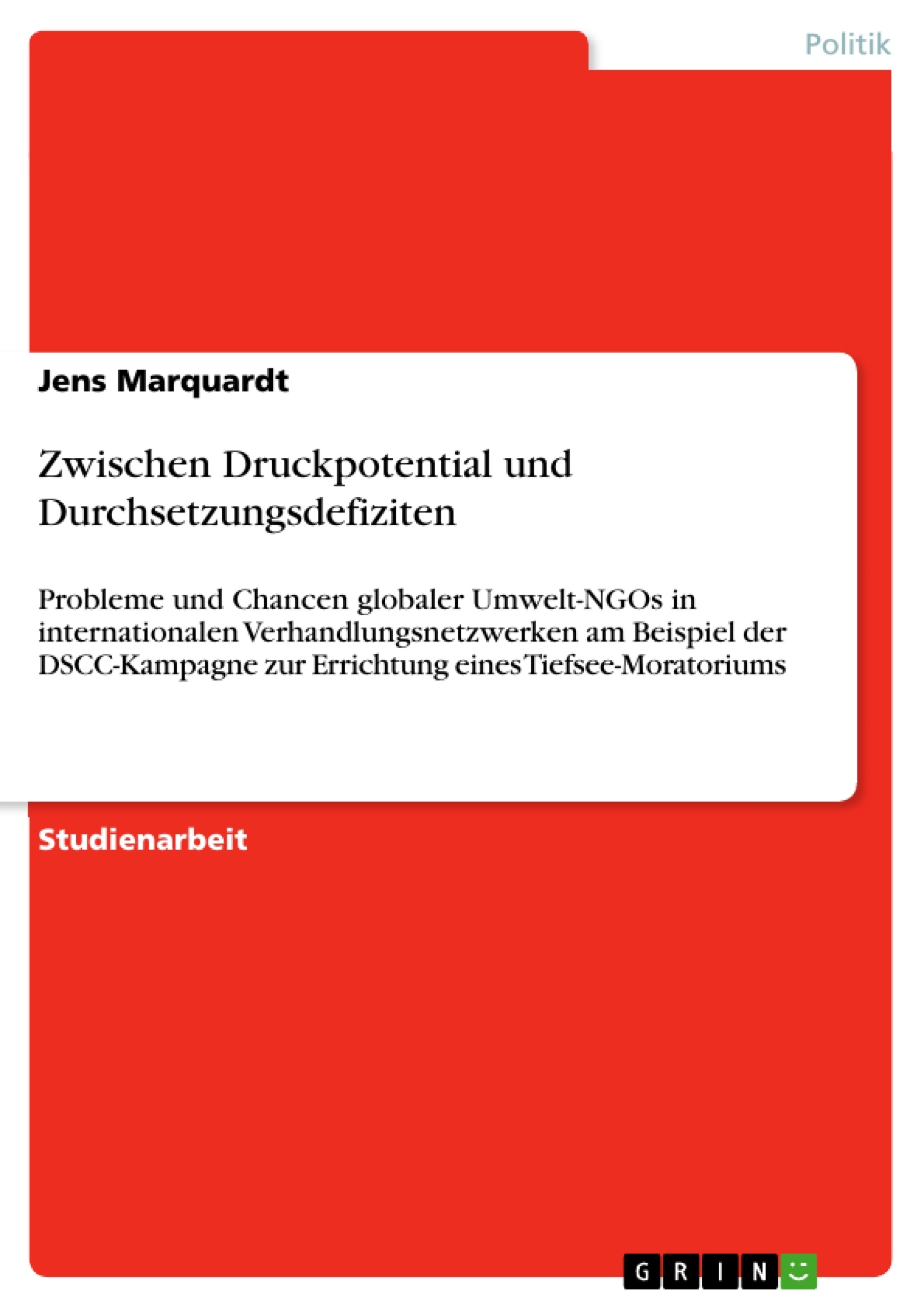Die ökonomische Globalisierung hat im internationalen System zu Defiziten vor allem im Bereich gesetzlicher Regulierung geführt. Gleichzeitig erscheint es gerade in Hinblick auf die sich daraus ergebenden globalen Umweltprobleme notwendig, auch auf politischer Ebene einen Prozess der Globalisierung im Bereich der Governance zu initiieren, um zu wirkungsvollen Lösungen grenzüberschreitender Phänomene zu gelangen.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Chancen nichtstaatliche Akteure im Mächtegefüge globalisierter Umweltpolitik heute spielen, wie sie arbeiten, welchen Herausforderungen und Problemen sie sich dabei zu stellen haben und inwieweit sich daraus Prognosen für die Zukunft ableiten lassen.
Mit Hilfe eines Fallbeispiels sollen Rückschlüsse auf der Ebene der globalen Umweltpolitik gezogen werden. Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Betrachtung der DSCC und ihrem Bemühen zur Errichtung eines weltweiten Tiefseemoratoriums für die Rolle von NGOs im internationalen Meeresschutz und damit auf die Chancen und Risiken der Globalisierung der Umweltpolitik ziehen?
Daraus ergeben sich zwei geradezu diametral entgegenstehende Thesen, die es zu erörtern gilt. Erstens: Die Chancen zur Einflussnahme auf Entscheidungen staatlicher Akteure bleiben marginal, da NGOs im Mächtegefüge globaler Umweltpolitik mit einem strukturellen Durchsetzungsdefizit zu kämpfen haben. Zweitens: NGOs sind durchaus dazu in der Lage, etwa durch öffentliche Kampagnen effektiv Einfluss auf der Ebene globaler Umweltpolitik
auszuüben.
Zentrale Begriffe (NGO, internationale Umweltpolitik, Globalisierung, DSCC) werden für den Sachverhalt zunächst kurz definiert. Im ersten Teil soll es dann noch in allgemeiner Form mit den Chancen und Risiken der Globalisierung der Umweltpolitik gehen.
In einem zweiten Schritt wird es dann darum gehen, das gewählte Beispiel, den
Zusammenschluss international operierender NGOs in der Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) genauer zu analysieren, um zu einer schlüssigen Argumentation bezüglich der ambivalenten Thesen zu gelangen. Wie realistisch erscheint das Erreichen des Ziels zur Errichtung eines Tiefseemoratoriums auf Basis der gefundenen Ergebnisse?
Die abstrakten Risiken und Chancen der Globalisierung mit dem konkreten Beispiel zu vergleichen und die hier aufgeworfenen Fragen kritisch zu beantworten, ist die Aufgabe der abschließenden Konklusion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemdefinition und Fragestellung
- Aufbau, Methode und Ziel der Arbeit
- Hauptteil
- Hintergrund: Umweltpolitik und Globalisierung
- Chancen globaler Umweltpolitik
- Risiken der Globalisierung
- NGOs im Beziehungsgefüge globaler Umweltpolitik
- Druckpotentiale und Durchsetzungsdefizite
- NGOs in internationalen Verhandlungen
- Einbindung von NGOs in die Vereinten Nationen
- Die Deep Sea Conservation Coalition
- Hintergrund, Organisation, Vorgehen
- Einbindung in die Vereinten Nationen
- Durchsetzungsdefizite und Druckpotentiale
- Hintergrund: Umweltpolitik und Globalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Rolle von nichtstaatlichen Akteuren (NGOs) im Kontext der globalisierten Umweltpolitik. Ihr zentrales Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen des Einflusses von NGOs in internationalen Verhandlungen zu erforschen, insbesondere am Beispiel der Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) und deren Bemühungen um ein weltweites Tiefseemoratorium.
- Die Chancen und Risiken der Globalisierung für die Umweltpolitik
- Die Rolle von NGOs im Beziehungsgefüge globaler Umweltpolitik
- Die Herausforderungen und Probleme, denen NGOs in internationalen Verhandlungen begegnen
- Die Druckpotentiale und Durchsetzungsdefizite von NGOs in der globalisierten Umweltpolitik
- Die spezifische Situation der DSCC und ihre Bemühungen um ein Tiefseemoratorium
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Hausarbeit stellt das zentrale Thema der Arbeit dar: die Rolle von NGOs in internationalen Verhandlungen im Kontext der globalisierten Umweltpolitik. Sie definiert den Forschungsgegenstand, formuliert die Fragestellung und skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Hintergrund der Umweltpolitik und Globalisierung, analysiert die Rolle von NGOs im Beziehungsgefüge globaler Umweltpolitik und beleuchtet die DSCC als konkretes Fallbeispiel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen globale Umweltpolitik, NGOs, Internationales Verhandlungsnetzwerk, Globalisierung, Tiefsee-Moratorium und DSCC. Sie untersucht die Chancen und Risiken der Globalisierung für die Umweltpolitik und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Einflusses von NGOs in internationalen Verhandlungsprozessen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen NGOs in der globalen Umweltpolitik?
NGOs fungieren als Druckmittel, Experten und Beobachter, die staatliche Akteure zu ökologischem Handeln bewegen wollen.
Was ist die Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)?
Ein Zusammenschluss internationaler NGOs, der sich für ein weltweites Moratorium der Tiefseefischerei zum Schutz der Meere einsetzt.
Was versteht man unter dem „Durchsetzungsdefizit“ von NGOs?
Trotz hohem moralischen Druck fehlen NGOs oft formale Machtbefugnisse, um völkerrechtlich bindende Entscheidungen allein durchzusetzen.
Wie beeinflussen NGOs die Vereinten Nationen?
Sie werden in internationale Verhandlungen eingebunden und nutzen öffentliche Kampagnen, um Themen auf die politische Agenda der UN zu setzen.
Welche Chancen bietet die Globalisierung für den Umweltschutz?
Sie ermöglicht die weltweite Vernetzung von Aktivisten und die Etablierung globaler Standards für grenzüberschreitende Umweltprobleme.
- Citar trabajo
- Jens Marquardt (Autor), 2007, Zwischen Druckpotential und Durchsetzungsdefiziten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94212