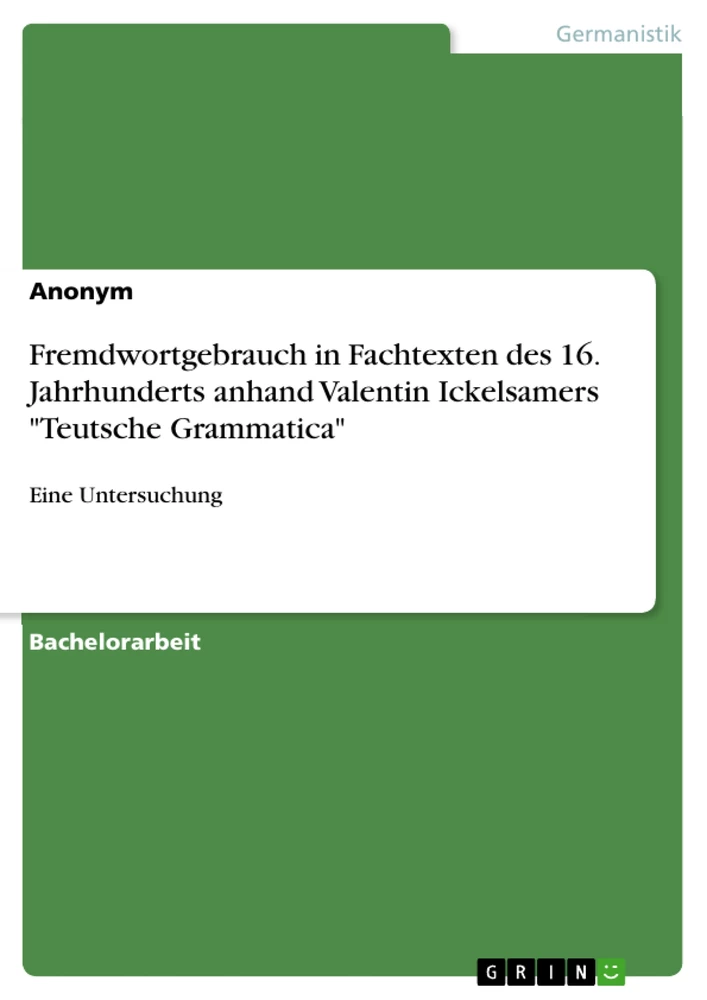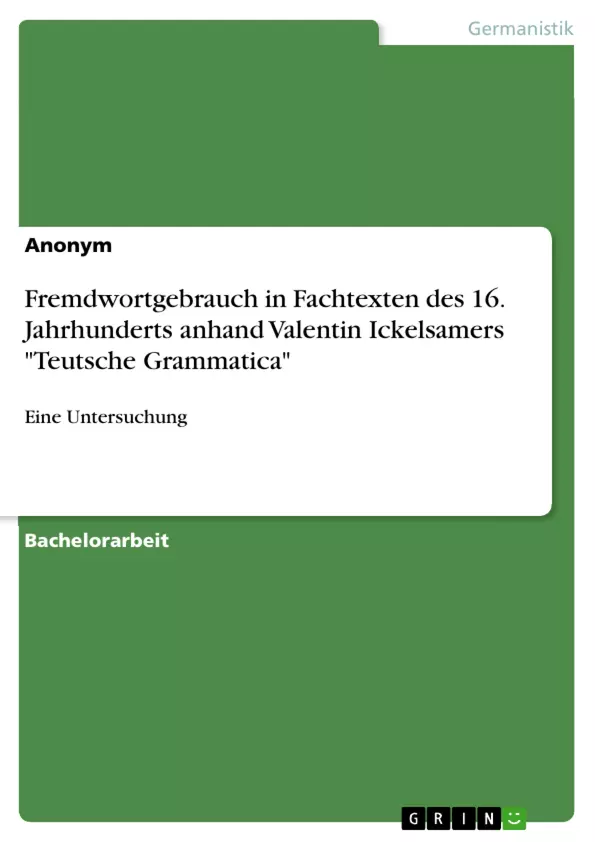Die Vergangenheit der europäischen Sprachen kann als eine Historie des Sprach- und Kulturkontakts gedeutet werden. Damit ist gemeint, dass es zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich starke Kontaktphasen zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen gab, die folglich auch in der Intensität der gegenseitigen Einflussnahme variieren konnten. In meiner Arbeit steht die Zeit des Humanismus, das heißt das 15. Jh. und insbesondere das 16. Jh., im Fokus der Betrachtung.
Dabei untersuche ich zwei Ansätze. In einem ersten theoretisch fundierten Teil der Arbeit soll die Sprachgeschichte und der Sprachkontakt vereinigt werden. Für den konkreten Aufbau bedeutet das, dass ich zunächst einen Abriss zu dem historischen Sprachkontakt während der humanistischen Zeit liefere. Diesbezüglich wird die dritte lateinische Welle angesprochen, da sie die dt. Sprache in dieser Kontaktphase stark beeinflusste. Auch die Wirkungen des Sprachkontakts werden betrachtet, da es sich dabei um allgegenwärtige sprachliche Phänomene handelt, die bereits in diesem Zeitraum anzutreffen waren.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historische Sprachkontakt in der Zeit des Humanismus
- 2.1 Die dritte lateinische Welle
- 2.2 Die Wirkungen des Sprachkontakts
- 3. Die Formen der Entlehnung
- 4. Die Fachtexte des 16. Jahrhunderts
- 5. Die frühe Grammatikschreibung des Deutschen
- 6. Biografische Angaben des Grammatikers Valentin Ickelsamer
- 7. Valentin Ickelsamers Fachtext: „Teutsche Grammatica”
- 7.1 Inhaltliche Elemente des Werkes
- 7.2 Das Grammatikverständnis von Ickelsamer
- 7.3 Die Adressaten der „Teutschen Grammatica”
- 7.4 Eine allgemeine frühneuhochdeutsche Analyse im Werk
- 7.5 Eine spezielle Analyse des Fremdwortgebrauchs im Werk
- 7.5.1 Das Fremdwort als grammatischer Terminus
- 7.5.1.1 Die Fremdwörter A-O
- 7.5.1.2 Die Fremdwörter P-V
- 7.5.2 Weitere Fremdwortbeispiele
- 8. Fazit
- Anhang
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Fremdwortgebrauchs in Fachtexten des 16. Jahrhunderts anhand des Beispiels „Teutsche Grammatica” von Valentin Ickelsamer. Die Arbeit analysiert die Einflüsse des Sprachkontakts während der Zeit des Humanismus und konzentriert sich insbesondere auf die dritte lateinische Welle und die Auswirkungen des Fremdwortgebrauchs auf die deutsche Sprache.
- Die Bedeutung des Sprachkontakts im Humanismus
- Die Einflüsse der lateinischen Sprache auf das Deutsche
- Die Formen der Entlehnung, insbesondere die Wortentlehnung
- Die frühe Grammatikschreibung des Deutschen
- Die Analyse des Fremdwortgebrauchs in „Teutsche Grammatica”
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Sprachkontakt im Kontext des Humanismus vor und beschreibt den Fokus der Arbeit, die sich auf die Analyse des Fremdwortgebrauchs in „Teutsche Grammatica” konzentriert. Kapitel 2 beleuchtet die dritte lateinische Welle und die Auswirkungen des Sprachkontakts während des Humanismus. Kapitel 3 thematisiert die Formen der Entlehnung, insbesondere die Wortentlehnung. Kapitel 4 widmet sich den Fachtexten des 16. Jahrhunderts und Kapitel 5 der frühen Grammatikschreibung des Deutschen. Kapitel 6 beinhaltet biografische Informationen über Valentin Ickelsamer. Kapitel 7 analysiert das Werk „Teutsche Grammatica”, einschließlich seiner Inhalte, des Grammatikverständnisses von Ickelsamer, der Adressaten und der frühneuhochdeutschen Besonderheiten. Kapitel 7.5 untersucht den Fremdwortgebrauch im Werk, insbesondere die Verwendung von Fremdwörtern als grammatische Termini und weitere Fremdwortbeispiele. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Sprachkontakt, Humanismus, dritte lateinische Welle, Fremdwortgebrauch, Fachtexte, Grammatikschreibung, Valentin Ickelsamer, „Teutsche Grammatica”, frühneuhochdeutsch
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte das Lateinische auf das Deutsche im 16. Jahrhundert?
In der Zeit des Humanismus gab es die sogenannte „dritte lateinische Welle“. Latein war die Gelehrtensprache, weshalb viele Fachbegriffe und grammatische Termini direkt aus dem Lateinischen ins Deutsche übernommen oder eingedeutscht wurden.
Wer war Valentin Ickelsamer?
Valentin Ickelsamer war ein bedeutender deutscher Grammatiker des 16. Jahrhunderts. Mit seinem Werk „Teutsche Grammatica“ leistete er einen frühen Beitrag zur Systematisierung der deutschen Sprache.
Wie werden Fremdwörter in Ickelsamers „Teutsche Grammatica“ verwendet?
Fremdwörter dienten Ickelsamer primär als grammatische Fachbegriffe (Termini), um sprachliche Strukturen zu erklären, für die es im damaligen Deutsch oft noch keine etablierten Entsprechungen gab.
Was versteht man unter „Sprachkontakt“ im Humanismus?
Sprachkontakt bezeichnet das Zusammentreffen verschiedener Sprachen (hier Deutsch und Latein/Griechisch). Dies führt zu Entlehnungen und beeinflusst die Entwicklung von Wortschatz und Grammatik der Volkssprache.
An wen richtete sich Ickelsamers Werk?
Ickelsamer wollte mit seiner Grammatik nicht nur Gelehrte ansprechen, sondern auch Laien und Schülern helfen, die deutsche Sprache regelhaft zu verstehen und korrekt zu gebrauchen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2014, Fremdwortgebrauch in Fachtexten des 16. Jahrhunderts anhand Valentin Ickelsamers "Teutsche Grammatica", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942593