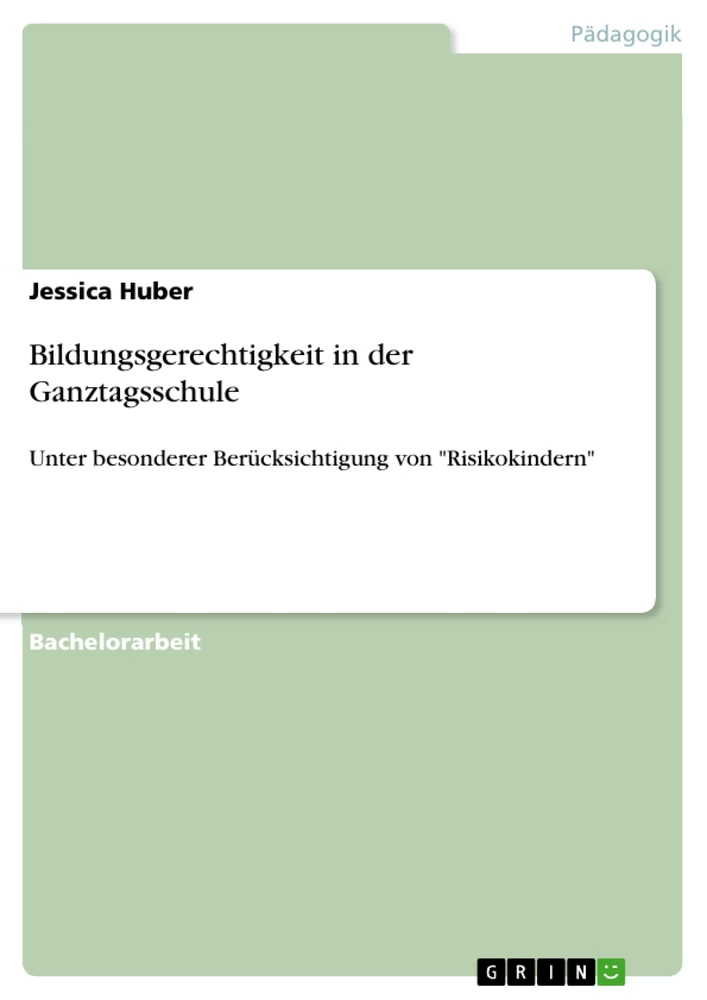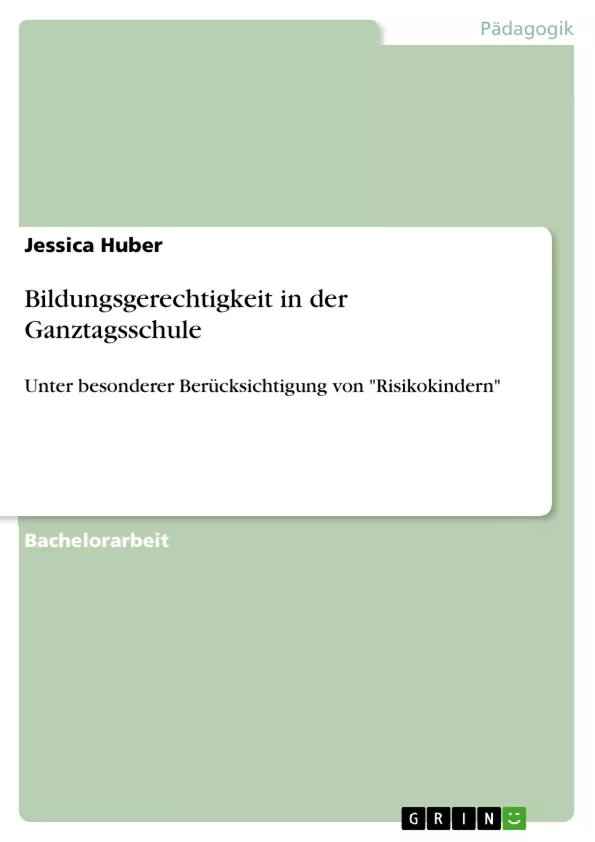Diese Arbeit wird sich mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit in der Ganztagsschule im Hinblick auf "Risikokinder" beschäftigen. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, aus den Erkenntnissen des Begriffs der Bildungsgerechtigkeit Handlungsansätze von Ganztagsschulen herzuleiten, die zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit beitragen. In der Arbeit wird daher der Frage nachgegangen, ob das Konzept der Ganztagsschule Kinder und Jugendlichen in riskanten Lebenslagen erreicht. Darüber hinaus soll geklärt werden, inwieweit das Konzept der Ganztagsschule insbesondere diese Kinder angemessen fördern kann.
Um diese Fragestellungen beantworten zu können, ist die Arbeit folgendermaßen gegliedert: Zunächst wird als Grundlage für den weiteren Verlauf der Arbeit ein Blick auf die Ganztagsschule geworfen. Es wird das Thema Bildungsgerechtigkeit genauer beleuchtet, indem Begriffsbestimmungen vorgenommen werden. Danach wird auf die Bildungsgerechtigkeit im deutschen Bildungssystem eingegangen. Das nächste Kapitel wird zunächst aufzeigen, was unter den sogenannten "Risikokindern" zu verstehen ist. Anschließend werden Chancen der Ganztagsschule zur Förderung von "Risikokindern" aufgezeigt.
Abschließend folgt das Fazit, in welchem die zuvor erarbeiteten Punkte noch einmal zusammengetragen werden. Die bis dahin dargestellten Argumente werden zusammengeführt und in einer Diskussion abgewogen und reflektiert. Dabei soll die zentrale Fragestellung beantwortet werden, inwiefern Bildungsgerechtigkeit in der Ganztagsschule unter Berücksichtigung von "Risikokindern" gegeben ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ganztagsschule
- 2.1 Begriffsannäherung
- 2.2 Formen der Ganztagsschule
- 2.3 Ziele der Ganztagsschule
- 3 Bildungsgerechtigkeit
- 3.1 Begriffsannäherung
- 3.2 Bildungsgerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
- 3.3 Bildungsgerechtigkeit im Hinblick auf Ganztagsschule
- 4 „Risikokinder“ in der Ganztagsschule
- 4.1 Zum Begriff „Risikokinder“
- 4.2 Risikofaktoren
- 4.2.1 Migrationshintergrund
- 4.2.2 Armut und soziale Benachteiligung
- 4.2.3 Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität
- 4.2.4 Schulaversives Verhalten
- 4.2.5 Lernbeeinträchtigung
- 4.2.6 Störungen im Bindungsverhalten
- 5 Chancen und Grenzen der Ganztagsschule zur Förderung von „Risikokindern“
- 5.1 Chancen der Ganztagsschule
- 5.2 Grenzen der Ganztagsschule
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Ganztagsschule einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten kann, insbesondere im Hinblick auf sogenannte „Risikokinder“. Ziel ist es, aus den Erkenntnissen des Begriffs der Bildungsgerechtigkeit Handlungsansätze für die Ganztagsschule zu entwickeln, die zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit beitragen. Die Arbeit analysiert, ob das Konzept der Ganztagsschule Kinder und Jugendliche in riskanten Lebenslagen erreicht und inwiefern es diese Kinder angemessen fördern kann.
- Begriffsbestimmung und Formen der Ganztagsschule
- Bildungsgerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
- Die Rolle der Ganztagsschule im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit
- Definition und Charakterisierung von „Risikokindern“
- Chancen und Grenzen der Ganztagsschule zur Förderung von „Risikokindern“
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 liefert eine umfassende Beschreibung des Begriffs „Ganztagsschule“ und erläutert verschiedene Formen der Ganztagsschule. Es beleuchtet die vielfältigen Konzepte und Ziele dieser Schulform.
- Kapitel 3 widmet sich dem Thema der Bildungsgerechtigkeit. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs vorgestellt und die Situation der Bildungsgerechtigkeit im deutschen Bildungssystem analysiert. Darüber hinaus wird die Relevanz der Ganztagsschule im Kontext der Bildungsgerechtigkeit erörtert.
- Kapitel 4 definiert den Begriff „Risikokinder“ und stellt wichtige Risikofaktoren vor. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Herausforderungen für Kinder mit Migrationshintergrund, aus sozial benachteiligten Familien oder mit Lernschwierigkeiten.
- Kapitel 5 befasst sich mit den Chancen und Grenzen der Ganztagsschule im Hinblick auf die Förderung von „Risikokindern“. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Ganztagsschule den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht werden kann und gleichzeitig die Grenzen der Ganztagsschule im Kontext der Förderung von Bildungsgerechtigkeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Bildungsgerechtigkeit, Ganztagsschule, Risikokinder, Soziales Kapital, Bildungsbenachteiligung, Chancengleichheit, inklusive Bildung, Lernförderung, pädagogische Förderung, Lernumgebung.
- Arbeit zitieren
- Jessica Huber (Autor:in), 2020, Bildungsgerechtigkeit in der Ganztagsschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/943966