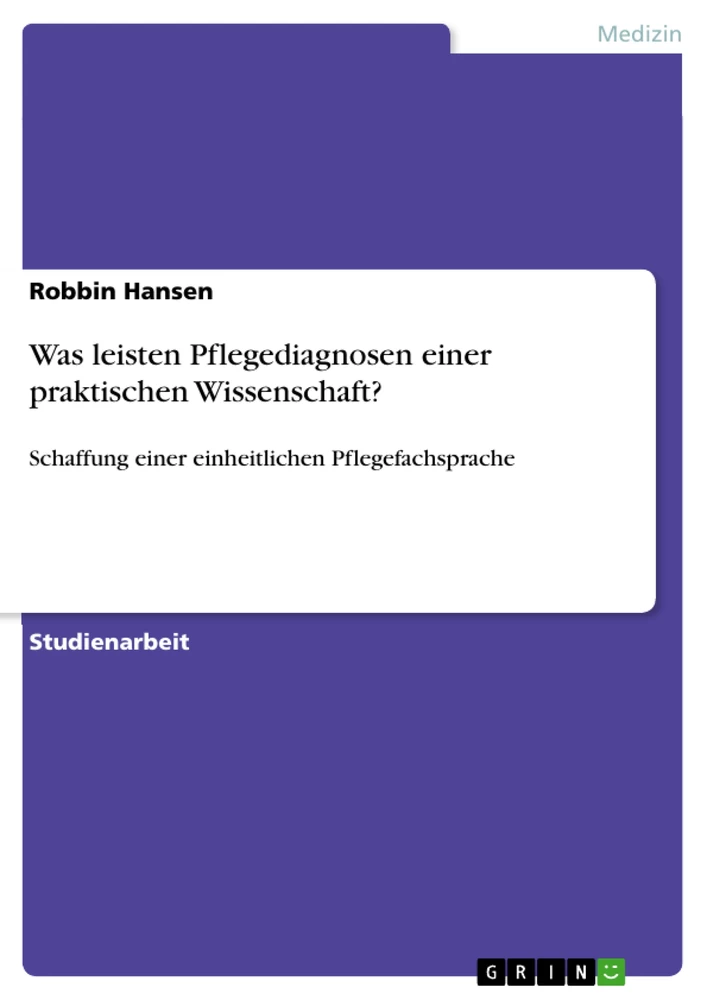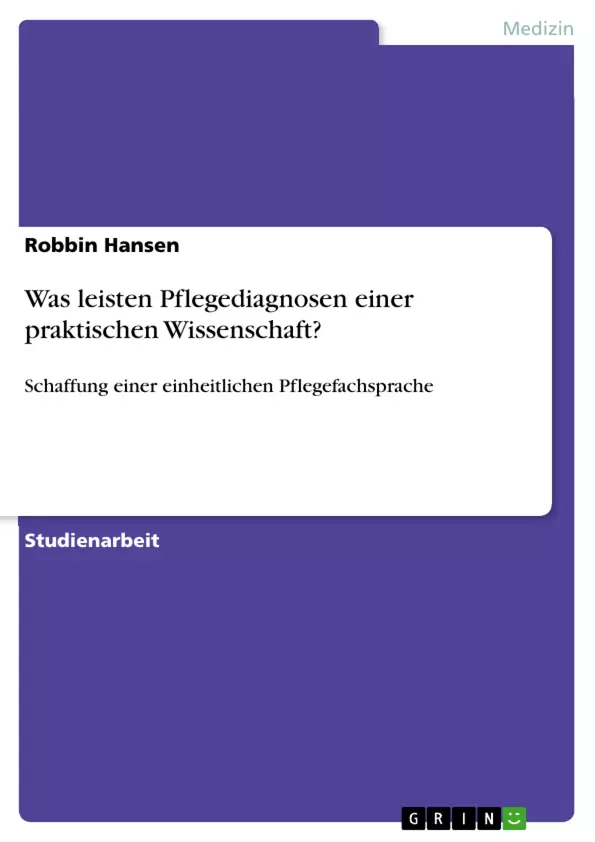Was leisten Pflegediagnosen einer praktischen Wissenschaft? Die Einführung der Pflegediagnosen soll sehr viel leisten können und soll die Pflege auf ihren Weg zur Professionalisierung vorantreiben. Zum einen in der direkten Pflege, indem eine strukturierte Kommunikation im Team und zwischen Organisationen die Evaluation, die Leistungsbegründung und Transparenz der Pflegeleistung darlegen und erhöhen soll. Zum anderen dient die Standardisierung von Pflegeinformation dem Management und der Wissenschaft zum Zweck der Leistungsdarstellung, Abrechnung, Bedarfsplanung und der Bearbeitung von pflegerelevanten Forschungsfragen. Zusammengefasst soll die Pflege mit Hilfe der Pflegediagnosen organisierbarer, kommunizierbarer, vergleichbarer und beforschbarer werden.
Alle diese Ziele unabhängig davon, wie weit sie schon verwirklicht worden sind oder nicht, fußen nach Auffassung des Verfassers in einem Ursprung. Der Ursprung ist das Ziel, die Pflegefachsprache vereinheitlichen zu wollen und sie von anderen Disziplinen abgrenzen zu können.
Als Begriff sind Pflegediagnosen historisch gesehen noch recht jung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die bekannte Krankenschwester Florence Nightingale in ihrem Wirken besonders bei der Behandlung der Opfer im Krimkrieg als Diagnostikerin zu betrachten. Sie diagnostizierte Ernährungsmängel und andere Gesundheitsprobleme. Ihr Handeln wurde aber nicht als Diagnostizieren benannt. Der Beginn der Diskussion, dass die Pflege ähnlich der Medizin auch Diagnosen im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes stellen könnte, blieb lange aus. Erst 1950 wurde in der Veröffentlichung „Assumptions of the Functions of Nursing“ von R. Louise McManus festgestellt, dass Pflege das Erkennen und Diagnostizieren von Pflegeproblemen ist, um daraus sich für notwendige pflegerische Maßnahmen entscheiden zu können. Es vergingen viele Jahre bis 1974 die Pflegediagnose als fester Standard im Pflegeprozess von der American Nurses Association etabliert worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Methodik
- These: Pflegediagnosen schaffen eine einheitliche Pflegefachsprache
- Argument: Die Geschichte der Pflegediagnosen selbst zeigt, dass sich die Pflegefachsprache vereinheitlicht
- Argument: Pflegediagnosen helfen die Fachsprache zu vereinheitlichen, weil sie es ermöglichen den Pflegeprozess an viele Pflegetheorien anzupassen
- Antithese: Pflegediagnosen schaffen keine einheitliche Pflegefachsprache
- Argument: Die Vielfalt an Klassifikationssystemen hemmt die Entwicklung einer einheitlichen Fachsprache
- Vergleich der Definitionen NANDA und POP
- Abgleich von NANDA und POP in ihrer Klassifikationsstruktur
- Argument: Pflegediagnosen Klassifikationen können Pflegephänomene nicht eindeutig benennen
- Argument: Die Vielfalt an Klassifikationssystemen hemmt die Entwicklung einer einheitlichen Fachsprache
- Interpretation der Antithese
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit die Einführung von Pflegediagnosen zur Etablierung einer einheitlichen Pflegefachsprache beiträgt. Sie analysiert die These, dass Pflegediagnosen eine einheitliche Pflegefachsprache schaffen, und erörtert gleichzeitig die Gegenposition, dass sie diese nicht schaffen können.
- Die Entwicklung der Pflegediagnosen und ihre Auswirkungen auf die Pflegefachsprache.
- Die Rolle von Klassifikationssystemen in der Entwicklung einer einheitlichen Pflegefachsprache.
- Die Herausforderungen, die mit der Verwendung von Pflegediagnosen verbunden sind, insbesondere in Bezug auf die eindeutige Benennung von Pflegephänomenen.
- Der Einfluss der Pflegediagnosen auf die Organisation, Kommunikation und Forschung in der Pflege.
- Der Vergleich verschiedener Pflegediagnosen-Klassifikationssysteme, wie NANDA und POP, und ihre Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der Pflegefachsprache.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die historische Entwicklung der Pflegediagnosen und zeigt auf, dass die Einführung von Pflegediagnosen zur Verbesserung der Organisation, Kommunikation und Forschung in der Pflege dienen soll. Sie verdeutlicht das Ziel dieser Arbeit, die Rolle von Pflegediagnosen bei der Etablierung einer einheitlichen Pflegefachsprache zu untersuchen. Die Methodik beschreibt die verwendeten Quellen und Methoden, wobei der Fokus auf die Analyse von Fachliteratur und dem Vergleich von Pflegediagnosen-Klassifikationssystemen liegt.
Das erste Argument der These, dass Pflegediagnosen eine einheitliche Pflegefachsprache schaffen, basiert auf der Beobachtung, dass die Entwicklung von Pflegediagnosen, insbesondere durch die NANDA Klassifikation, zu einer zunehmenden Vereinheitlichung der Pflegefachsprache geführt hat. Es wird zudem argumentiert, dass Pflegediagnosen die Anpassung des Pflegeprozesses an verschiedene Pflegetheorien ermöglichen, was ebenfalls zur Vereinheitlichung der Fachsprache beiträgt.
Die Antithese stellt dagegen dar, dass die Vielfalt an Klassifikationssystemen, wie NANDA und POP, die Entwicklung einer einheitlichen Fachsprache eher behindert. Es wird argumentiert, dass Pflegediagnosen-Klassifikationen nicht immer eindeutig Pflegephänomene benennen können, was die Einheitlichkeit der Fachsprache beeinträchtigen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Pflegediagnosen, Pflegefachsprache, Klassifikationssysteme, NANDA, POP, Pflegeprozess, Pflegeforschung, Professionalisierung der Pflege, Kommunikation und Organisation.
Häufig gestellte Fragen
Was leisten Pflegediagnosen für die Professionalisierung der Pflege?
Sie dienen der Vereinheitlichung der Fachsprache, verbessern die Kommunikation im Team und ermöglichen eine transparente Darstellung und Abrechnung von Pflegeleistungen.
Was ist der Ursprung der Pflegediagnosen?
Obwohl Florence Nightingale bereits im 19. Jh. diagnostisch tätig war, wurde der Begriff erst um 1950 geprägt und 1974 durch die American Nurses Association (ANA) als Standard etabliert.
Was sind NANDA und POP?
Es handelt sich um Klassifikationssysteme für Pflegediagnosen. NANDA ist international weit verbreitet, während POP (PraxisOrientierte Pflegediagnostik) ein alternatives System darstellt.
Warum wird die Vielfalt an Klassifikationssystemen kritisiert?
Die Antithese der Arbeit besagt, dass unterschiedliche Systeme die Entwicklung einer wirklich einheitlichen weltweiten Pflegefachsprache eher hemmen.
Wie unterstützen Pflegediagnosen die Pflegeforschung?
Durch die Standardisierung von Informationen werden Pflegephänomene vergleichbar und statistisch auswertbar, was die Bearbeitung pflegerelevanter Forschungsfragen erleichtert.
- Citation du texte
- Robbin Hansen (Auteur), 2019, Was leisten Pflegediagnosen einer praktischen Wissenschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/946900