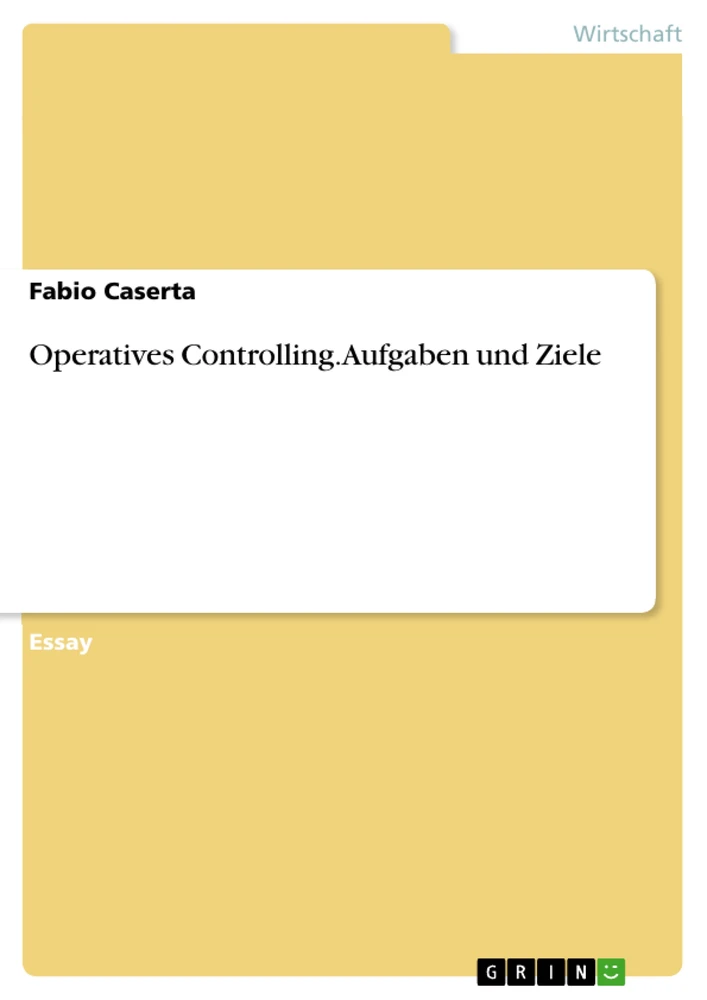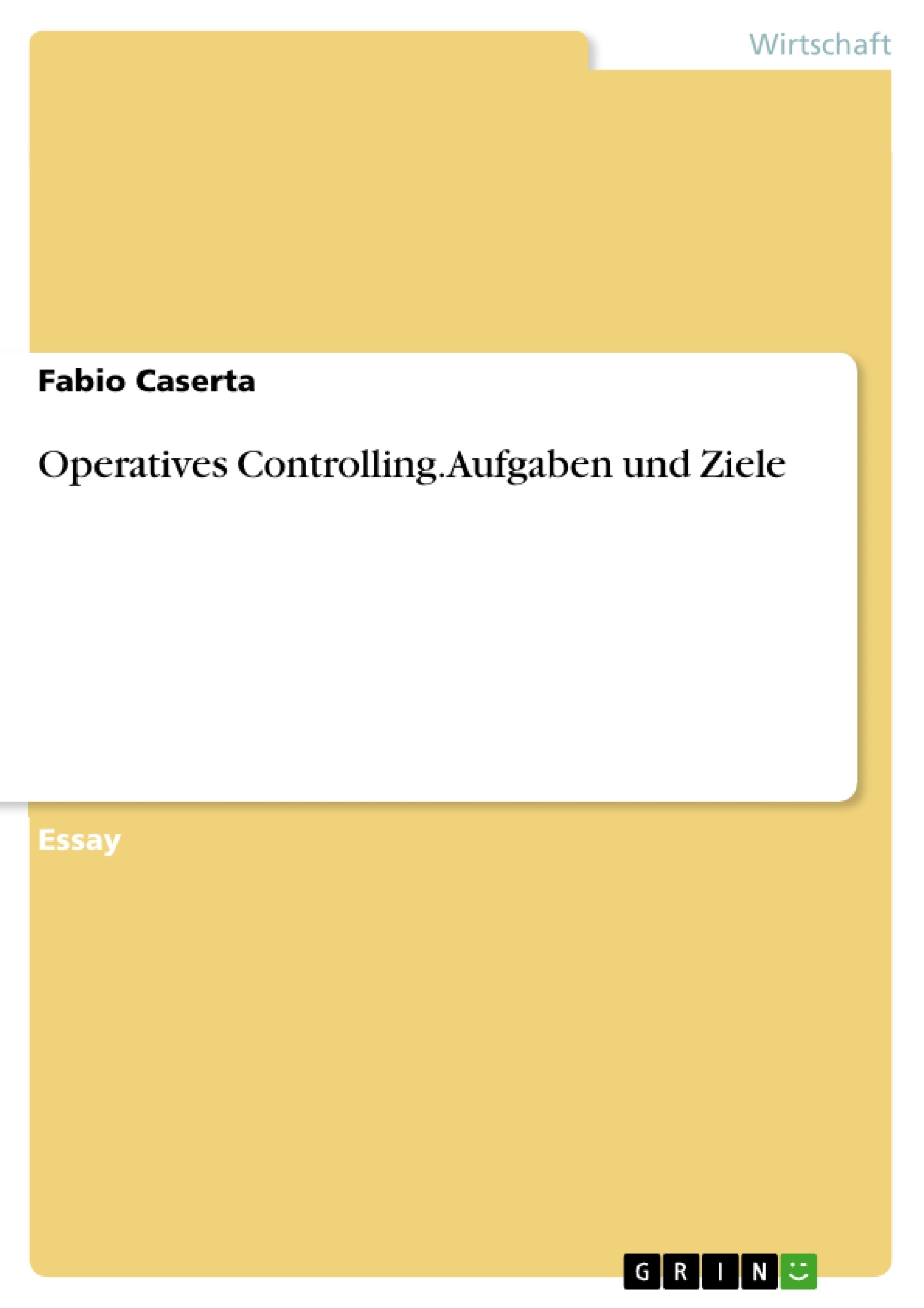Die Arbeit thematisiert das Thema operatives Controlling. Sie hat das Ziel, die unterstützende Funktion des operativen Controllings für Unternehmen darzustellen und wirft damit die Frage auf, welche Aufgaben und Ziele das operative Controlling hat. Zu Beginn erläutert der Autor den Begriff Controlling und dessen Entstehung, da dies für den weiteren Verlauf der Arbeit ausschlaggebend ist. Im darauffolgenden Kapitel wird das operative Controlling genauer definiert. In diesem Kapitel wird auch zwischen dem strategischen Controlling unterschieden und sowohl die Aufgaben als auch die Ziele erläutert.
Seit der Globalisierung hat die geographische Expansion der Märkte und damit auch eine wachsende Wettbewerbsdynamik dafür gesorgt, dass Unternehmen mit zunehmen der Konkurrenz in alten und neuen Märkten zu kämpfen haben. Außerdem ist zu beachten, dass sich die Marktteilnehmer in einem schnellen Wandel innerhalb des Unternehmensumfeldes befinden, dies geschieht im Besonderen durch die rasante Entwicklung von neuen Kommunikations- und Informationstechnologien.
Mit Beginn der Datenverarbeitung in den 60er-Jahren wird der Produktionsfaktor Information durch informationstechnische Systeme, dem Controlling und dem Management bereitgestellt. Zusätzlich werden Kontroll- und Steuerungsfunktionen weitestgehend automatisiert. Für das betriebliche Controlling bedeutet das, dass die Informationsversorgung komplexer ist und in Bezug auf Datenqualität, Transparenz und Aktualität deutlich höhere Anforderungen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit
- Definition
- Definition und Entstehung
- Operatives Controlling
- Strategisches und operatives Controlling
- Operatives Controlling: Aufgaben und dessen Ziele
- Weitere Aufgaben des operativen Controllings
- Budgetierung und Budgetkontrolle
- Informationsversorgung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem operativen Controlling und beleuchtet dessen wichtige Funktion bei der Unterstützung von Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld. Die Arbeit untersucht die Aufgaben und Ziele des operativen Controllings im Kontext der Herausforderungen der Globalisierung und des technologischen Wandels.
- Die Entwicklung und Bedeutung des Controllings in der Geschichte
- Die Abgrenzung zwischen strategischem und operativem Controlling
- Die spezifischen Aufgaben des operativen Controllings
- Die Rolle des operativen Controllings bei der Budgetierung und Budgetkontrolle
- Die Bedeutung der Informationsversorgung im Rahmen des operativen Controllings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des operativen Controllings ein und stellt die Problemstellung sowie den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Definition und Entstehung des Controllings, wobei historische Entwicklungen und verschiedene Definitionsansätze aufgezeigt werden. Im dritten Kapitel wird das operative Controlling im Detail betrachtet, wobei die Abgrenzung zum strategischen Controlling, die spezifischen Aufgaben und Ziele sowie weitere wichtige Aspekte wie Budgetierung und Informationsversorgung beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Operatives Controlling, strategisches Controlling, Aufgaben, Ziele, Budgetierung, Budgetkontrolle, Informationsversorgung, Globalisierung, Technologischer Wandel, Informationstechnische Systeme, Unternehmensführung, Management.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe des operativen Controllings?
Es unterstützt das Management bei der kurz- bis mittelfristigen Planung, Steuerung und Kontrolle der betrieblichen Prozesse, um die Liquidität und Rentabilität zu sichern.
Wie unterscheidet es sich vom strategischen Controlling?
Das operative Controlling fokussiert auf Effizienz und kurzfristige Ziele (Gegenwart), während das strategische Controlling auf Effektivität und langfristige Überlebenssicherung (Zukunft) ausgerichtet ist.
Warum ist Budgetierung ein zentrales Element?
Die Budgetierung legt finanzielle Ziele für Verantwortungsbereiche fest. Die Budgetkontrolle deckt Abweichungen auf und ermöglicht rechtzeitige Gegensteuerungsmaßnahmen.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf das Controlling?
Sie erhöht den Wettbewerbsdruck und die Dynamik der Märkte, was höhere Anforderungen an die Datenqualität, Transparenz und Aktualität der Informationsversorgung stellt.
Welche Rolle spielen IT-Systeme im modernen Controlling?
Informationstechnische Systeme automatisieren Steuerungsfunktionen und stellen dem Management komplexe Datenmengen zeitnah für Entscheidungen zur Verfügung.
- Quote paper
- Fabio Caserta (Author), 2020, Operatives Controlling. Aufgaben und Ziele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947645