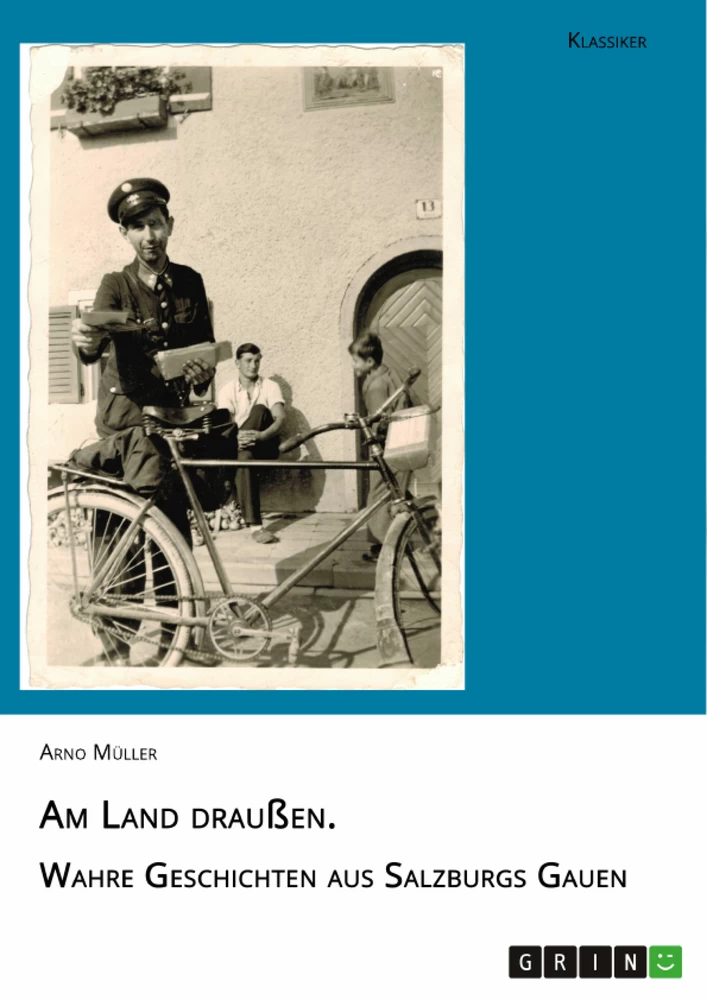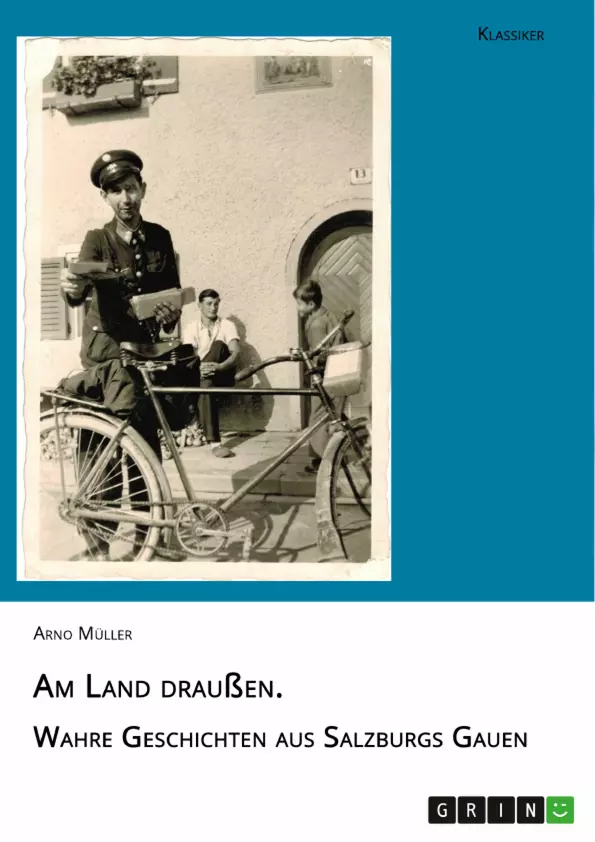Ich habe mein ganzes, bisher 85-jähriges Leben „draußen am Land“ verbracht: Wals-Siezenheim, Unken, Bruck an der Glocknerstraße, Bischofshofen, Annaberg und Hof bei Salzburg. Neben meinem Beruf war ich immer Mitglied (und mehrmals auch Gründer) von Singgemeinschaften und Theatergruppen. Weiters hatte (und hat noch) für mich das Bergsteigen einen hohen Stellenwert.
Einiges von dem, was ich dabei erfahren, gehört oder erlebt habe, sei hier erzählt. Bei all denen, die mich zum Schreiben ermuntert haben, möchte ich mich herzlich bedanken.
Inhaltsverzeichnis
- Ich denke noch oft an die Ischlerbahn
- Das waren halt noch Briefträger!
- So wurde Wals zum Ringerdorf
- Vom Bauerndirndl, das nach Island zog
- Vor Hagel, Blitz und Ungewitter…..\n
- Die Sennerin von der Dickkopfalm und ihr „Bruada”
- Die klugen Kühe von der Eggeralm
- ,,Mein Vater war Einleger....\n
- Ein Platzerl für die Gertraud
- Der Riesenfrosch vom Walserberg
- Schulen im Winkel
- Pfund und Pfennig
- Wie der Zederhauser Oberlehrer Bezirksdolmetscher wurde
- Ganz a g‘selchter Hund
- Bauernaustreibung am Fuschlsee
- Die verhaftete Florianiwallfahrt
- „Du jetzt Bürgermeister!”
- Ausg'schamte Hund' und o‘drahte Gauner
- Eine Schlacht mit Schmugglern
- ,,Im Jahre 67…..“
- Ein Untersbergförster erzählte...\n
- Richard Wagner beim Schmuggeln erwischt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Autor, Arno Müller, schildert in diesem Werk seine Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in Salzburg sowie an seine Zeit als Lehrer und Bezirksschulinspektor. Er erzählt Geschichten aus verschiedenen Regionen Salzburgs, die er während seiner Lebenszeit erlebt hat, und beleuchtet dabei die Lebenswelt und die Menschen in den ländlichen Gebieten Salzburgs.
- Alltagsleben und Menschen in Salzburgs Gauen
- Erinnerungen an die Ischlerbahn und das Salzkammergut
- Geschichten aus verschiedenen Regionen Salzburgs
- Lebendige Beschreibungen von Landschaft und Natur
- Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Ich denke noch oft an die Ischlerbahn: Der Autor schildert seine Erinnerungen an die Ischlerbahn und ihre Bedeutung für die Menschen in der Region. Er berichtet über die Besonderheiten der Bahnlinie und die Lebensweise der Menschen entlang der Strecke.
- Das waren halt noch Briefträger!: Dieses Kapitel befasst sich mit der Arbeit der Briefträger in der Vergangenheit. Der Autor schildert die Herausforderungen, die die Briefträger zu bewältigen hatten, und beschreibt die Bedeutung der Post für die Menschen im ländlichen Raum.
- So wurde Wals zum Ringerdorf: Das Kapitel beleuchtet die Geschichte des Ringerdorfes Wals. Der Autor erzählt von den Anfängen des Ringens in der Region und wie sich Wals zu einem Zentrum dieser Sportart entwickelte.
- Vom Bauerndirndl, das nach Island zog: Der Autor erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die aus Salzburg nach Island emigriert. Er beschreibt die Gründe für ihre Auswanderung und die Veränderungen, die sie in ihrem neuen Leben erlebt.
- Vor Hagel, Blitz und Ungewitter…..\n: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die die Menschen in Salzburg durch Naturkatastrophen wie Hagel, Blitz und Ungewitter erleben. Der Autor erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit solchen Ereignissen.
- Die Sennerin von der Dickkopfalm und ihr „Bruada”: Das Kapitel handelt von einer Sennerin und ihrem Bruder. Der Autor beschreibt die Arbeit der Sennerin auf der Alm und schildert die enge Beziehung zwischen den Geschwistern.
- Die klugen Kühe von der Eggeralm: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Kühen auf der Eggeralm. Der Autor erzählt von der besonderen Intelligenz der Tiere und schildert die Beziehung der Bauern zu ihren Kühen.
- ,,Mein Vater war Einleger....\n: Der Autor schildert die Arbeit seines Vaters als Einleger und beschreibt die Bedeutung dieses Berufes für die Menschen in der Region.
- Ein Platzerl für die Gertraud: Das Kapitel erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die einen Platz zum Leben sucht. Der Autor beschreibt die Herausforderungen, die sie dabei bewältigen muss.
- Der Riesenfrosch vom Walserberg: Dieses Kapitel berichtet über einen außergewöhnlichen Fund auf dem Walserberg. Der Autor schildert die Entdeckung eines Riesenfrosches und die Reaktionen der Menschen darauf.
- Schulen im Winkel: Das Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Schulen im Winkel. Der Autor schildert die verschiedenen Schulformen und die Entwicklung des Schulwesens in der Region.
- Pfund und Pfennig: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Geld und Finanzen in der Vergangenheit. Der Autor beschreibt das Währungssystem und die wirtschaftliche Situation der Menschen in Salzburg.
- Wie der Zederhauser Oberlehrer Bezirksdolmetscher wurde: Das Kapitel erzählt die Geschichte eines Oberlehrers aus Zederhaus, der zum Bezirksdolmetscher ernannt wurde. Der Autor beschreibt die Karriere des Lehrers und seine Bedeutung für die Region.
- Ganz a g‘selchter Hund: Dieses Kapitel handelt von einem besonders cleveren Hund. Der Autor schildert die Fähigkeiten des Hundes und seine Beziehung zu seinem Besitzer.
- Bauernaustreibung am Fuschlsee: Das Kapitel befasst sich mit der Vertreibung von Bauern am Fuschlsee. Der Autor schildert die Hintergründe und die Folgen dieses Ereignisses.
- Die verhaftete Florianiwallfahrt: Dieses Kapitel erzählt von einer Florianiwallfahrt, die von den Behörden verboten wurde. Der Autor beschreibt die Gründe für das Verbot und die Reaktionen der Menschen darauf.
- „Du jetzt Bürgermeister!”: Das Kapitel berichtet von der Wahl eines Bürgermeisters. Der Autor schildert die Ereignisse der Wahl und die Reaktion des neu gewählten Bürgermeisters.
- Ausg'schamte Hund' und o‘drahte Gauner: Dieses Kapitel erzählt von verschiedenen Gaunereien und Betrügereien, die sich in der Region ereignet haben. Der Autor schildert die Methoden der Gauner und die Folgen ihrer Taten.
- Eine Schlacht mit Schmugglern: Das Kapitel befasst sich mit einem Schmuggelvorfall. Der Autor schildert die Auseinandersetzung zwischen Schmugglern und den Behörden und die Folgen des Vorfalls.
- ,,Im Jahre 67…..“: Dieses Kapitel handelt von einem besonderen Ereignis im Jahr 1967. Der Autor schildert die Ereignisse des Jahres und die Bedeutung für die Region.
- Ein Untersbergförster erzählte...\n: Das Kapitel erzählt Geschichten, die ein Untersbergförster dem Autor erzählt hat. Der Autor schildert die Erlebnisse des Försters in der Natur und die Besonderheiten des Untersbergs.
- Richard Wagner beim Schmuggeln erwischt: Dieses Kapitel berichtet über einen Vorfall, bei dem der Komponist Richard Wagner beim Schmuggeln erwischt wurde. Der Autor schildert die Hintergründe des Vorfalls und die Reaktion Wagners.
Schlüsselwörter
Die Texte dieses Buches befassen sich mit der Kulturgeschichte Salzburgs, insbesondere mit der Lebenswelt der Menschen in den ländlichen Regionen. Wichtige Themen sind die Erinnerungen an die Ischlerbahn, die Arbeit der Briefträger, die Geschichte des Ringerdorfes Wals, die Migration nach Island, Naturereignisse wie Hagel und Blitz, die Arbeit auf der Alm, die Bedeutung des Einlegens, die Geschichte der Schulen, das Währungssystem, die Vertreibung von Bauern, Schmuggelvorfälle und die Begegnung mit berühmten Persönlichkeiten wie Richard Wagner.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Buch „Am Land draußen“?
Das Buch enthält wahre Geschichten und persönliche Erinnerungen des Autors Arno Müller aus verschiedenen Regionen Salzburgs, die das ländliche Leben des 20. Jahrhunderts beleuchten.
Welche Rolle spielt die Ischlerbahn in den Erzählungen?
Die Ischlerbahn (Salzkammergut-Lokalbahn) wird als wichtiges Verkehrsmittel und Symbol der regionalen Identität beschrieben, das das Leben der Menschen im Salzkammergut prägte.
Was erfährt man über die Geschichte des Dorfes Wals?
Der Autor schildert unter anderem, wie sich Wals zu einem bekannten „Ringerdorf“ entwickelte und welche Bedeutung der Sport für die Gemeinschaft hatte.
Thematisiert das Buch auch historische Ereignisse?
Ja, es werden Ereignisse wie die Florianiwallfahrt, Schmuggelgeschichten (sogar eine Anekdote über Richard Wagner) und die Veränderungen im Schulwesen behandelt.
Welche Orte in Salzburg werden im Buch erwähnt?
Der Autor berichtet von seinen Erlebnissen in Wals-Siezenheim, Unken, Bruck an der Glocknerstraße, Bischofshofen, Annaberg und Hof bei Salzburg.
Wer ist der Autor Arno Müller?
Arno Müller verbrachte sein ganzes Leben im Land Salzburg und war dort als Lehrer und Bezirksschulinspektor tätig, was ihm tiefe Einblicke in die ländliche Kultur verschaffte.
- Quote paper
- Arno Mueller (Author), 2020, Am Land draußen. Wahre Geschichten aus Salzburgs Gauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/949846