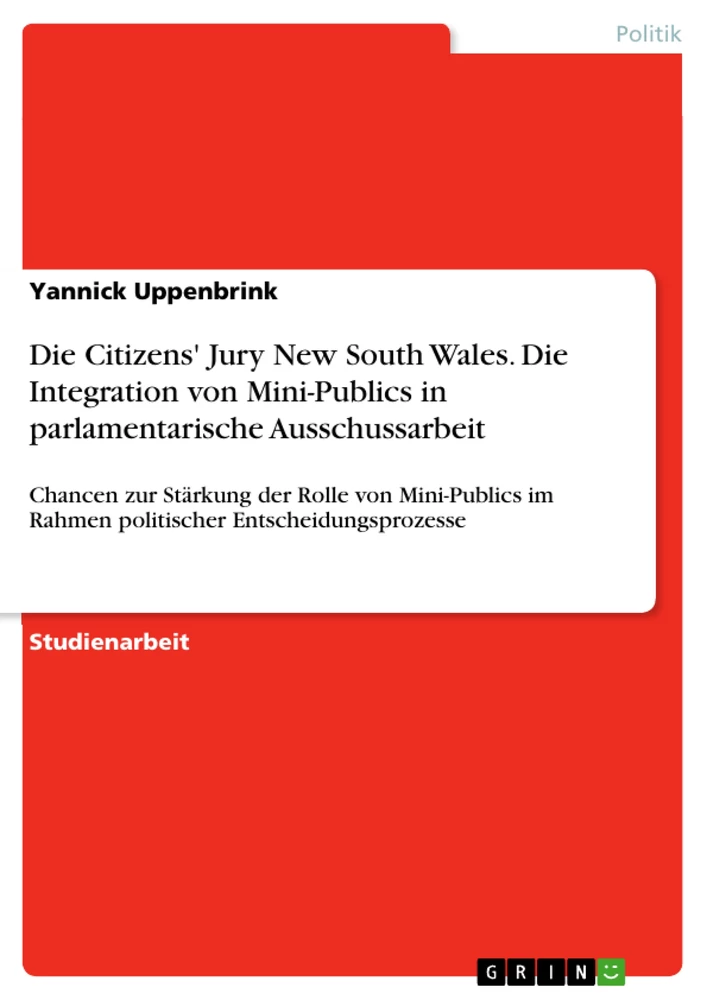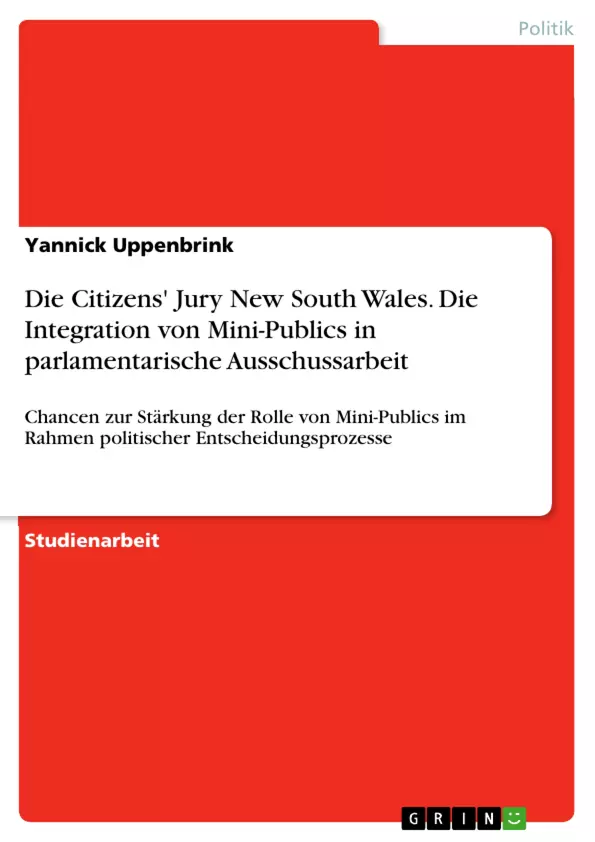Sogenannte „Mini-Publics“ bilden seit dem „deliberative turn“, der Hinwendung zu deliberativen Demokratieformen im Bereich der Politischen Theorie, einen vielversprechenden Ansatz innerhalb des vielfältigen Spektrums „neuartiger“ Demokratieformen, die unter dem Begriff der „Demokratischen Innovationen“ (DI) gefasst werden und zum Ziel haben, dem „Normal“-Bürger über konventionelle Verfahren hinaus, eine Möglichkeit der „direkteren“ Einflussnahme auf den politischen Prozess zu bieten. In Abgrenzung zu anderen DI – wie beispielsweise Referenden oder „Bürgerhaushalte“ – zeichnen sich deliberative Mini-Publics, von denen es wiederum zahlreiche sich leicht unterscheidende Modellformen gibt, grundsätzlich durch die Deliberation repräsentativ ausgewählter BürgerInnen in kleinen Gruppen zu einer bestimmten politischen Thematik aus. (...)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktueller Forschungsstand
- 3. Theoretischer Hintergrund
- 4. Das Fallbeispiel: Die Citizens' Jury New-South-Wales
- 5. Chancen der Anbindung von Mini-Publics an legislative Politikprozesse
- 6. Risiken und Probleme
- 7. Ideen zur Stärkung der Rolle von Mini-Publics
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Integration von Mini-Publics in parlamentarische Ausschussarbeit. Dabei werden die Möglichkeiten und Risiken dieser Verbindung im Hinblick auf die Stärkung der Rolle von Mini-Publics in politischen Entscheidungsprozessen analysiert. Die Arbeit basiert auf dem Fallbeispiel der Citizens' Jury New South Wales aus dem Jahr 2011/2012 und diskutiert deren Implikationen für die Gestaltung zukünftiger Mini-Public-Initiativen.
- Die Rolle von Mini-Publics als Instrument der demokratischen Innovation
- Die Herausforderungen der Verknüpfung von Mini-Publics mit repräsentativen Institutionen
- Chancen und Risiken der Institutionalisierung von Mini-Publics
- Der Einfluss von Mini-Publics auf politische Entscheidungsprozesse
- Die Bedeutung des „coupling“-Konzepts für die Integration von Mini-Publics
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Bedeutung von Mini-Publics im Kontext der demokratischen Innovation. Es werden die zentralen Forschungsfragen und die Struktur der Arbeit vorgestellt. - Kapitel 2: Aktueller Forschungsstand
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Mini-Publics und deren Integration in politische Entscheidungsprozesse. Es werden wichtige Studien und Konzepte, wie z.B. das „coupling“-Konzept, vorgestellt und diskutiert. - Kapitel 3: Theoretischer Hintergrund
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit und die Relevanz des Konzepts der „Demokratischen Innovationen“ im Zusammenhang mit Mini-Publics. Es wird die Problematik der Integration von Bürgerinnen in politische Entscheidungsfindungsprozesse erläutert. - Kapitel 4: Das Fallbeispiel: Die Citizens' Jury New-South-Wales
Dieses Kapitel beschreibt das Fallbeispiel der Citizens' Jury New South Wales und analysiert den Prozess der Integration eines Mini-Public in das legislative System des australischen Bundesstaates. - Kapitel 5: Chancen der Anbindung von Mini-Publics an legislative Politikprozesse
Dieses Kapitel diskutiert die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch die Integration von Mini-Publics in legislative Politikprozesse ergeben. Es werden die Vorteile für die politische Entscheidungsfindung und die Stärkung der Bürgerbeteiligung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Mini-Publics, Deliberative Demokratie, Demokratische Innovationen, Bürgerbeteiligung, Politische Entscheidungsfindung, Legislative Politikprozesse, „coupling“-Konzept, und dem Fallbeispiel der Citizens' Jury New South Wales.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Mini-Public"?
Ein Mini-Public ist eine Gruppe von repräsentativ ausgewählten Bürgern, die zusammenkommen, um über ein bestimmtes politisches Thema zu beraten (Deliberation) und Empfehlungen abzugeben.
Was war die "Citizens' Jury New South Wales"?
Es war ein Fallbeispiel aus Australien (2011/2012), bei dem eine Bürgerjury in die Arbeit parlamentarischer Ausschüsse integriert wurde, um über Gesundheitsfragen zu beraten.
Was bedeutet "deliberative Demokratie"?
Ein Demokratieverständnis, bei dem politische Entscheidungen durch sachliche Diskussion und gegenseitiges Abwägen von Argumenten (statt reiner Abstimmung) legitimiert werden.
Welche Chancen bietet die Anbindung an Parlamente?
Sie erhöht die Akzeptanz politischer Entscheidungen, bringt Alltagswissen der Bürger ein und wirkt der Politikverdrossenheit entgegen.
Was versteht man unter dem "coupling"-Konzept?
Es beschreibt die Verknüpfung von informellen Bürgerbeteiligungsverfahren mit den formalen Entscheidungsprozessen der gewählten Volksvertreter.
- Quote paper
- Yannick Uppenbrink (Author), 2020, Die Citizens' Jury New South Wales. Die Integration von Mini-Publics in parlamentarische Ausschussarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956772