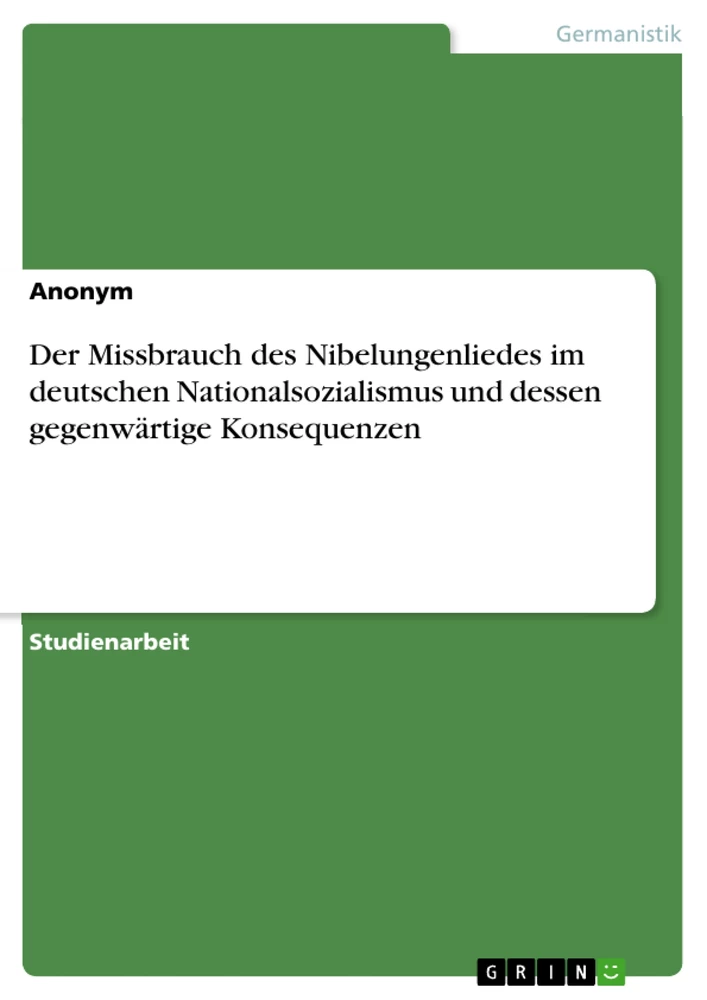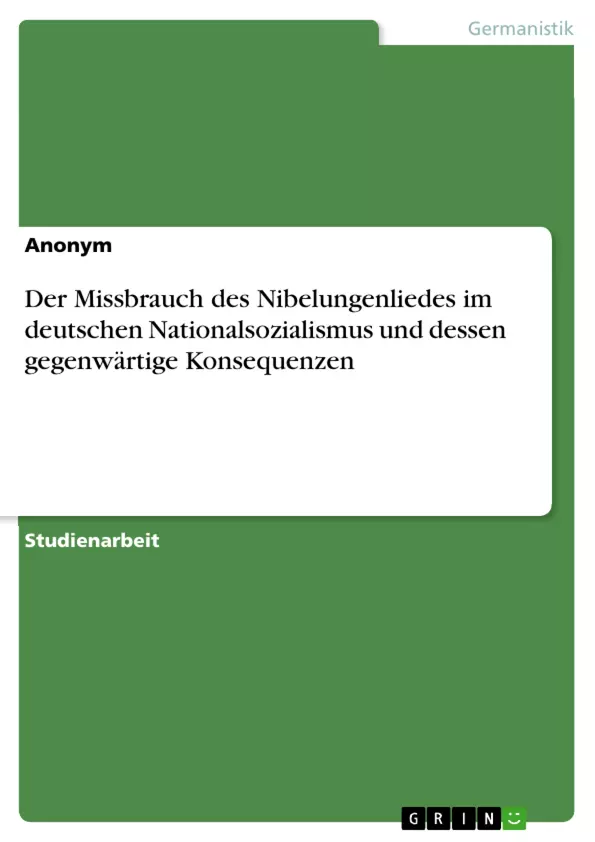In Anbetracht der europaweiten Renaissance nationalistischer Strömungen liegt es nahe, die Verbindung zwischen dem ‚Nibelungenlied‘, einem Werk der älteren deutschen Literatur, und der gegenwärtigen Rhetorik deutscher Politiker zu betrachten. Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, dass der Missbrauch des mittelalterlichen ‚Nibelungenliedes‘ eine lange Tradition in der deutschen Geschichte hat. Es wird gezeigt, dass die Konsequenzen des Missbrauchs in der heutigen Politik noch immer sichtbar sind.
Das erste Drittel dieser Arbeit schafft einen Überblick über die Vorgeschichte des politischen Missbrauchs des ‚Nibelungenliedes‘. Das Bedürfnis nach einer eigenen Identität und der Wunsch nach einer einheitlichen Nation der Deutschen, erscheint als Bedingung für die folgenreichen Rezeptionen des mittelalterlichen Epos seit rund drei Jahrhunderten. Der zweite Teil der Arbeit fasst die unterschiedlichen Rezeptionsweisen von der Romantik bis zur Gegenwart zu einer von zwei wesentlichen Methoden der politischen Vereinnahmung zusammen. Das Kernelement der ersten Methode erweist sich als die politische Instrumentalisierung und das Kombinieren unterschiedlicher Sagen und Mythen mit dem ‚Nibelungenlied‘. Im letzten Abschnitt wird die zweite Methode erläutert, die zu Gunsten der politischen Vereinnahmung Teile des ‚Nibelungenliedes‘ hervorhebt und andere Teile des Epos verschwinden lässt.
Im Hinblick auf die nationalsozialistische Rezeption des Epos wird deutlich, dass den Nazis eine disziplinierte Orientierung an der mittelalterlichen Handschrift des ‚Nibelungenliedes‘ fremd ist.
Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und die Motive der politischen Vereinnahmung beleuchtet. Die Methoden der nationalsozialistischen Rezeption werden festgehalten und die Auswirkungen des Missbrauchs bis zur Gegenwart verfolgt. Die AfD-Parole „1000 Jahre Deutschland“ entpuppt sich als rhetorische Parallele zu Nazi-Deutschland. Der Stoff des ‚Nibelungenliedes‘ erweist sich als Ursprung für wesentliche Teile der angeführten Indoktrination. Es zeigt sich, dass das ‚Nibelungenlied“ selbst keine Beachtung mehr in der Politik nationalistischer Parteien findet, aber die gegenwärtige Politik die Konsequenzen der nationalsozialistischen Rezeptionsgeschichte widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Vorgeschichte: Ein romantisches Bedürfnis
- Methode 1: Instrumentalisieren und Kombinieren unterschiedlicher Quellen
- Methode 2: Akzentuieren und Tilgen separater Textpassagen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Missbrauch des "Nibelungenliedes" im deutschen Nationalsozialismus und dessen gegenwärtige Konsequenzen. Sie beleuchtet die lange Tradition der politischen Instrumentalisierung dieses mittelalterlichen Epos und zeigt auf, wie die Folgen dieses Missbrauchs bis heute in der deutschen Politik sichtbar sind.
- Die Vorgeschichte des politischen Missbrauchs des "Nibelungenliedes" und die Entstehung eines Bedürfnisses nach einer eigenen deutschen Identität.
- Zwei wesentliche Methoden der politischen Vereinnahmung des "Nibelungenliedes": Instrumentalisierung und Kombination unterschiedlicher Quellen sowie Akzentuierung und Tilgen von Textpassagen.
- Die nationalsozialistische Rezeption des "Nibelungenliedes" und die Verfälschung der mittelalterlichen Handschrift.
- Die gegenwärtige Politik und die Folgen der nationalsozialistischen Rezeptionsgeschichte.
- Die rhetorische Parallele zwischen der AfD-Parole "1000 Jahre Deutschland" und Nazi-Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Aktualität des Themas im Kontext der europaweiten Renaissance nationalistischer Strömungen. Sie stellt die Verbindung zwischen dem "Nibelungenlied" und der gegenwärtigen Rhetorik deutscher Politiker her und skizziert die Problematik des Missbrauchs des Epos in der deutschen Geschichte.
Hauptteil
Vorgeschichte: Ein romantisches Bedürfnis
Dieser Abschnitt untersucht die Anfänge des "Nibelungen"-Missbrauchs im 18. Jahrhundert und beleuchtet die Rolle des Epos als vermeintlicher Nationalmythos im Kontext der Suche nach einer deutschen Identität.
Methode 1: Instrumentalisieren und Kombinieren unterschiedlicher Quellen
Hier werden die verschiedenen Rezeptionsweisen des "Nibelungenliedes" von der Romantik bis zur Gegenwart analysiert. Der Fokus liegt auf der politischen Instrumentalisierung und der Kombination des Epos mit anderen Sagen und Mythen.
Methode 2: Akzentuieren und Tilgen separater Textpassagen
Dieser Teil befasst sich mit der zweiten Methode der politischen Vereinnahmung: der selektiven Rezeption des "Nibelungenliedes". Es wird gezeigt, wie bestimmte Textpassagen hervorgehoben und andere ignoriert werden, um eine gewünschte politische Interpretation zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen "Nibelungenlied", "Nationalsozialismus", "deutsche Identität", "politische Instrumentalisierung", "nationalistische Rhetorik", "Rezeptionsgeschichte", "mittelalterliche Literatur" und "Kulturgeschichte".
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Der Missbrauch des Nibelungenliedes im deutschen Nationalsozialismus und dessen gegenwärtige Konsequenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957916