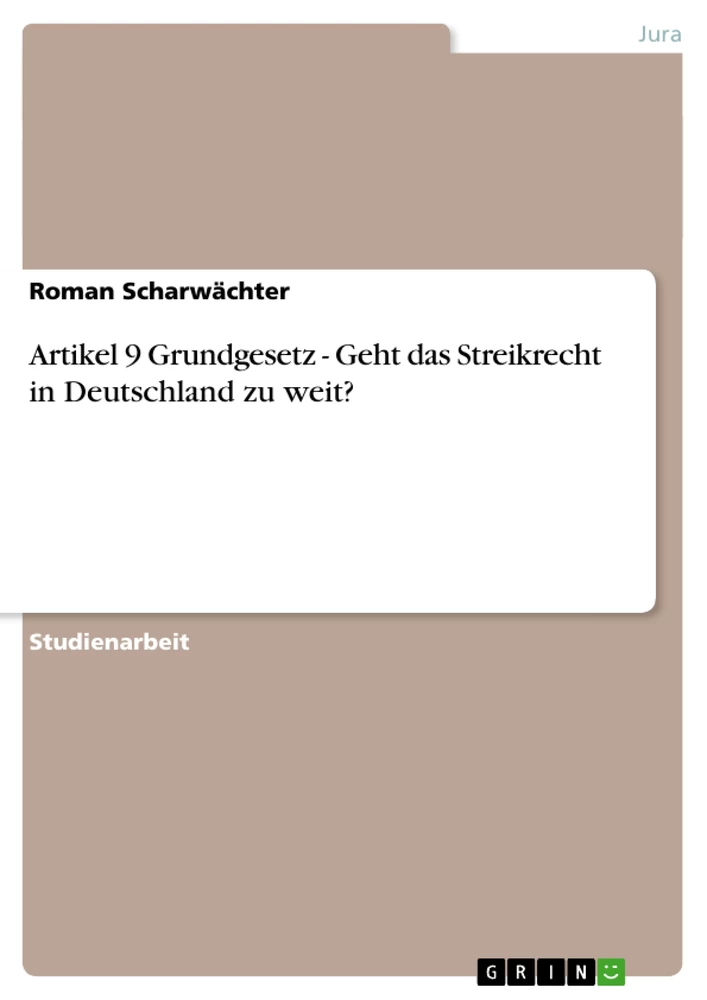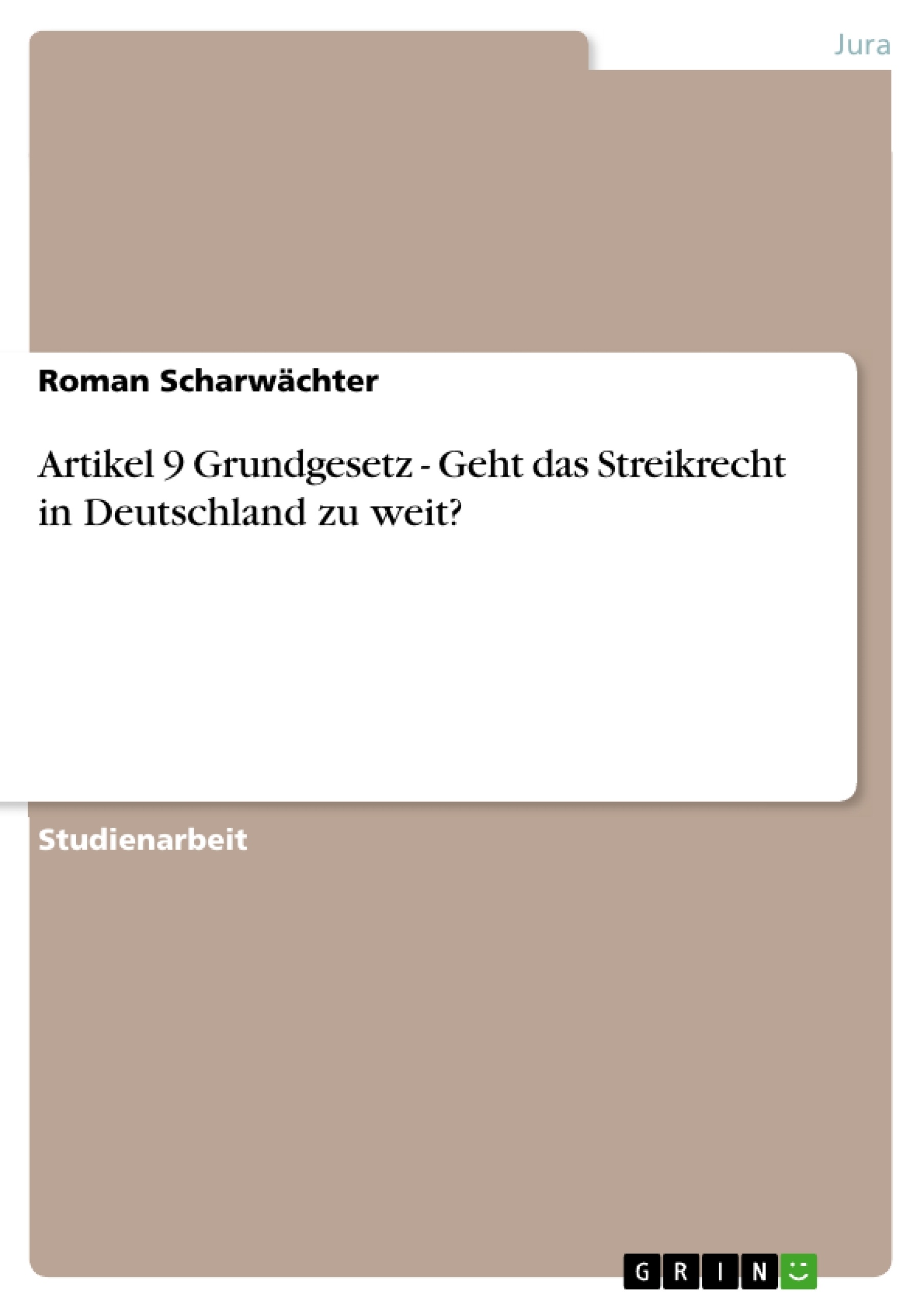Ist das Streikrecht in Deutschland ein notwendiges Übel oder ein unverzichtbares Instrument für eine gerechte Arbeitswelt? Diese brisante Frage steht im Zentrum dieser Untersuchung, die sich mit der grundgesetzlichen Verankerung des Streikrechts auseinandersetzt und dessen tatsächliche Reichweite kritisch beleuchtet. Vor dem Hintergrund anhaltender Klagen von Unternehmerseite über zu hohe Lohnkosten, unflexible Arbeitszeiten und einen rigiden Kündigungsschutz, wird das Streikrecht zunehmend als negativer Standortfaktor wahrgenommen. Doch ist diese Sichtweise gerechtfertigt? Die Analyse nimmt eine historische Einordnung des Arbeitskampfes vor, beginnend mit der Entstehung des Industrieproletariats und der Arbeiterbewegung, bis hin zur Weimarer Reichsverfassung und der heutigen Situation im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dabei werden die wesentlichen Weichenstellungen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) herausgearbeitet, die den Umfang und die Grenzen des Streikrechts in der BRD definieren. Ein besonderes Augenmerk gilt den Folgewirkungen von Streiks, die nicht selten zu Produktionsausfällen in unbeteiligten Betrieben führen und die Frage nach der Lohnfortzahlungspflicht aufwerfen. Auch die Einschränkungen des Streikrechts durch § 116 AFG werden kritisch gewürdigt. Abschließend werden alternative "Arbeitskampfersatzmittel" diskutiert, wie sie beispielsweise in Großbritannien und der Schweiz praktiziert werden, um zu bewerten, ob das Streikrecht in Deutschland tatsächlich zu weit geht oder ob es vielmehr ein unverzichtbares Korrektiv für eine ausgewogene Tarifautonomie darstellt. Die Hausarbeit lotet die Balance zwischen dem Schutz der Arbeitnehmerrechte und den Interessen der Unternehmen aus, und plädiert für eine differenzierte Betrachtung des Streikrechts als ein wichtiges Schutz- und Druckmittel für die Arbeitnehmer, um ihre Interessen wirkungsvoll zu vertreten, ohne dabei die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen auszublenden. Untersucht werden die historische Entwicklung des Streikrechts, die juristische Ausgestaltung durch das Grundgesetz und die Rechtsprechung, sowie die praktischen Auswirkungen und die Frage nach alternativen Konfliktlösungsmethoden. Diese tiefgreifende Analyse ist unerlässlich für alle, die sich mit den komplexen Fragen des Arbeitsrechts und der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen und die Zukunft der Tarifautonomie in Deutschland mitgestalten wollen. Die Argumentation gipfelt in der Schlussfolgerung, dass das Streikrecht, trotz aller Einschränkungen, ein unverzichtbares Instrument für die Arbeitnehmer bleibt, um ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern wirkungsvoll zu vertreten.
Artikel 9 Grundgesetz - Geht das Streikrecht in Deutschland zu weit?
Die nachfolgende Hausarbeit wurde für den o.g. Kurs im Fachstrang Arbeitsrecht gefertigt. Sie ist eine Voraussetzung zur Erlangung des Diploms in Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Diese Hausarbeit wurde durch Prof. Dr. jur. U. Zachert mit 1,5 bewertet Nachdruck und Zitate aus dieser Hausarbeit sind ausdrücklich, unter Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars an den Autor, gestattet. Nähere Infos zum Studium an der HWP (auch ohne Abi möglich) beim Autor
1. Vorbemerkungen
Die Klagen, die auf Seiten der Unternehmer in Deutschland geführt werden sind bekannt. Nach deren Auffassung sind in Deutschland die Lohnkosten zu hoch, die Arbeitszeiten zu unflexibel, der Kündigungsschutz zu rigide; in Verbindung mit einer mächtigen Staatsbürokratie mache dies den Standort Deutschland unattraktiv. Teile der Unternehmerschaft lehnen das Tarifsystem in Deutschland als Zwang und wenig Zeitgemäß ab und kündigen die Mitgliedschaft in den Arbeitgeberverbänden.1
So nimmt es nicht wunder, dass auch das Streikrecht in die Liste der negativen Standortfaktoren aufgenommen wird. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Werner Stumpfe, ist der Auffassung, dass Streiks seitens der Arbeitgeber in den meisten Fällen nur vermieden werden könnten, wenn den Forderungen der ArbeitnehmerInnen nachgegeben werde, daher dürfe das Streikrecht "nicht in der Form, wie es vom Bundesarbeitsgericht entwickelt wurde, weiter praktiziert werden" und "Wir müssen zu Streikregelungsmechanismen kommen, zu Arbeitskampfersatzmitteln, die so gut sind, dass wir den Streik als ein Mittel, der den Unternehmen und den Arbeitsplätzen schaden zufügt, nicht mehr brauchen."2
Das was nach Meinung des Präsidenten, des Arbeitgeberseitig größten "Sozialpartners", nicht mehr gebraucht wird, also überflüssig ist, ist "die von einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern planmäßig durchgeführte Verletzung arbetisvertraglicher Pflichten zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zieles."3 Bzw. "die von der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite zur Erreichung bestimmter Ziele mittels kollektiver Störung der Arbeitsbeziehungen bewirkte Druckausübung."4
Inhalt dieser Arbeit ist es, vor dem Hintergrund der Äußerungen des Herrn Stumpfe, die Grundgesetzliche Basis des Arbeitskampfrechtes und die darauf gründende Rechtsprechung des BAG herauszuarbeiten, um den Umfang des Streikrechts in der BRD darzustellen. (Dabei werde ich auf besondere Problemstellungen die sich mit der Frage des ,,politischen Streiks", des ,,wilden Streiks", des ,,Beamtenstreiks", des ,,Solidaritätsstreiks" befassen nicht näher eingehen) Des Weiteren soll überprüft werden, inwieweit das Streikrecht bereits durch sog. Folgewirkungen ausgehöhlt sei, und mögliche "Arbeitskampfersatzmittel" als Alternativen zum Streik sollen kritisch gewürdigt werden.
2. Art. 9 III GG - Koalitionsfreiheit / Grundgesetzlicher Schutz des Streikrechts
2.1. Historische Entwicklung
Arbeitskämpfe, hier Streiks, wie vor als kollektive Druckausübung definiert, sind historisch eng verbunden mit der Entstehung des Industrieproletariats und der aus der sozialen und wirtschaftlichen Situation entstehenden ArbeiterInnenbewegung. Durch Streiks waren die ArbeiterInnen in die Lage versetzt, ihre soziale und vor allem materielle Situation im Laufe der aufstrebenden Industrialisierung zu ihren Gunsten zu verbessern. Koalitions- und Streikverbote, Gesetze, Verordnungen und andere Maßnahmen gegen Streiks haben die Arbeiterbewegung nicht aufhalten können. Im Gegenteil vielfach erwuchsen aus spontanen Streikaktionen politische und/oder gewerkschaftliche Organisationen. Zunächst auf lokaler, dann auf überregionaler Ebene bis hin zur Gründung des ,,Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein" (1863 - als Arbeiter partei) und des ,,Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeiter-Vereins" (1865 - als erster nationaler Gewerkschafts verband), wurde damit der Auftakt zu einer breiten nationalen Gewerkschaftsbewegung gegeben.5 Auch das ,,Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" (Sozialistengesetz) von 1878, dass die Auflösung von 17 gewerkschaftlichen Zentralverbänden und 63 lokalen Berufsvereinen zur Folge hatte6, führte nicht dazu, die Arbeiterbewegung aufzuhalten.
Die Erfolglosigkeit dieses Gesetzes wurde offenbar. Ihren Höhepunkt fanden die Arbeitsniederlegungen in Deutschland mit dem Streik von 150. 000 Ruhrbergarbeitern 1889. Nach dem Fall des ,,Sozialistengesetzes" 1890 war die Mitgliederzahl der Fachvereine (wie sich die lokalen Gewerkschaften nannten) von ca. 50.000 auf geschätzte 300.000 angestiegen.7
Nach den Revolutionären Unruhen, die den 1. Weltkrieg und das deutsche Kaiserreich im November 1918 beendeten, kam es zwischen den Spitzenverbänden der deutschen Industrie und den Gewerkschaftsführungen zum sog. ,,Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommmen", in dem der Arbeiterbewegung u.a. das Koalitionsrecht und der Abschluß von Tarifverträgen zugestanden wurde.8
Diese Zusicherungen fanden später, als Art. 159 Eingang in die Weimarer Reichsverfassung, der das Recht zur Bildung von ,,Vereinigungen zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" zusicherte. Dem Streikrecht Verfassungsrang zu geben gelang hingegen nicht,9 dennoch war ein allgemeines Streikrecht für alle Berufe anerkannt. Durch Rechtsprechung und Gesetzgebung wurde in der Folge dieses Recht reguliert. Hierbei wurden, insbesondere durch die Rechtsprechung des 1926 gegründeten Reichsarbeitsgerichtes, Rechtsetzungen vorgenommen die heute noch das Arbeitsrecht grundlegend beeinflussen.
Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten durch das sog. Ermächtigungsgesetz wurde die Weimarer Verfassung faktisch außer Kraft gesetzt. Mit der Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933 durch die SA, hörten die Koalitionen auf tatsächlich zu existieren. An Stelle der Gewerkschaften trat die faschistische Deutsche Arbeitsfront. Das Recht Koalitionen zu bilden sollte erst wieder nach der militärischen Niederlage Deutschlands und der Befreiung vom deutschen Faschismus, nach dem 8. Mai 1945 (in vorher befreiten Gebieten früher [so bereits am 6. März 1945 in Aachen]) durch die Wieder- bzw. Neugründungen von Gewerkschaften in den Militärbezirken der Siegermächte eine Rolle spielen. Trotz der teilweise und unterschiedlich reservierten Haltung der (westlichen) Besatzungsmächte gelang es über die örtliche Ebene hinaus, Gewerkschaften und Gewerkschaftsverbünde zu gründen und zu konstituieren.
2.2. Die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, in den ehemals drei Westzonen, und dem in Kraft treten des Grundgesetzes, als provisorische Verfassung, wurde Art. 9 III GG als Grundrecht aufgenommen. Art. 9 III GG gewährleistet jedermann und jederfrau, das Recht zur Wahrung und Förderung der Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Dies bezeichnet die Koalitionsfreiheit. Dieses Recht gilt für alle Berufe.
Wie in der Weimarer Reichsverfassung, wurde auch hier die ausdrückliche Gewährung des Streikrechtes nicht in das Grundgesetz aufgenommen. Noch in dem Entwurf zum Grundgesetz war in einem Absatz IV das Recht der ,,gemeinschaftlichen Arbeitseinstellung" vorgesehen. In der Debatte des parlamentarischen Rates wurden aber von Seiten der CDU einige einschränkende Formulierungen gefordert, bezogen auf politische und Beamten- Streiks. Die SPD beantragte in dieser Debatte, den Absatz IV ersatzlos zu streichen, um eine ,,Kasuistik aus Einzelfallbeschränkungen zu verhindern und nicht etwa weil dadurch Streiks aus dem politischen Leben beseitigt werden könnten"10.
Die Koalitionsfreiheit bezieht sich vor allem auf die Gründung und den Bestand von Organisationen, die auf die kollektive Gestaltung des Arbeits- und Wirtschaftslebens ausgerichtet sind. Insbesondere Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Daraus leitet sich der Schutz der Tarifautonomie ab, d. h. das Recht solcher Organisationen, ohne staatliche Einmischung die Lohn- und Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen festzulegen. Die Bedeutung reicht aber über das Tarifvertragssystem und den engeren Bereich des Arbeitsrechts hinaus11.
Der wesentliche Zweck der Koalitionen ist indessen der Abschluß von Tarifverträgen.12 Art. 9 III GG gewährleiste insoweit die Tarifautonomie und damit den Kernbereich eines von staatlicher Rechtsetzung frei gelassenen Raumes, für eigenverantwortliche Kollektivvereinbarungen.13
Zu den zur Verfolgung des Vereinigungszwecks den Koalitionen zur Auswahl überlassenen Mitteln zählen auch Arbeitskampfmaßnahmen, die auf den Abschluß von Tarifverträgen gerichtet sind. Sie werden insoweit von der in Art. 9 III geschützten Koalitionsfreiheit erfaßt, als sie allgemein erforderlich sind, um eine funktionierende Tarifautonomie sicherzustellen.14 Als Kampfmittel hat das BVerfG den Streik anerkannt15.
Damit ein Streik rechtmäßig ist, muß er dem Prinzip der Sozialadäquanz entsprechen, d.h.: es muß um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen gehen, der Streik muß sich gegen den sozialen Gegen`spieler´ richten und das letzte Mittel zur Zielerreichung sein; i.d.R. bedarf er der Organisation und Führung durch eine Gewerkschaft.16
Einwendungen, der Art. 9 III GG beinhalte nicht den Schutz des Streikrechts, weil die Teilnehmenden an einem Arbeitskampf nicht selbst eine Koalition bildeten, sondern der Arbeitskampf nur die Betätigung einer Koalition sei, und ein Streik nicht zu den spezifisch koalitionsmäßigen Betätigungen der Koalition gehöre, sind wenig schlüssig. Schon nach historischer Interpretation des Art. 9 III GG, der das Streikrecht wenigstens für die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung beinhaltet. Immerhin war der Gesetzgeber nicht dagegen, er hüllte sich in ,,beredtes Schweigen"17. Doch auch die Überlegung welchen Sinn und Zweck die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 III GG haben soll, legt den Schluß nahe, dass Tarifautonomie und Arbeitskampf gleichermaßen mitbenannt sind.
Es ist schon nicht einzusehen, dass der Streik, nur weil verhältnismäßig selten angewandt, keine spezifische Betätigung der Koalition sein soll; er ist jedenfalls ein sehr spezifisches und oft effektives Mittel zur Erreichung der arbeitsrechtlichen - also der Koalitionsziele. So läßt auch eine systematische Auslegung feststellen, dass der Art. 9 III GG in Zusammenhang mit dem Sozialstaatsgebot aus Art. 20 I GG ein Streikrecht gewährt. Denn wie jedes andere Grundrecht auch, unterliegt auch das aus Art. 9 III GG, nur als Teil eines Systems von Grundrechten der gesamten Betrachtung und Auslegung des Verfassungssystems.18
Aber spätestens mit der Einfügung des Satz 3 durch die ,,Notstandsverfassung" sollte der Streit, ob Art. 9 III GG auch das Streikrecht garantiert als beendet betrachtet werden. Mit dieser Einfügung wurde klargestellt, dass das Streikrecht auch im Spannungs- und Verteidigungsfall garantiert ist. Dies macht nur Sinn wenn auch in ,,normalen" Zeiten, das Streikrecht durch Art. 9 III als Grundrecht geschützt ist.19
Aus allem Vorgenannten folgt:
Das Recht auf kollektive Verweigerung der Arbeitsleistung - Streik genannt - ist durch Art. 9 III GG als Verfassungsmäßiges Grundrecht geschützt.
3. Rechtliche Ausgestaltung des Streikrechts
Voraussetzungen und Umfang der Einsetzbarkeit des Arbeitskampfmittels (hier Streik) sind eine Frage der Ausgestaltung durch die Rechtsordnung. Die maßgebenden Grundsätze, können, wie durch die Rechtsprechung des BAG geschehen, durch Richterrecht entwickelt werden.20 Ebenso wie Gesetzesrecht, dass es im vorl. nicht gibt, muß Richterrecht gewährleisten, dass Löhne und Arbeitsbedingungen annähernd gleichgewichtig ausgehandelt werden können.21
In der Rechtsprechung des BAG ist eine Entwicklung abzulesen die sich nur allmählich der Anerkennung des Streiks als verfassungsmäßig garantiertes Recht näherte. Dabei sind insbesondere drei Entscheidungen des BAG als grundlegend zu betrachten. Mit diesen wurde eine relativ feste Struktur von arbeitsrechtlichen Regelungen und Bedingungen zur Regulierung und Rechtmäßigkeit von Streiks erarbeitet.
3.1. Sozialadäquanz und Kampfparität
In der ersten, als Grundsatzurteil geltenden, Entscheidung des neueingerichteten BAG vom 28.01.195522, stellt das Gericht, in Anlehnung zur Rechtslage in der Weimarer Republik, fest, dass ein Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis durch Aussperrung lösen kann, ohne dass ein Anspruch auf Wiedereinstellung bestünde. Die vordergründige Problemstellung dieser Entscheidung war die Kündigung von Arbeitsverhältnissen durch die Arbeitnehmer vor einem Streik, bzw. w.o. durch einen Arbeitgeber bei Aussperrung.
Insgesamt legt das BAG aber eine Reihe von Bedingungen fest, durch die ein Streik rechtlich zulässig sei. Aus dem Urteil folgt, dass ein Streik nur gewerkschaftlich legitimiert, wegen tariflicher Auseinandersetzungen, und nur wenn er die Friedenspflicht nicht verletze. Streiks haben nach dieser Entscheidung dem Prinzip der Sozialad ä quanz zu folgen, d.h. Streiks dürfen nicht unverhältnismäßig sein und müssen die ultima Ratio, dass letztmögliche Mittel darstellen, da Streiks an sich unerwünscht seien und an der Grenze zur Strafbarkeit stünden. Des Weiteren gelte der Grundsatz der Kampfparität. Wenn den Gewerkschaften das Mittel des Streiks zustehe, müsse den Unternehme das Mittel der Aussperrung zugebilligt werden. Wesentlich an der beschriebenen Entscheidung des BAG ist ferner, dass das BAG den Art. 9 III GG nicht einbezieht, ein durch das Grundgesetz garantiertes Recht auf Streik ablehnt und, trotz der Betonung des kollektivrechtlichen Charakters von Arbeitskämpfen, über die individualrechtliche Behandlung i.S. des BGB zu seinem Urteil gelangt.
3.2. Verhältnismäßigkeitsgebot und Willkürverbot
In einer weiteren Entscheidung, urteilt das BAG am 21.04.197123, dass Arbeitskämpfe unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit stünden. Obwohl diese Entscheidung im Gesamten eine Bestätigung der 1955er Entscheidung darstellt, räumt es mit dem Verhältnismäßigkeitsgebot die Möglichkeit von Arbeitskämpfen ein, im Gegensatz zur Erklärung über die Unerwünschtheit in der vorgenannten Entscheidung.
Es stellt auch deswegen eine Weiterentwicklung des Arbeitskampfrechtes dar, weil es anstelle der Kündigung der Arbeitsverhältnisse bei Arbeitskämpfen, nunmehr nur noch eine ,,suspendierende" Wirkung auf die Arbeitsverhältnisse regelt und den Begriff der Kampfparität nun anders definiert. Ging das BAG in seiner Entscheidung von 1955 noch von der formalen Gleichheit der Tarifparteien aus, ist nunmehr die Rede von Chancengleichheit im Sinne ,,möglichst gleicher Verhandlungschancen"24. Ebenso wird ein Willkürverbot festgelegt, der die Führung eines Arbeitskampfes zur Vernichtung des Gegners untersagt.25
3.3. Kernbereiche und Aussperrungsquoten
Der fortschreitende industrielle und technologische Wandel führte in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, zu harten Auseinandersetzungen, vor allem in der Metallindustrie. Die von der IG Metall geführten Streiks um eine Abwendung der Bedrohung von Arbeitsplätzen und Einkommen, durch die Einführung neuer Technologien, wurden von der Unternehmenseite mit massiven Massenausperrung beantwortet. Diese Massenausperrungen bedrohten die Gewerkschaft IG Metall existentiell, wollte sie an alle von Aussperrung betroffenen Mitglieder Aussperrungsunterstützung zahlen. Gegen die massiven Aussperrungen richteten sich die Klagen der betroffenen IG Metall Mitglieder.
In dem daraufhin ergangenen, sog. ,,Aussperrungsurteil" vom 10.06.198026, stellte das BAG zum erstenmal fest, dass Streikrecht sei im Kern des Art. 9 III GG gewährleistet, da unter bestimmten Umständen ein Streik zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Interessen unerläßlich sein könne, anders ausgedrückt, ohne die Möglichkeit des Streiks verkämen Verhandlungen zwischen den Tarifparteien zum ,,kollektiven Betteln"27. Das Gericht bejaht in seiner Entscheidung, das Recht der Unternehmenseite auf Aussperrung auf Grund der Verhandlungsparität; wegen deren Konkurrenzsituation untereinander im Gegensatz zu den übereinstimmenden Interessen der Gewerkschaftsmitglieder und deren hohes Solidaritätsmaß seien die Unternehmen in einer geschwächten Position. Allerdings beschränkt das BAG dieses Aussperrungsrecht durch die Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgebotes mit der Festlegung bestimmter Qotenregeln, nach der der Unternehmenseite nur eine im Verhältnis zu den Streikenden stehende Reaktion durch Aussperrung gegeben ist.
Obwohl sich diese Entscheidung ausdrücklich in die Linie der Grundsatzentscheidungen des BAG einreiht28, kann diese Entscheidung als eine ,,moderate Akzentverschiebung" zur vorherigen Rechtsprechung angesehen werden, ,,die versucht, objektiven und subjektiven Veränderungen in gewissem Umfang Rechnung zu tragen"29.
3.4. Streikrecht ist Zweck der Koalition
Mit der Entscheidung des BVerfG vom 26.06.199130 wird die Rechtsprechung des BAG im wesentlichen bestätigt und weitergeführt. Das Gericht erkennt ausdrücklich das tarifrechtliche Streikrecht als Zweck der Koalition aus Art. 9 III GG an und geht in seiner Entscheidung über den im Urteil des BAG vom 10.06.1980 beschriebenen Kernbereich hinaus. Das Gericht formuliert einen verfassungsmäßigen Schutz der Koalition ,,in ihrem Bestand, ihrer organisatorischen Ausgestaltung und ihrer Betätigung"31. Arbeitskämpfe seien allgemein erforderlich, um eine funktionierende Tarifautonomie zu gewährleisten. Hinsichtlich der Entscheidung des BAG zur Aussperrung nach dem Verhältnismäßigkeitsgebot, erklärt das BVerfG diese ,,verfassungsrechtlich <als> nicht zu beanstanden". Es erklärt die Tarifautonomie als darauf ausgerichtet, die strukturell bedingte Unterlegenheit einzelner ArbeitnehmerInnen durch kollektives Handeln gegenüber den Unternehmen auszugleichen. Das Gericht sieht die Gefahr, dass ein Ungleichgewicht in Arbeitskämpfen die ,,Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie beeinträchtigt"32.
3.5. Folgerungen
Nach dem Vorgenannten komme ich zu dem Ergebnis, dass an einem, den durch die Rechtsprechung festgelegten Prinzipien folgenden, legalen Streik folgende Bedingungen geknüpft sind: Es muß sich um ein tariflich regelbares Ziel handeln, der Streik muß von einer Gewerkschaft getragen sein, er darf nicht gegen die Friedenspflicht oder die guten Sitten verstoßen, es muß eine Urabstimmung vorausgegangen sein, die Verhältnismäßigkeit muß gewahrt sein und er muß frei von Willkür sein, der Streik unterliegt dem ultima Ratio Prinzip und darf die Sicherung von sog. Erhaltungs- und Notstandsarbeiten nicht beeinträchtigen oder gar gefährden.
Festzustellen ist, dass sich das Arbeitskampfrecht der BRD einen sehr eingegrenzten Bereich umfaßt, der sich nicht umfassend auf die in Art. 9 III GG genannten Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen erstreckt.33
4. Folgewirkungen von Streiks und die Gefahr der Aushöhlung des Streikrechtes
In den folgenden Abschnitten soll dargestellt werden, dass das Streikrecht, hier vor allem die vom BVerfG festgestellte ,,Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie", durch weitere nicht unwesentliche Entwicklungen in der Rechtsprechung gefährdet wird.
Eine der häufigsten Folgewirkungen von Arbeitskämpfen, sind Produktionsausfälle in nicht an der Tarifauseinandersetzung beteiligten Betrieben. Die sogenannte ,,kalte Aussperrung" stellt ein erhebliches Problem in der momentanen Arbeitskampfrechtsprechung dar. Der technologische Wandel, die Beschleunigung und Verdichtung der Kommunikation, neue Produktionsformen, all dies führt zu einer größeren Bedeutung von Folgewirkungen eines Arbeitskampfes.
Daraus ergeben sich für die Rechtsprechung im wesentlichen folgende Problembereiche:
Haben ArbeitnehmerInnen eines Betriebes der von den Folgen eines Arbeitskampfes betroffen ist, Anspruch auf Fortzahlung ihres Entgeltes durch den Arbeitgeber, wenn Sie selbst nicht Beteiligte des Arbeitskampfes sind?
Besteht nach § 87 (1) Ziff. 2 + 3 BetrVG ein MBR bei Arbeitsausfall auf Grund von Folgeoder Fernwirkung eines Arbeitskampfes?
Und, haben die so betroffenen Beschäftigten Anspruch auf Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit?
4.1. Sphärentheorie oder Arbeitskampfrisiko
§ 615 BGB sieht vor, dass ArbeitnehmerInnen die ihre Arbeitskraft ordnungsgemäß anbieten, grundsätzlich Anspruch auf die Zahlung der vereinbarten Vergütung haben, wenn der Arbeitgeber nicht in der Lage, oder nicht willens ist, die angebotene Arbeitskraft anzunehmen. Der Arbeitgeber kommt den anbietenden ArbeitnehmerInnen gegenüber in Annahmeverzug und ist zur Weiterzahlung verpflichtet.
Doch bereits das RAG der Weimarer Republik, entwickelte eine sog. ,,Sphärentheorie", nach der die Beschäftigten eine gewisse Mitverantwortung für den Betrieb zu tragen hätten. Diese, auch ,,Betriebsrisikolehre" genannte Auffassung wurde aus den Mitwirkungsrechten des Betriebsrätegesetzes von 1920 abgeleitet. Das RAG war danach der Auffassung, dass sich aus der Verbundenheit der ArbeitnehmerInnen untereinander ergäbe, dass die Gefahren von Streikfolgen auf dem Verhalten der ArbeitnehmerInnen selber beruhe und daher auch von ihnen selbst zu tragen sei, auch wenn sie nicht beteiligt sind.34
Daraus folgt, dass ArbeitnehmerInnen dann keinen Anspruch auf die Fortzahlung der Vergütung haben, wenn die Störung auf einen anderwärts geführten Arbeitskampf durch die ,,Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer"Innen zurückzuführen ist.
In seinen frühen Rechtsprechungen wurde die ,,Sphärentheorie" durch das BAG übernommen.35 In der weiteren Entwicklung seiner Rechtsprechung stellt das BAG zwar in einer Entscheidung vom 22.12.198036 fest, dass das Betriebsrisiko grundsätzlich beim Arbeitgeber läge, dieses sei aber als allgemeines Risiko zu unterscheiden von dem speziellen Risiko des Arbeitskampfes. Dieses beinhalte allerdings nicht nur Streiks, sondern auch Aussperrungen. Nach dem Paritätenprinzip, entfalle aber die Leistungspflicht des Arbeitgebers. D.h., beeinflussen die Fern- und Folgewirkungen eines Arbeitskampfes die Verhandlungskraft, ist der Arbeitgeber berechtigt, Beschäftigung und Vergütung zu verweigern.
Der Arbeitgeber hat demnach die Unmöglichkeit einer Weiterbeschäftigung nachzuweisen, da es sich beim Arbeitskampfrisiko um einen Ausnahmetatbestand handelt37, was zunächst für die betroffenen ArbeitnehmerInnen eine Verbesserung darstellt, umgekehrt ist aber zweifelhaft ob ein solcher Nachweis des Arbeitgebers durch die Betroffenen zu widerlegen ist.
4.2. MBR bei Arbeitszeitveränderungen in Folge arbeitskampfbedingter Fern- und/oder Folgewirkungen
In dem bereits erwähnten Urteil des BAG vom 22.12.1980, wird durch das Gericht auch Stellung zu der Frage der Mitbestimmung nach § 87 (1) Ziff. 2 + 3 BetrVG genommen. Insbesondere bei Arbeitskampfbedingter Kurzarbeit oder Teilstillegung. Das Gericht geht davon aus, dass nach den vorher aufgestellten Grundsätzen über das Betriebs- und Arbeitskampfrisiko, Tatsache und Umfang von Veränderungen der Arbeitszeit und Einstellungen der Entgeltzahlungen im Ermessen der Betriebspraxis stehen. Nur insoweit dabei ein Handlungsspielraum bestehe, habe der Betriebsrat nur für die Umsetzung und die Modalitäten ein MBR i.S. des § 87 (1) Ziff. 1 + 2 BetrVG38.
4.3. Einschränkung des Streikrechts durch § 116 AFG
Bis 1984 war unstreitig, dass ArbeitnehmerInnen denen die Entgeltzahlung aus den vorgenannten Gründen vorenthalten wurde, Anspruch auf Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld) hatten. Der § 4 der zu § 116 AFG a.F. ergangenen Neutralitätsanordnung vom 22.03.1973 unterband die Zahlung solcher Leistungen nur für den Fall, dass diese den Arbeitskampf beeinflussen, wenn Gewerkschaften für die Betriebe einer Branche unabhängig von ihrer regionalen Lage die gleiche Forderung aufstellten.39 In der Arbeitskampfpraxis war diese Regelung jedoch kaum von Belang.
Dies änderte sich mit den Streiks der IG Metall 1984 zur Durchsetzung der 35-Stunden- Woche. Zwar waren auch hier die Forderungen in den Tarifbezirken von Unterschieden gekennzeichnet. Dennoch vertrat der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit (Franke) die Auffassung, dass der Anspruch auf die genannten Leistungen ruhe, wenn nach ,,Art und Umfang die gleiche Forderung" erhoben werde. Am 18.05.1984 erließ er einen entsprechen Erlaß40. Die Zahl der davon Betroffenen war groß. Neben den 55.000 in den Ausstand getretenen und den 170.000 ,,heiß" ausgesperrten ArbeitnehmerInnen, waren 300.000 mittelbar Betroffene ,,kalt" ausgesperrt.41 Die Gewerkschaft IG Metall erwirkte vor dem LSG
Frankfurt/Main eine einstweilige Anordnung am 22.06.1984, über die Unrechtmäßigkeit des sog. ,,Franke-Erlasses"42.
1986 wurde der § 116 AFG neugefaßt und entsprach nun dem ,,Franke-Erlaß". Damit war nun normativ geregelt, dass Leistungen der BA bei Arbeitskampffernwirkungen entfallen, wenn die aufgestellten Forderungen ohne übereinzustimmen, nach Art und Umfang gleich sind. Gegen diese Neuregelung legte die IG Metall Verfassungsbeschwerde ein. Das BVerfG stellte mit seiner Entscheidung vom 04.07.1995 die Verfassungsmäßigkeit des neuen § 116 AFG fest.43 Das Gericht sieht zwar dadurch die Parität als gefährdet an, eine verfassungswidrige Störung der ,,Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie" kann es jedoch noch (sic!) nicht erkennen. Es beurteilt also sehr wohl, dass die Kampfparität durch die Gesamtentwicklungen in technologischer und wirtschaftlicher Hinsicht, eingeschränkt ist, da gerade der hohe Grad an Verflechtungen, hier der Metallindustrie, regelmäßig zu Produktionsausfällen, auch außerhalb der umkämpften Tarifgebiete, führt44. Die Parität sei aber noch gewahrt, da die stattgefundenen Arbeitskämpfe nicht zu einer exitensbedrohenden Fernwirkung geführt haben, sondern allgemein als erfolgreich für die Gewerkschaft angesehen werden.45 Diese Entscheidung läßt erhebliche Zweifel aufkommen. Es stellt sich nach dieser Entscheidung die Frage, wie eine Gewerkschaft in einem eng verknüpften Bereich nach der entstandenen Rechtslage trotz Streik ,,die soziale Katastrophe für viele und den finanziellen Ruin für die Gewerkschaft"46 aufhalten kann, wenn auch letztlich damit der Beweis angetreten wird, dass die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie gestört war. Aus dieser Situation folgt, dass Überlegungen anzustellen sind, ob mit der Änderung des § 116 AFG die Lehre vom Betriebs- und Arbeitskampfrisiko in Frage zu stellen sei und somit ein Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung aus § 615 BGB herzuleiten ist - entgegen der BAG- Entscheidung vom 22.12.1980. Dabei ist auch ungeklärt, die Vereinbarkeit mit der Eigentumsgarantie von Versicherungsleistungen wie sie die Leistungen der BA darstellen, oder die Vereinbarkeit mit Art. 6 Ziff. 4 der ESC und das ILO-Übereinkommen Nr. 8747
4.4. Folgerungen für die Druckfähigkeit von Gewerkschaften
Die vorgenannte Entwicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung zeigt, dass es bereits einige beachtliche Einschränkungen des Streikrechts gibt. Dies zwar nicht dadurch, dass die Möglichkeit des Streiks grundsätzlich ausgeschlossen würde, sondern durch die Teilweise für die Streikende Gewerkschaft und insbesondere für die mittelbar oder unmittelbar vom Streik betroffenen ArbeitnehmerInnen.
Allerdings ist die Position und Kampfkraft der Gewerkschaften nicht nur durch die Rechtslage geschwächt. Die seit nun länger als 20 Jahren anhaltende Massenarbeitslosigkeit, die Umstrukturierung und Vernichtung von Arbeitsplätzen, eine steigende Anzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, die Zunahme befristeter Beschäftigung und die Zunahme sogenannter freier oder selbständig Beschäftigter und die damit einher gehende Aushöhlung von Schutzbestimmung, haben die Kampf- und damit Streikbereitschaft der Beschäftigten herabgesetzt.48 Neue Technologien oder Vernetzungen bewirken Erleichterungen in der Fortführung der Produktion auch während eines Arbeitskampfes, so dass die Druckwirkungen von Streiks einen gut Teil verlieren49. Streiks werden dadurch zu einer verblassenden Größe. Dabei war die BRD noch nie ein ,,streikfreudiges" Land. Im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 1993 ergeben sich 37 Ausfalltage auf Tausend Beschäftigte pro Jahr. Nur in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz wird weniger gestreikt.50
In den letzten Jahren entwickelte sich aber der ,,Warnstreik" zu einem für die Gewerkschaften verhältnismäßig unproblematischen Kampfinstrument. Wesentlich war hierbei die sog. ,,Strategie der neuen Beweglichkeit", d.h. zeitlich und räumlich versetzt werden unterschiedliche Betriebe eines Tarifgebietes kurzfristig bestreikt. Insbesondere die IG Metall, die ÖTV sowie NGG und HBV machten diese Kampfform zum zentralen Punkt ihrer Strategie.51 Die Rechtsprechung des BAG52 hat darauf mit drei ,,Warnstreikentscheidungen" zu reagieren gehabt und diese im wesentlichen für rechtmäßig erklärt. Die darin aufgestellten Grundsätze für die Durchführung solcher Warnstreiks, lassen den Gewerkschaften einiges an Bewegungsmöglichkeit.
Dagegen tragen die Vertreter der Arbeitgeber und Unternehmen vor, dass nur ein ,,druckfreies Verhandeln" der Vertragsordnung entspräche, und dass die Gewerkschaften damit überschnell Verhandlungen für gescheitert erklären könnten. Der möglichen Argumentation von, nun überhaupt nicht mehr vorhersehbaren, Produktionsausfällen kann damit begegnet werden, dass diese wohl kaum in´s Gewicht fallen dürften. Teilweise muß der Schaden so Gering sein, dass sogar das Entgelt, für die Zeit des Ausfalls, weiter gezahlt wird, da der Aufwand die Entgeltabrechnungen zu ändern, höhere Kosten verursacht als dadurch eingespart werden könnten.53
Trotz der im vorliegenden für die ArbeitnehmerInnenseite durchaus günstigen
Rechtsprechung, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Druckwirkungen eines sog. [meist unbefristeten] Erzwingungsstreiks ungleich größer ist, in Relation zum Warnstreik. Eine Beschränkung der Warnstreikmöglichkeiten durch die Rechtsprechung führt m.E. nur zu einer reinen Machtdemonstration der Unternehmenseite, tatsächliche Schäden würden dadurch wohl keine eingedämmt.
5. Die Forderung nach Einschränkungen des Streikrechts und die Suche nach ,,Arbeitskampfersatzmitteln"
5.1. Forderungen nach Einschränkung des Streikrechts
5.1.1.Zum Streik und seinen Schäden
Schon das BAG hat in der bereits angeführten Entscheidung vom 28.01.1955 bemerkt: Arbeitskämpfe seien ,,im allgemeinen unerwünscht, da sie volkswirtschaftliche Schäden mit sich bringen und den im Interesse der Gesamtheit liegenden sozialen Frieden beeinträchtigen."54 Mit der Eingangs dargestellten Forderung von Werner Stumpfe, bezieht sich dieser auf diese offensichtlich weit verbreitete Ansicht.
Auf den ersten Blick hin mag das Argument, des volkswirtschaftlichen Schaden überzeugen. Denn wo nicht mehr gearbeitet wird, wird nichts mehr produziert. Wo nichts Produziert wird, werden keine Werte geschaffen. Ergo: Streik gleich Verminderung des BSP. Dabei wird aber übersehen, dass die Auswirkungen von Streiks je nach Umständen unterschiedlich ausfallen. Zwei häufige Fallgestaltungen führen zu gar keinem oder nur zu geringen Schäden: Zum einen, fallen Streiks nicht selten in Zeiten des Auftragsmangels oder der Rezession. Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Streik damit dem Unternehmen durchaus willkommen. Verhindert er doch die Produktion von Überkapazitäten oder erspart die Einführung von Kurzarbeit.
Zum anderen, ist es nicht selten, dass die während eines Streiks ausgefallene Arbeit, im Anschluß wieder nachgeholt wird. Dabei werden unter Umständen Sonderschichten gefahren, die dem Unternehmen höhere Kosten in Form von Mehrarbeitsvergütung bedeuten. Der Schaden ist aber verhältnismäßig gering.
Darüber hinaus, sorgen die meisten Unternehmen selbst für eine Schadensabwehr in dem sie für die Dauer des Streiks sogenannte Streikhilfeabkommen abschließen, die jeglichen Wettbewerb während des Arbeitskampfes einfrieren55
Wird in die Überlegung noch die Tatsache der relativen Kürze und Seltenheit von Streiks in der BRD einbezogen, so sind die angeführten Befürchtungen für die Volkswirtschaft nicht nachvollziehbar.
Der angebliche volkswirtschaftliche Schaden wird ad absurdum geführt, wenn festzustellen ist, dass die ca. 5,6 Mio. Streik- und Aussperrungstage, die insgesamt 1984 anfielen, soviel bedeutete, als wenn der auf einen Sonntag fallende 17. Juni zu 25 bis 30 % wieder rückgängig gemacht worden wäre, umgerechnet auf alle sozialversicherungspflichtigen ArbeitnehmerInnen.56
5.1.2. Das Recht auf Eigentum und der Arbeitskampf
Gegen das Streikrecht wird häufig auch folgendes Argument in´s Feld geführt:
Der Streik verletze die ,,unternehmerische Freiheit". Grundlage hierzu ist Art. 14 I GG, konkretisiert durch § 823 (1) BGB und dem daraus abgeleiteten ,,Recht am eigenen und ausgeübten Gewerbebetrieb"57. Das Streikrecht als Grundrecht aus Art. 9 III GG führe demnach zu einer Einschränkung des Eigentums die einer Enteignung gleich komme, wenn durch Druckausübung der Gewerkschaften und der ArbeitnehmerInnen, Einfluß auf die unternehmerische Freiheit, insbesondere in Wirtschaftsfragen genommen werde58. Diese Argumentation ist aber bereits unter verfassungsrechtlicher Betrachtung nicht haltbar. Durch das Sozialstaatsgebot des Art. 20 III GG ist die gleichberechtigte Einwirkung auf die in Art. 9 III GG formulierte ,,Wahrung und Förderung der Wirtschaftsinteressen" verankert.59 In Wechselwirkung ist davon auszugehen, ,,dass das ... Grundrecht auf Koalitionsfreiheit als der prägnanteste Ausdruck" des Sozialstaatsgebotes gilt.60
Allerdings haben solche Diskussionen bestenfalls verfassungsakademischen Wert. Für die heutige Situation geben sie wenig her. Die zaghaften Änderungen in Bezug einer Anerkennung des durch die Verfassung geschützten Streikrechts und die Benennung struktureller Unterlegenheit der Gewerkschaften in der Kampfparität, sind mit den o.g. Entscheidungen in den letzten Jahren soweit zurückgenommen worden, dass, wie ausgeführt, ein Streik zum finanziellen Fiasko der Gewerkschaft werden könnte.
Daher, hat die Annahme das Streikrecht beschränke die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit der Unternehmen, wenig Relevanz.
5.2 Arbeitskampfersatzmittel
Der Eingangs zitierte Arbeitgeberpräsident Werner Stumpfe, ist dort der Auffassung, dass Arbeitskampfersatzmittel gefunden werden müßten, die dazu führen, dass der Streik nicht mehr gebraucht würde.
Leider hat er versäumt solche vorzuschlagen, bzw. zu beschreiben welche dies sein könnten. Auch mehrmaliges Nachfragen bei der Pressestelle und der ,,Tarifabteilung", des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, durch den Autor dieser Arbeit, brachten solche Vorschläge nicht zu Tage.
So ist der Autor dieser Arbeit in der mehr oder weniger glücklichen Lage, eigene
Überlegungen über solche Arbeitskampfersatzmittel anzustellen. Im wesentlichen betreffen diese Überlegungen drei Punkte:
- Gesetzliche Verbote von Streiks
- Gesetzliche Regulierung des Arbeitskampfes durch ein Verbände- oder Arbeitskampfgesetz
- Die Übernahme von Streikverzichtsabkommen in Tarifvereinbarungen, wie sie teilweise in europäischen Nachbarländern üblich bzw. anzutreffen sind.
Den ersten Punkt werde ich hier nicht weiter behandeln, da dazu eine Änderung des Grundgesetzes notwendig wäre, zu der m.E. auch unter den derzeitigen politischen Verhältnissen in Deutschland keine Parlamentsmehrheit zustande käme. Im übrigen zeigt auch die historische Erfahrung, dass Streikverbote nicht dazu führen, dass Streiks aus dem gesellschaftlichen Leben verschwinden.
Etwas intensiver sollen die beiden anderen Punkte betrachtet werden.
5.2.1. Gesetzliche Regulierung des Arbeitskampfes durch ein Verbände- oder Arbeitskampfgesetz
Insbesondere nach den Streiks der IG 61 Metall und der IG DruPa 1984, ist vielfach die Forderung nach einem Verbände- bzw. Arbeitskampfgesetz erhoben worden. Damit war die Auffassung verbunden, der Gesetzgeber habe den Arbeitskampf in seinen wesentlichen Teilen gesetzlich zu regeln, da alle wesentlichen Angelegenheiten des Gemeinschaftsleben gesetzlich zu regeln seien.
Dabei wird übersehen, dass zahlreiche Einzelpunkte die den Arbeitskampf betreffen bereits gesetzlich, oder durch richterliche Rechtsfortbildung, geregelt sind.
Daher kann auch die Auffassung, der Gesetzgeber sei gerade zu von Verfassungs wegen zum Eingreifen verpflichtet nicht überzeugen.
Für die damit verbundene Hoffnung den ArbeitnehmerInnen, das durch Art. 9 III GG zugestandene Grundrecht der Koalitionsfreiheit (incl. Des Rechts auf Streik) einzuschränken, besteht m.E. ebenso wenig Anlaß. Dies käme einer Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes der Koalition (hier der Gewerkschaften) gleich und wäre wohl nur unter Änderung der Verfassung möglich. Wie einleitend bereits ausgeführt sind dazu (noch) keine parlamentarischen Mehrheiten vorhanden. Fraglich bleibt auch ob eine gesetzliche Einschränkung überhaupt in der Lage wäre, Streiks tatsächlich zu verhindern oder alleine ein Beitrag zur Kriminalisierung sei.
5.2.2. Streikverzichtsabkommen in europäischen Nachbarstaaten
Eine Möglichkeit im Interesse der Unternehmen, Streiks auszuschließen könnten sogenannte Streikverzichts- oder Friedensabkommen sein, wie sie etwa in Großbritannien oder in der Schweiz vereinbart sind. Diese Abkommen sind zwischen den Tarifparteien ,,frei" vereinbart und sehen bestimmte Regelungsmechanismen für die Bewältigung von Konflikten zwischen Arbeit und Kapital vor.
5.2.2.1 Großbritannien
Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen 62 der Regierung von Primeminister M. Thatcher und den Gewerkschaften im Anschluß an den Bergarbeiterstreik und im Zuge der Auseinandersetzungen um den Umzug der Produktion der ,,Times" und anderer Murdoch-Erzeugnisse, von der Londoner Fleet Street vor die Stadt nach Wapping, kam es zu einer kontrovers geführten Diskussion über den Abschluß sogenannter ,,Strike- Free-deals".
Hintergrund war die Tatsache, dass nach der Entlassung fast aller Beschäftigten von Rupert Murdoch´s Verlag und der Einstellung neuer ArbeitnehmerInnen am neuen Standort mit hochtechnisierten Anlagen, drei Gewerkschaften mit den ehemaligen Beschäftigten versuchten, den neuen Produktionsstandort zu blockieren und die Produkte zu boykottieren. Eine bisher lediglich durch wenige Mitglieder vertretende Gewerkschaft, die EETPU (Elektro-, Elektronik-, Telekommunikations- und Installateur-Gewerkschaft) einen solchen ,,Strike-Free-deal" abschloß.
In der Folge kam es auch in anderen Industriebereichen zum Abschluß solcher Streikverzichtsabkommen.
5.2.2.1.1. Inhalte der ,,Strike-Free-deals"
Diese beinhalten im wesentlichen folgende Punkte:
a. Vor dem Hintergrund des britischen Gewerkschaftssystem, in dem zumeist mehrere
Gewerkschaften im Betrieb vertreten sind, wurde vereinbart, das nunmehr nur noch eine
Gewerkschaft für diesen Betrieb zuständig sei. Das ,,Closed-Shop" System (alle Beschäftigten müssen ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft nachweisen um in diesem Betrieb tätig zu sein)
wird aufgehoben. (Single-Unionism)
b. Alle Beschäftigten sind, entsprechend ihren fachlichen Kenntnissen, an jedem Arbeitsplatz einsetzbar und haben die ihnen übertragenen Arbeiten auch auszuführen. Rotation der Arbeitsplätze ist obligatorisch. Es gibt keine Stellenbeschreibungen. Im Gegenzug wird die ständige innerbetriebliche Weiterbildung umfassend zugesagt. (Flexibility)
c. Die Bildung eines ,,advisory board" mit der Aufgabe im wesentlichen folgende Informationen zu erhalten (In diesen Ausschüssen sitzen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebervertreter) :
Unternehmensplan und -politik,
Unternehmenseffizienz im operativen Geschäft Personalplanung und Vorausschau
Arbeitsbedingungen, incl. Bezahlung und Gratifikationen Arbeitsumwelt und -platzgestaltung
d. Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten über bestehende Vereinbarungen oder zu deren Veränderungen, wird ein paritätischer Schlichtungsausschuß unter abwechselndem Vorsitz eingerichtet. Der Vorsitzende entscheidet letztgültig über Anträge, er kann nicht vermitteln nur entscheiden.
e. Beide Seiten vereinbaren auf jegliche Arbeitskampfmaßnahmen, wie Streik oder Aussperrung zu verzichten.
5.2.2.1.2. Bewertung
Tom Sawyer, stellv. Generalsekretär der nationalen Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (NUPE) beschreibt die oben bezeichnete Entwicklung wie folgt: ,,Streikverzichtsabkommen sind teil des `neuen Realismus, der eine gewieftere, sachlichere, nicht Parteigebundene Gewerkschaftsbewegung umfaßt. Wenn diese Vereinbarungen fortgesetzt werden, dann werden die Gewerkschaften als Arbeitnehmerorganisation bedeutungslos - sie werden Teil des Management."
Ken Gill, General Sekretär der TASS (Technik, Administrativ und Leitersektion), stimmt dem zu: ,,Der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Arbeiter ist das Recht seine Arbeitskraft zurückzubehalten. Auch wenn die Vereinbarungen über abwechselnde Schlichtungsverfahren nicht ausdrücklich den Streik verbieten, es obliegt beiden Seiten die Entscheidung des Schlichters zu akzeptieren, enthalten sie dadurch den Arbeitern ihr Recht der endgültigen Ablehnung."
Sawyer´s General Sekretär geht weiter: ,,Was solche Organisationen sagen ist, `Wir werden weniger militant sein, wir werden mehr entgegenkommend sein, wir werden tiefer und weiter kriechen, wenn ihr uns mehr Mitglieder gebt.´ Genauso wie ein Streikbrecher, der sagt: `Ich werde eben weniger Lohn akzeptieren, wenn Du mir den Job gibst.´ Es ist die Verleugnung des Kollektivismus, es die Verleugnung des Grundsätzlichen Gewerkschaftskonzepts, so weit als möglich, faire Vereinbarungen zu erreichen."63
Der Generaldirektor der EEF (Verband der Elektroarbeitgeber) argumentiert, sie ermöglichen den Arbeitgebern, moderate und fortschrittlich denkende Gewerkschaften auszusuchen, mit denen er von Beginn an in der Behandlung der verschiedenen Aspekte der Kultur industrieller Beziehungen, Beteiligung der Beschäftigten, Harmonisierung und Flexibilisierung der Arbeit, übereinstimmen kann. Die Arbeitgeber sahen diese Abkommen als Sicherheit, dass Gewerkschaften sich innerhalb einer für die Unternehmensziele günstigen Struktur entwickeln würden: Die richtige Gewerkschaft zu haben, engagiert an den Unternehmenszielen, ist entscheidend.
Bei `Yuasan Batteries´in Südwales bemerkten die Arbeitgeber, dass ihr eigenes System nicht in der Lage war, die Arbeiterschaft wirkungsvoll zu kontrollieren, so dass sie die EETPU [Elektro-, Elektronik-, Telekommunikation und Installateur-Gewerkschaft] hereinholten, um, als Transmissionsriemen des Management, die Beschäftigten zu motivieren und die Belegschaftsaufgaben zu erfüllen.
Die Unterstützer behaupten, dass sie den einzigen Weg vertreten, dass Gewerkschaften in den expandierenden Bereichen der Industrie Mitglieder bekommen. Sie etablierten industriellen Frieden. Alle Beschäftigten bekämen monatliche Bezahlung, werden Gehaltsempfänger. Die Betonung von Ausbildung ist besonders positiv. Neue, betriebliche Beratungsausschüsse, sehen Beratungen bevor Schlüsselentscheidungen gefällt werden vor und schaffen eine kooperative und produktive Atmosphäre.
Kritiker vertreten die Auffassung, diese Vereinbarungen beinhalten die Aufgabe der fundamentalen menschlichen Freiheit seine Arbeitskraft zurückzubehalten; Gewerkschaften betonten ihre Schwäche und werden zum verlängerten Arm der Firmenleitung. Welche Art von Gewerkschaftsvertretung ist möglich, wenn die Unternehmer die Gewerkschaft herausgreifen mit der sie verhandeln wollen? Weil dann manchmal eine Abstimmung der Beschäftigten über die Unternehmensentscheidung stattfindet, das ist eine manipulierte Übung. Einige Gewerkschaften hatten diese Abkommen widerwillig zu akzeptieren., die AEEU drückte diese dem Management auf. Konsequente Öffentlichkeitsarbeit ermutigte mehr Manager eine Übernahme zu überlegen.
Streikverzichtsabkommen sollten nicht überschätzt werden. 1986 schätzte die EETPU, dass weniger als 20.000 Beschäftigte unter diese Vereinbarungen fielen und die Anzahl der `Model´-Vereinbarungen unter 30 lag - und Streiks fanden in Unternehmen die unter diese Vereinbarungen fielen trotzdem statt. Es gab auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Arbeiter überzeugt wurden ihre Mitgliedschaft aufzugeben. ,,Single Union" Vereinbarungen mögen die Zukunft vertreten, aber die `Model´-Vereinbarungen sind gegenwärtig rar: nur 1% aller Arbeitsplätze haben ein abwechselndes Schiedsverfahren, nur 17 % mit ,,Single Union" Vertretung haben Unternehmensausschüsse, und kaum jemand hat das volle ,,Single Union" Paket.
5.2.2.2 Schweiz
Auch in der Schweiz gibt es im Rahmen von Tarifverträgen, Gesamtarbeitsverträge genannt, Abkommen die Arbeitskampfmaßnahmen ausschließen. Diese Abkommen werden als ,,Friedensabkommen" bezeichnet uns haben eine lange Tradition. So wurden die ersten Abkommen dieser Art, bereits in der Mitte der 1930er Jahre abgeschlossen und sind inhaltlich bis heute kaum verändert worden.
5.2.2.2.1. Inhalte der Friedensabkommen
Als Beispiel soll hier die ,,Vereinbarung in der Maschinenindustrie" vom 1. Juli 1993 angeführt werden. Dort heißt es in Art. 2:
,,1 Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung des Arbeitsfriedens und verpflichten sich, diesen unbeschränkt zu wahren und zu seiner Einhaltung auf ihre Mitglieder einzuwirken. Infolgedessen sind jegliche Kampfmaßnahmen ausgeschlossen, und zwar auch in Fragen, die durch die Vereinbarung nicht geregelt werden.
2 Der absolute Arbeitsfriede gilt auch als Verpflichtung der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
3 Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung beizulegen."64
Diese Vereinbarungen unterstehen dem Prinzip von ,,Treu und Glauben"65, dass die Vertragsparteien verpflichtet, ihre Gegenseitigen Interessen verständnisvoll zu würdigen.
Im weiteren, sind in diesen Verträgen geregelt, dass allen ArbeitnehmerInnen, insbesondere den nicht in einem ArbeitnehmerInnenverband organisierten, ein Solidaritätsbeitrag von ca. DM 6,50 im Monat einbehalten wird, der in einen gemeinschaftlich verwalteten Fond eingezahlt wird.
Diese Verträge regeln auch die beiderseitige Koalitionsfreiheit, die betriebliche Mitwirkung der ArbeitnehmerInnen, Kündigung und Entlassung, die berufliche Aus- und Weiterbildung. Kernpunkt der Friedensabkommen sind die zumeist dreistufigen Schieds- oder Schlichtungsverfahren. Die drei Stufen sind: Betriebliche Schlichtung, Betriebliche Schlichtung unter Hinzuziehung von BeraterInnen der Tarifparteien, Schiedsgericht der Tarifparteien auf nationaler Ebene. Die Schlichtungsverfahren werden immer paritätisch durchgeführt, auf nationaler Ebene einigen sich die Tarifparteien auf ein paritätisches Schiedsgericht, bestehend aus je einer/einem VertreterIn der Tarifparteien und einem/einer Präsidenten/in, auf die sich beide Seiten geeinigt haben. Die Entscheidungen des Schiedsgericht sind bindend.
5.2.2.2.2. Bewertung
Tatsächlich sind in der Schweiz seit bestehen solcher ,,Friedensabkommen" Arbeitskämpfe seltener geworden. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass dies auch in anderen europäischen Ländern, so auch in der BRD, gemessen an dem Zeitraum, der Fall war und ist. Darüber hinaus, muß bei der Bewertung der Schweizer Situation, die wirtschaftliche Ausnahmestellung die dieses Land in Europa zweifelsohne hat, gesehen werden.
Ebenso wie in anderen europäischen Ländern, haben aber auch diese Abkommen in der Schweiz nicht dazu geführt, dass Streiks vollkommen aus dem gesellschaftlichen Leben verschwunden sind. So gingen im Geltungsbereich der oben zitierten Vereinbarung, im Zeitraum von 1978 bis 1991 im Durchschnitt ca. 1700 Arbeitstage pro Jahr durch Streiks ,,verloren"66.
6. Geht das Streikrecht also zu weit?
6.1. Deutscher Sonderweg und übernationale Vereinbarungen
Betrachtet man sich die Inhalte der oben geschilderten Streikverzichtsabkommen, so muß man feststellen, dass vieles von dem was dort vereinbart wurde, in der BRD durch Gesetz geregelt ist. Sei es, die betriebliche Mitwirkung der ArbeitnehmerInnen, seien es Regelungsfragen der Aus- und Weiterbildung, seien es Informationsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen.
Wie dargestellt, sind auch in der BRD, vor einen Arbeitskampf durch Rechtsprechung, Abläufe vorgesehen die alle darauf hinauslaufen, Arbeitskämpfe nach Möglichkeit zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es in einer Vielzahl von Tarifverträgen Vereinbarungen über Schlichtungsverfahren zur Regelung von Tarifauseinandersetzungen. Und auch dort wo es diese nicht gibt, unterwerfen sich Gewerkschaften häufig einem solchen Schlichtungsverfahren bevor sie die Möglichkeit eines Arbeitskampfes nutzen. Auch im Verhältnis zu einer Vielzahl europäischer Nachbarstaaten, ist das Grundverständnis von Streiks in Deutschland ein anderes67.
Vor dem Hintergrund, des einheitlichen europäischen Marktes, der nicht nur einheitlicher Wirtschafts- und Steuernormen bedarf, sondern auch einheitlicher Sozialvorschriften, ist festzustellen, dass die in der BRD geltenden Rechte zum Arbeitskampf hinter den bereits geltenden europäischen und internationalen Normen zurückbleiben. Nach Art. 6 Nr. 4 der ESC, ist das Streikrecht für alle gewährleistet, und schon 1983 bekräftigte der Sachverständigenausschuß zum ILO-Übereinkommen Nr. 87, dass das Streikrecht wesentliches Mittel zur Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Interessen ist.68
Auch nach Art. 5 des EG-Vertrag sind alle Mitgliedstaaten zu gemeinschaftlichen Verhalten verpflichtet, was zu einer Rechtsprechung führt im Sinne einer Öffnung nach Europa. Daher ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland das Streikrecht eher eine Erweiterung erfahren muß.69
6.2. Gesellschaftlicher Nutzen von Streiks
In der Diskussion darüber ob das Streikrecht in Deutschland zu weitgehend ist, muß auch über die konfliktreduzierende Wirkung von Arbeitskämpfen nachgedacht werden. In Zeiten wirtschaftlicher Rezession werden sich die Konflikte und Interessengegensätze kaum wirklich unterdrücken lassen.70 Auf der anderen Seite steht die Sorge um die ,,Störung der guten Ordnung", mit der `Gefahr´, dass die ArbeitnehmerInnen mit einer gemeinsamen, solidarischen und positiven Streikerfahrung, die bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen und insbesondere ihre betriebliche Unterordnungserfahrung in Frage stellen.71 Gerade die Proteste und Arbeitskämpfe der letzten Wochen und Monate - Bergarbeiter, Bauarbeiter, Stahlarbeiter, Beschäftigte der Süßwarenindustrie, Beschäftigten der Deutschen Bank AG, usw. - haben deutlich gemacht, dass sich eine gewisse Unzufriedenheit über die derzeitige Situation unter den ArbeitnehmerInnen breit macht, gegen die Rücknahme von bereits erkämpften Rechten die bis vor kurzem noch für alle Beteiligten scheinbar selbstverständlich waren.
Unabhängig von den Rechten, die den ArbeitnehmerInnen einen gewissen Schutz gewähren, stellt der Streik eine Besonderheit dar, die sich aus ihm selbst ergibt. Er ist das Mittel mit dem die Beschäftigten Übergriffe auf ihre Rechte abwehren und zurückdrängen könnten. Wenn also der Arbeitgeberverbandspräsident Werner Stumpfe, eine Einschränkung des Streikrechts durch Arbeitskampfersatzmittel fordert (die wie beschrieben Streiks nicht verhindern), dann muß die Frage gestellt werden, ob es ihm dabei wirklich um die Verhinderung Volkswirtschaftlicher Schäden geht. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass damit der Wunsch verbunden ist, leichter als bisher Rechte und soziale Sicherheiten der Beschäftigten zurückzudrängen und sich der noch relativ starken Position des gewerkschaftlichen Gegenparts entledigen zu können.
Vor diesem Hintergrund sind Äußerungen, wie die des Herrn Stumpfe, auch eher politisch als juristisch zu bewerten. Sie mögen noch vereinzelt sein und in der Masse der täglichen Nachrichten untergehen. Aber insbesondere die Auswirkungen solcher Äußerungen auf die öffentliche Meinung und besonders die Rechtsprechung werden zu beobachten sein.
Daher kann m.E. nicht die Rede davon sein, dass das derzeitige Streikrecht zu weit ginge. Mit allen bestehenden Einschränkungen, ist es für die ArbeitnehmerInnen ein wichtiges Schutzund Druckmittel ihre Interessen wirkungsvoll deutlich zu machen.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LITERATURVERZEICHNIS
Blank, Fangmann (+), Hammer, Grundgesetz, 2. Auflage, Köln 1996 Brox / Rüthers, Arbeitskampfrecht, 2. Auflage, Stuttgart 1982 Däubler, Wolfgang, Arbeitsrecht 1, 14. Auflage, Reinbek 1995 Gesamtarbeitsvertrag für den Geleisbau, Bern 1994
Gesamtarbeitsvertrag für die schweizerische Möbelindustrie, Bern 1992 Hesselberger, Das Grundgesetz, 10. Auflage, Neuwied/Bonn, 1996 John Mellraoy, Trade Unions in Britain today, Manchester and New York, 2nd ed. 1990, S 114 - 116 (Übersetzung durch den Verfasser) Landesmatelvertrag für das Bauhauptgewerbe, Bern 1993
Philip Bassett, STRIKE FREE - New industrial relations in Britain, 2nd ed., London 1987
(Übersetzung durch den Verfasser)
Sauga, Michael, Webfehler im System, Wirtschaftswoche 52 / 96, S. 44 ff.
Schaub, Günter, Arbeitsrechtshandbuch, 8. Auflage, München 1996
Seifert, Hömig, Grundgesetz, 5. Auflage, Baden-Baden, 1995
Spitzenreiter Italien, Streiks / Internationaler Vergleich, Handelsblatt, 7.03.1995
Stumpfe, Werner in: Heinemann, Christoph, Wollen Sie das Streikrecht abschaffen?, Interview, Junge Welt 10.12.1996, S. 2
Vereinbarung in der Maschinenindustrie, Bern 1993
Zachert, Ulrich, Der Streit um den Streikparagraphen - eine Zwischenetappe! ZRP 1995, S. 445 ff.
Schwierigkeiten mit dem Arbeitskampf, ArbuR 1990, S. 77 ff. Zöllner / Loritz, Arbeitsrecht, 4. Auflage, München 1992
[...]
1 Vgl. Sauga, Michael, Webfehler im System, Wirtschaftswoche 52/96, S. 44 ff.
2 Stumpfe, Werner, in: Christoph Heinemann: Wollen Sie das Streikrecht abschaffen? Interview in: Junge Welt, 10.12.96, S.2
3 Schaub, Günter, Arbeitsrechtshandbuch, S. 1610
4 Zöllner / Loritz, Arbeitsrecht, S. 400
5 Däubler, Wolfgang, Das Arbeitsrecht 1, S. 80, Rn. 77
6 Däubler, a.a.O., S. 82, Rn. 81
7 Däubler, a.a.O., S. 83, Rn. 83
8 Däubler, a.a.O., S. 86/87, Rn. 90
9 Däubler, Wolfgang, Das Arbeitsrecht 1, S. 87, Rn. 91
10 vgl. Stenographisches Protokoll der 17. Sitzung des PR vom 3.12.1948, zit. n. Brox/Rüthers S. 32
11 Blank, Fangmann, Hammer, Grundgesetz, 2. Auflage, Köln, 1996, Art. 9 III, Rn 18
12 Seifert, Hömig, Grundgesetz, 5, Auflage, Baden-Baden, 1995, Art. 9 III, Rn 13
13 BVerfGE 44, 341; 84, 224, 228
14 Seifert, Hömig, Grundgesetz, a.a.O. Rn 14
15 BVerfGE 88, 114)
16 Hesselberger, Das Grundgesetz, 10.Auflage, Neuwied/Bonn, 1996, Art. 9 III GG, Rn 10
17 Zachert, Uli, Schwierigkeiten mit dem Arbeitskampf, in ArbuR ´90, S. 84
18 vgl. Däubler, a.a.O. S.92 , Rn 103
19 vgl. Hesselberger, Das Grundgesetz, a.a.O.
20 Seifert, Hömig, Grundgesetz, a.a.O.
21 BVerfGE 84, 224 ff.
22 BAG 28.01.1955, AP Nr. 1 zur Art. 9 GG Arbeitskampf
23 BAG 21.04.1971, AP Nr. 43 zu Art. 9 GG Arbeitskampf
24 ebenda, III B 1 der Urteilsbegründung
25 ebenda, III A 1b der Urteilsbegründung
26 BAG 10.06.1980, AP Nr. 64 zu Art. 9 GG Arbeitskampf
27 Däubler, Wolfgang, Das Arbeitsrecht 1, S. 272, Rn 479
28 vgl. BAG 10.06.1980, a.a.O. unter 2. b) der Urteilsbegründung
29 Zachert, Uli, Schwierigkeiten mit dem Arbeitskampf, in ArbuR 1990, S.81
30 BVerfG 26.06.1991, BVerfGE 84 , 212
31 ebenda, unter C I 1a der Urteilsbegründung
32 ebenda, unter C I 3b aa der Urteilsbegründung
33 vgl. Zachert, Uli, a.a.O. S. 81
34 vgl. RAG 20.06.1928, ARS 3, 122; auch RG 06.02.1923, RGZ 106, 272 f.
35 vgl. Däubler, a.a.O., S. 326 Rn 571
36 BAG 22.12.1980, DB 1981, 321 ff.
37 vgl. Däubler, a.a.O., S. 330 Rn 578
38 BAG 22.12.1980, a.a.O. hinter II der Urteilsbegründung
39 vgl. Däubler, a.a.O. S. 333 Rn 587
40 vgl. Däubler, a.a.O. S. 534 Rn 589
41 vgl. Zachert, Uli, Der Streit um den Streikparagraphen, ZRP 1995, S. 445
42 LSG Frankfurt 22.06.84, DB 1984, 1582
43 BVerfG 04.07.1995, DB 1995, 1464
44 ebenda, 2 aa der Urteilsbegründung
45 ebenda, 2 bb der Urteilsbegründung
46 Zachert, a.a.O. S. 445
47 vgl. Däubler, a.a.O. S. 336 Rn 591 f.
48 vgl. Däubler, a.a.O. S. 400 Rn 700
49 vgl. Zachert, Schwierigkeiten mit dem Arbeitskampf, a.a.O. S.81
50,,Spitzenreiter Italien", in: Handelsblatt vom 07.03.1995
51 vgl. Däubler, a.a.O. S. 309 Rn 541 f.
52 BAG 17.12.1981, AP Nr. 51 zu Art. 9 GG Arbeitskampf, BAG 12.09.1984, AP Nr. 81 zu Art. 9 GG Arbeitskampf, BAG 21.06.1988, DB 1988, 1952
53 vgl. Däubler, a.a.O.
54 BAG 28.01.1955, AP Nr. 1 zu Art. 9 GG Arbeitskampf
55 Däubler, a.a.O. S. 315 Rn 552 ff.
56 Däubler, a.a.O. S. 317 Rn 554 f.
57 vgl. BAG 28.01.1955, a.a.O. 3. der Urteilsbegründung
58 vgl. Zöllner, ZfA 1973, 236, hier nach Däubler, a.a.O. S.273 Rn 481
59 Däubler, a.a.O. S. 274 Rn 484
60 Simon, Helmut, zit. n. Zachert, Uli, Schwierigkeiten mit dem Arbeitskampf, in ArbuR 1990, S.85
61 vgl. zu allem nachfolgenden Däubler, a.a.O. S. 404 Rn 704 f.
62 vgl. zu allem nachfolgenden Mellraoy, Trade Unions in Britain today, S. 114 - 116; Bassett, Strike Free, S. 86 ff.;
63 Alle zit nach: Bassett, Strike Free, S. 2
64 Vereinbarung in der Maschinenindustrie (Herausgegeben von dem Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie und sechs verschieden ArbeitnehmerInnenorganisationen), 1993, S. 5; ähnliche Bestimmungen finden sich im Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe, § 8, Gesamtarbeitsvertrag für den Geleisbau, Art. 7, Gesamtarbeitsvertrag für die schweizerische Möbelindustrie, Art. 37.
65 Ebenda, Ingress (Präambel), S.4
66 vgl. ebenda S.77
67 vgl. Zachert, Schwierigkeiten im Arbeitskampf, a.a.O. S. 85
68 vgl. Däubler, a.a.O. S.282 Rn 498
69 ebenda, Rn 500 f.
70 vgl. Zachert, Schwierigkeiten im Arbeitskampf, a.a.O. S. 86
Häufig gestellte Fragen - Artikel 9 Grundgesetz - Geht das Streikrecht in Deutschland zu weit?
Was sind die zentralen Aussagen der Hausarbeit "Artikel 9 Grundgesetz - Geht das Streikrecht in Deutschland zu weit?"?
Die Hausarbeit untersucht das Streikrecht in Deutschland im Kontext von Artikel 9 III des Grundgesetzes (GG), der die Koalitionsfreiheit garantiert. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Streikrechts, dessen rechtliche Ausgestaltung durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und die Frage, inwieweit das Streikrecht durch Folgewirkungen und Gesetzesänderungen eingeschränkt wird. Zudem werden Alternativen zum Streik, sogenannte "Arbeitskampfersatzmittel," kritisch gewürdigt.
Welche historische Entwicklung des Streikrechts wird in der Hausarbeit dargestellt?
Die Hausarbeit beschreibt die Entwicklung von Arbeitskämpfen im Zusammenhang mit der Entstehung des Industrieproletariats, beginnend mit Streikaktionen im 19. Jahrhundert, über die Weimarer Reichsverfassung bis hin zur Zeit des Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Koalitionsfreiheit als Grundrecht in Artikel 9 III GG aufgenommen, obwohl das Streikrecht selbst nicht explizit erwähnt wurde.
Wie wird das Streikrecht durch Art. 9 III GG geschützt?
Obwohl Art. 9 III GG die Koalitionsfreiheit (Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen) garantiert, wird das Streikrecht nicht explizit erwähnt. Die Rechtsprechung, insbesondere des BAG und des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), leitet jedoch aus Art. 9 III GG und dem Sozialstaatsprinzip ein Streikrecht ab, da Arbeitskämpfe notwendig sind, um eine funktionierende Tarifautonomie sicherzustellen.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Streik rechtmäßig ist?
Laut der Rechtsprechung muss ein legaler Streik ein tariflich regelbares Ziel verfolgen, von einer Gewerkschaft getragen werden, nicht gegen die Friedenspflicht oder die guten Sitten verstoßen, eine Urabstimmung voraussetzen, verhältnismäßig und frei von Willkür sein, dem Ultima-Ratio-Prinzip entsprechen und die Sicherung von Erhaltungs- und Notstandsarbeiten nicht gefährden.
Welche Folgewirkungen von Streiks werden in der Hausarbeit untersucht?
Die Hausarbeit thematisiert die Produktionsausfälle in nicht am Streik beteiligten Betrieben (sog. "kalte Aussperrung"), die Frage der Entgeltfortzahlung an nicht streikende Arbeitnehmer, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei Arbeitsausfall und die Einschränkung des Streikrechts durch § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit bei Arbeitskampffernwirkungen entfallen lässt.
Was besagt die "Sphärentheorie" oder "Arbeitskampfrisiko" im Zusammenhang mit Streikfolgen?
Nach der Sphärentheorie tragen Arbeitnehmer eine gewisse Mitverantwortung für den Betrieb. Dies bedeutet, dass sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben, wenn der Arbeitsausfall auf einen anderweitig geführten Arbeitskampf zurückzuführen ist. Das BAG hat diese Theorie modifiziert, indem es das Betriebsrisiko grundsätzlich beim Arbeitgeber sieht, aber ein spezielles Arbeitskampfrisiko anerkennt.
Inwiefern schränkt § 116 AFG das Streikrecht ein?
§ 116 AFG (in seiner Neufassung von 1986) regelt, dass Leistungen der Bundesagentur für Arbeit bei Arbeitskampffernwirkungen entfallen, wenn die aufgestellten Forderungen nach Art und Umfang gleich sind, auch wenn sie nicht übereinstimmen. Das BVerfG hat die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung bestätigt, obwohl es die Kampfparität als gefährdet ansieht.
Welche Argumente werden gegen das Streikrecht vorgebracht?
Gegen das Streikrecht wird argumentiert, dass es volkswirtschaftliche Schäden verursacht, die "unternehmerische Freiheit" (Eigentum) einschränkt und einer Enteignung gleichkommt. Diese Argumente werden in der Hausarbeit jedoch kritisch hinterfragt und relativiert.
Welche "Arbeitskampfersatzmittel" werden diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert gesetzliche Verbote von Streiks, die gesetzliche Regulierung des Arbeitskampfes durch ein Verbände- oder Arbeitskampfgesetz sowie die Übernahme von Streikverzichtsabkommen in Tarifvereinbarungen, wie sie in Großbritannien und der Schweiz üblich sind. Diese Alternativen werden jedoch kritisch betrachtet und deren Umsetzbarkeit und Wirksamkeit in Deutschland in Frage gestellt.
Was sind die Inhalte von Streikverzichtsabkommen in Großbritannien und der Schweiz?
In Großbritannien umfassen "Strike-Free-Deals" meist die Anerkennung einer einzigen Gewerkschaft im Betrieb ("Single-Unionism"), flexible Arbeitszeitmodelle, die Bildung von Beratungsausschüssen und die Einrichtung paritätischer Schlichtungsausschüsse. In der Schweiz sehen "Friedensabkommen" den Ausschluss jeglicher Kampfmaßnahmen vor und regeln Schlichtungsverfahren in drei Stufen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit hinsichtlich der Reichweite des Streikrechts in Deutschland?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass das Streikrecht in Deutschland bereits durch zahlreiche Einschränkungen begrenzt ist und hinter den geltenden europäischen und internationalen Normen zurückbleibt. Es wird argumentiert, dass das Streikrecht für Arbeitnehmer ein wichtiges Schutz- und Druckmittel ist, um ihre Interessen wirkungsvoll durchzusetzen.
- Quote paper
- Roman Scharwächter (Author), 1997, Artikel 9 Grundgesetz - Geht das Streikrecht in Deutschland zu weit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95990