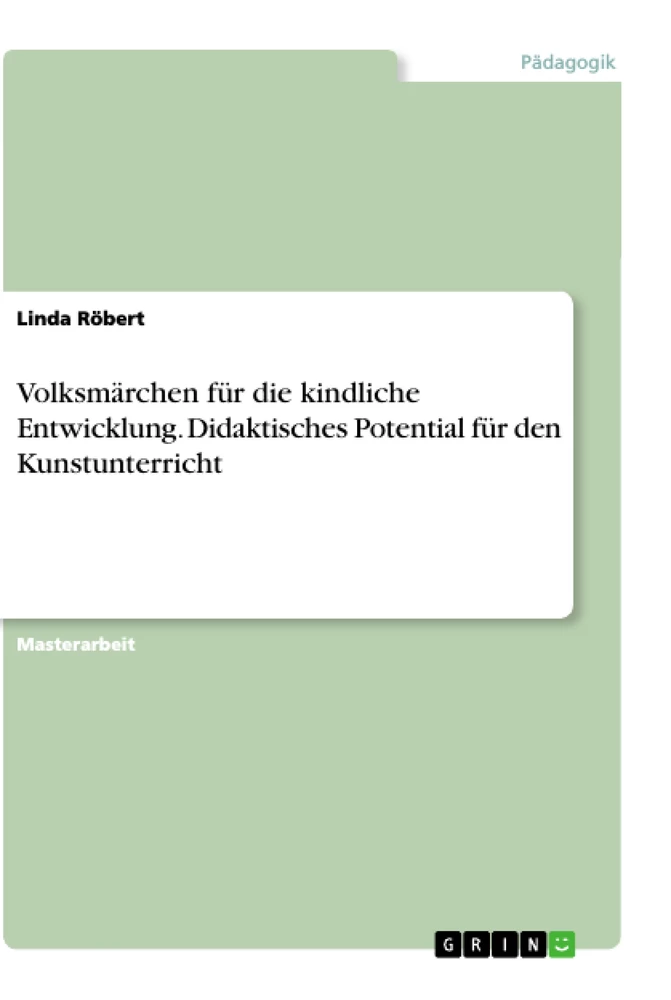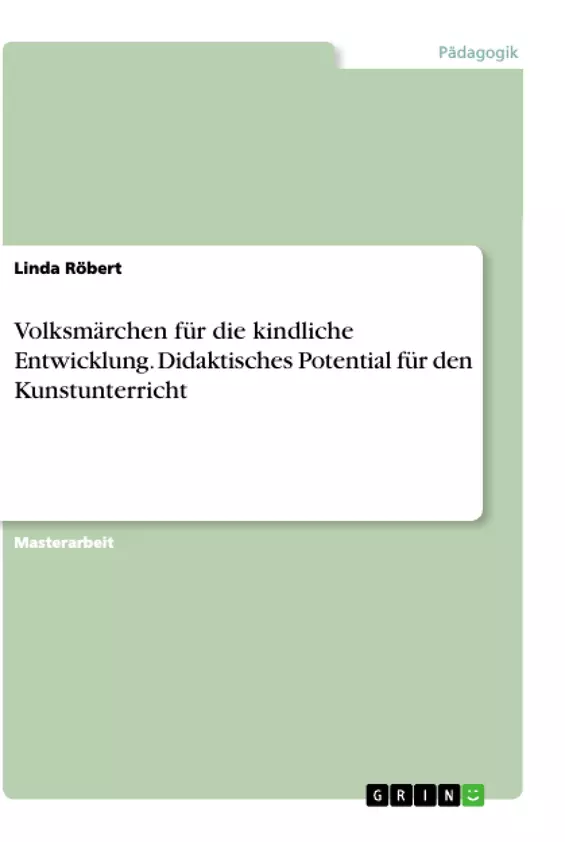Die Arbeit betrachtet das Thema Märchen aus der literaturwissenschaftlichen als auch der psychologischen Perspektive, um schließlich das pädagogische Potenzial der Märchen hinreichend erfassen zu können. Neben einer allgemeinen Begriffsbestimmung und einem kurzen geschichtlichen Abriss der Entstehungsgeschichte werden zunächst wesentliche Gattungsmerkmale vorgestellt. Nach der Frage der Aktualität der Märchen setzt das dritte Kapitel einen Fokus auf psychologische Theorien, die Entsprechungen zwischen dem Seelenleben des Kindes und der Erzählweise der Märchen bezeugen. Die Vertreter dieser Theorien sprechen den Märchen eine große Einflussnahme auf Kinder zu und erachten sie für die kindliche Entwicklung als notwendig. Das Märchen führt den Hörer in eine phantastische Welt, also eine Welt, die der realen gegenübersteht. Es handelt sich um eine aus der Fantasie entworfene Zauberwelt, in der sich reale Probleme oft widergespiegelt finden.
Nachdem das dritte Kapitel die Parallelen zwischen der märchenhaften Erzählweise und dem kindlichen Denken aufgezeigt hat, beleuchtet das vierte Kapitel die Schauplätze der Märchen als symbolisch aufgeladene Orte einer imaginären Welt. Der Wald, der See und der Berg werden auf diese Weise als märchenhafte Orte erfasst und beschrieben. Der letzte Teil der Arbeit setzt einen klaren fachdidaktischen Schwerpunkt. Er bietet eine exemplarische Unterrichtseinheit zu dem Thema Der verzauberte Märchenwald, die sich auf die Kompetenzerwartungen des Gymnasiums in NRW stützt. Darüber hinaus wurde die Unterrichtseinheit an einem städtischen Gymnasium im Sauerland in einer sechsten Klasse erprobt. Die einzelnen Unterrichtssequenzen werden daher zunächst methodisch-didaktisch erläutert und schließlich, nach der schulischen Erprobung, reflektiert. Das Kapitel gibt auf diese Weise Anregungen für die Vermittlung des Themas Märchen im Kunstunterricht im Allgemeinen als auch des Themas Märchenorte im Speziellen.
Die Schlussbetrachtung fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit kurz zusammen und zeigt in einem kurzen Ausblick zukünftige Perspektiven auf, die die Märchenarbeit mit Kindern, speziell im Kunstunterricht, erlaubt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Märchen als literarische Gattung
- Die Bedeutung des Wortes Märchen
- Entstehungsgeschichte der Märchen
- Literarische und allgemeine Gattungsmerkmale
- Ursprüngliche Funktion der Märchenerzählungen
- Die Aktualität der Märchen
- Die Allensbach-Studie
- Das Weiterleben der alten Märchen in den modernen Bildmedien
- Der interkulturelle Wert der Märchen
- Notwendigkeit der Märchen für die kindliche Entwicklung
- Das Märchenalter und die Fantasie des Kindes
- Märchen aus der Sicht der Tiefenpsychologie
- Die Archetypen des Unbewussten nach C.G. Jung
- Hilfe bei kindlichen Entwicklungsstufen
- Grausamkeit in Volksmärchen
- Märchen in der Bibliotherapie
- Die Märchenwelt - Orte der Verzauberung
- Der Märchenort als Projektionsfeld des Unbewussten
- Der Märchenwald
- Der Baum im Märchenwald
- Das Waldhaus
- Der See und das Element des Wassers
- Der (Glas-) Berg und das Symbol der Leiter
- Der verzauberte Märchenwald – eine exemplarische Unterrichtsreihe
- Die Thematisierung des Märchenwaldes im Kontext aktueller Vermittlungsfragen
- Legitimation durch den Lehrplan
- Die Lerngruppe
- Exemplarische Unterrichtsreihe
- Tabellarischer Verlaufsplan der Unterrichtsreihe
- Erste Stunde: Die Gebrüder Grimm und ihre Märchen
- Zweite Stunde: Fantasiestiftende Märchen
- Dritte Stunde: Illustrationen - Worte werden Bilder
- Vierte Stunde: Der Wald als Märchenort
- Fünfte Stunde: Franz Marc ,,Rehe im Wald‘‘
- Sechste Stunde: „Rehe im Wald II“ erste Schritte einer Bildanalyse
- Siebte Stunde: Der grüne Märchenwald
- Achte und neunte Stunde: Unheimliche Bäume und Geister im Märchenwald
- Praktische Abschlussarbeit
- Reflexion und Auswertung der Unterrichtsreihe
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die literarische Gattung des Märchens aus verschiedenen Perspektiven und analysiert den Einfluss der Märchen auf die kindliche Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf dem pädagogischen Potenzial der Märchen und ihrer Eignung als Unterrichtsgegenstand im Fach Kunst.
- Die Bedeutung und Geschichte des Märchens als literarische Gattung
- Die Aktualität der Märchen in der modernen Gesellschaft
- Der psychologische Wert der Märchen für die kindliche Entwicklung
- Der symbolische Gehalt der Märchenorte
- Die didaktische Umsetzbarkeit der Märchen im Kunstunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Märchen ein und stellt die Aktualität der Gattung in der modernen Gesellschaft dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Merkmale der Gattung und die Entstehung der europäischen Volksmärchen. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten psychologischen Theorien zur Märchendeutung vorgestellt und die Notwendigkeit der Märchen für die kindliche Entwicklung herausgestellt. Kapitel vier widmet sich der Analyse der symbolischen Bedeutung von typischen Märchenorten, wie dem Wald, dem See und dem Berg.
Schlüsselwörter
Märchen, literarische Gattung, Tiefenpsychologie, Archetypen, Symbol, Märchenort, Wald, See, Berg, Unterrichtsreihe, Kunstunterricht, Bildanalyse, Gestaltungstechniken, Expressionismus, Andrea Lehmann, Franz Marc
- Citation du texte
- Linda Röbert (Auteur), 2017, Volksmärchen für die kindliche Entwicklung. Didaktisches Potential für den Kunstunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/961337