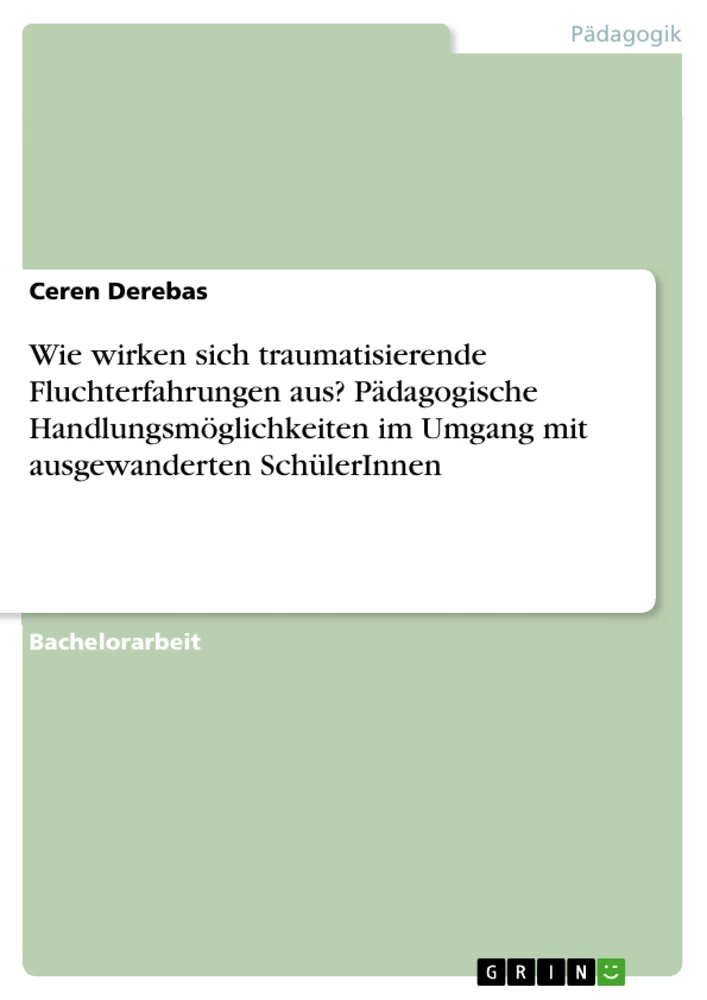Die vorliegende Bachelorarbeit nimmt sich dieser Thematik an. Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung der pädagogischen Herangehensweise hinsichtlich traumatisch-belasteter SchülerInnen. Zugleich soll die Arbeit als pragmatische Handreichung für Lehrende dienen, weshalb nicht zuletzt auch Ansätze zur Verbesserung der psychosozialen Lebenssituationen gegeben werden.
Da diverse Interventionskonzepte die individuellen Lebenserfahrungen der zugewanderten SchülerInnen nicht berücksichtigen, werden traumatisierende Lebensbedingungen vor, während und nach der Flucht dargestellt, die auch künftig als traumatisierende Belastungen wirken können. Das Beobachten traumatisierender Lebenssituationen stellt hierbei die Notwendigkeit einer pädagogischen Unterstützung und Reflexion von Verhaltensauffälligkeiten beziehungsweise Symptomerscheinungen der SchülerInnen mit Fluchterfahrung im Schulalltag dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Flucht
- 2.1 Was ist Flucht?
- 2.2 Fluchtmotive
- 2.3 Geflüchteter sein
- 2.4 Migration
- 3. Heimat
- 3.1 Was ist Heimat?
- 3.2 Lebenssituation
- 3.3 Fremdheit
- 4. Trauma in Bezug auf Flucht
- 4.1 Was ist Trauma?
- 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung
- 4.3 Jugend und Fluchterfahrung
- 4.4 Umgang mit Trauma
- 5. Somatische und seelische Symptomerscheinungen in der Schule
- 5.1 Intrusion
- 5.2 Erstarren und Verstummen
- 5.3 Körperliche und seelische Anspannung sowie psychosomatische Störungen
- 5.4 Angst und Aggression
- 5.5 Lernblockaden
- 6. Handlungsmöglichkeiten beim pädagogischen Umgang mit traumatisierten SchülerInnen
- 6.1 Was brauchen traumatisierte SchülerInnen? Schule als sicherer Ort
- 6.2 Wie kann geholfen werden? Pädagogische Arbeit in der Schule
- 6.3 Medienbezogene Projekte
- 6.4 Trauer- und Traumabewältigung
- 6.5 Kooperation mit außerschulischen Institutionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den pädagogischen Herausforderungen im Umgang mit (neu) ausgewanderten SchülerInnen, insbesondere mit den Auswirkungen traumatisierender Erfahrungen. Sie analysiert die Folgen von Flucht und Trauma auf die psychosoziale Lebenssituation der SchülerInnen und untersucht, wie pädagogische Interventionen diese Traumata bewältigen und die Integration in die Aufnahmegesellschaft fördern können.
- Auswirkungen von Fluchterfahrungen auf die psychosoziale Gesundheit von SchülerInnen
- Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung als Folge traumatisierender Erlebnisse
- Symptome und Verhaltensauffälligkeiten traumatisierter SchülerInnen im Schulalltag
- Pädagogische Handlungsmöglichkeiten zur Unterstützung traumatisierter SchülerInnen
- Resilienz und die Förderung der psychosozialen Entwicklung traumatisierter SchülerInnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation von Geflüchteten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, die aus ihren Heimatländern fliehen müssen. Kapitel 2 und 3 befassen sich mit den Begriffen Flucht und Heimat und untersuchen die Herausforderungen, die Geflüchtete in Bezug auf diese Themen erleben. Kapitel 4 widmet sich der Thematik von Trauma und Posttraumatischer Belastungsstörung im Zusammenhang mit Flucht und analysiert die Auswirkungen von traumatisierenden Erfahrungen auf die psychosoziale Entwicklung von Jugendlichen. Kapitel 5 beschreibt die spezifischen Symptome und Verhaltensauffälligkeiten, die traumatisierte SchülerInnen im Schulalltag zeigen. Kapitel 6 präsentiert schließlich pädagogische Handlungsmöglichkeiten, die traumatisierten SchülerInnen unterstützen und ihnen helfen können, ihre negativen Erfahrungen zu verarbeiten und sich in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Flucht, Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung, Integration, Bildung, pädagogische Handlungsmöglichkeiten, psychosoziale Entwicklung, Resilienz, SchülerInnen mit Fluchterfahrung, Schulalltag, Integration in die Aufnahmegesellschaft.
- Quote paper
- Ceren Derebas (Author), 2019, Wie wirken sich traumatisierende Fluchterfahrungen aus? Pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit ausgewanderten SchülerInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/961704