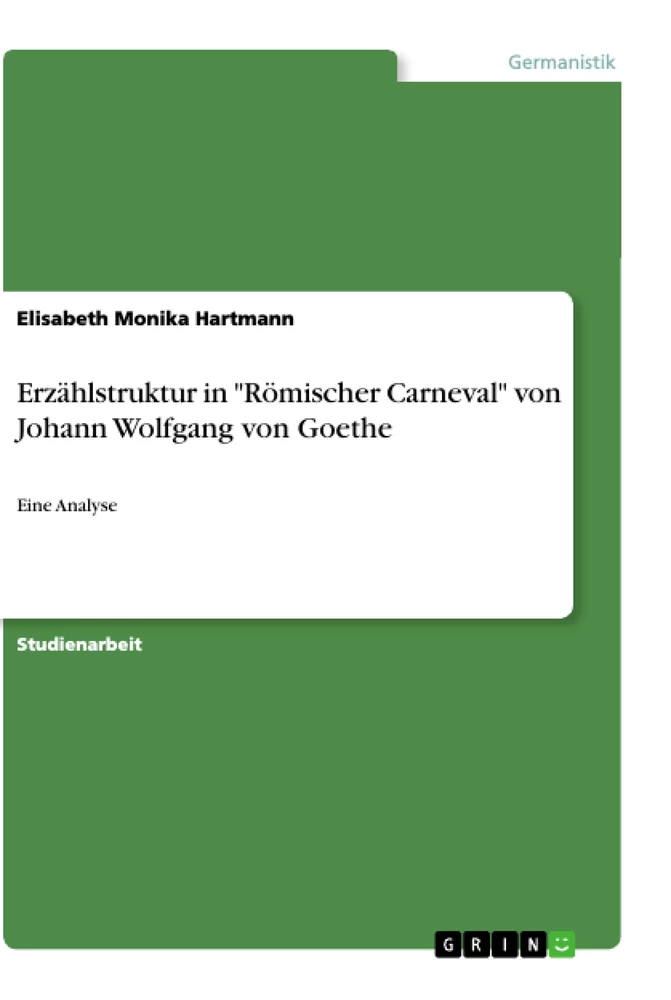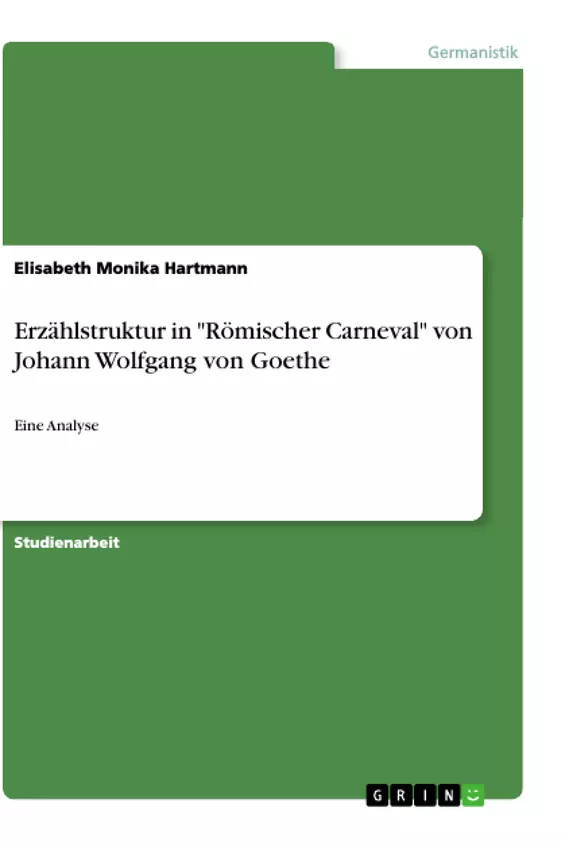In dieser Abhandlung soll der Frage beziehungsweise Problemstellung nachgegangen werden, wie und mit welchen Stilmitteln in der "Römische Carneval" Johann Wolfgang von Goethe hier erzählt und somit eine Struktur aufgebaut. Es werden historische, teils biografische und textimmanente Methoden angewandt, das bedeutet, dass anhand konkreter Textstellen Goethes Erzählweise genauer analysiert wird. Es findet jedoch eine Beschränkung auf die wichtigsten tableaux statt, da Goethe teilweise minimalistisch arbeitet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf literaturwissenschaftlichen Vorgehensweisen, wie der Konstruktion von Figuren, der Allegorese, der Wiederholung, dem fiktionalem und faktualem Erzählen, den Raumdarstellungen und insbesondere auf dem szenischen und situativem Erzählen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Aufbau und historische Kontext des Römischen Carnevals von Goethe
- Die Beschreibung und Erzählstruktur der einzelnen tableaux
- Die Menschenmenge des Corsos und die Darstellung der Masse
- Die Maskerade
- Aschermittwoch
- Erzähltheoretische Reflexion
- Der Römische Carneval als Allegorie
- Faktuales Erzählen im Römischen Carneval
- Erzählstruktur
- Iteratives Erzählen im Reisebericht über den Römischen Carneval
- Szenen unseres Lebens
- Wechselnde Blicke: Perspektive im Film und in der Literatur
- Erzähloberfläche
- Im Reden Handeln: Die Bildung der Figuren- und Figurengruppen des Römischen Carnevals
- Die Darstellung des Corsos als Raum
- Wie wird insgesamt dargestellt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung untersucht, wie Goethe im „Römischen Carneval“ eine narrative Struktur mit Stilmitteln aufbaut. Die Analyse verwendet historische, biografische und textimmanente Methoden, um Goethes Erzählweise anhand konkreter Textstellen zu analysieren. Der Fokus liegt auf literaturwissenschaftlichen Aspekten wie Figurenkonstruktion, Allegorese, Wiederholung, fiktionalem und faktualem Erzählen, Raumdarstellung und szenischem/situativem Erzählen im Kontext des Films.
- Goethes Darstellung des römischen Carnevals als kulturelles und soziales Phänomen
- Analyse von Erzähltechniken und Stilmitteln, die Goethe verwendet
- Die Rolle der Allegorie und die Darstellung von Ordnung und Chaos
- Der Einfluss der commedia dell'arte auf Goethes Erzählweise
- Die Verbindung von visueller Kunst und Text im „Römischen Carneval“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den historischen Kontext und die Entstehung des „Römischen Carnevals“. Es geht auf die Entstehung des Textes im Rahmen der Italienischen Reise ein und beschreibt Goethes Beobachtungen und Eindrücke vom römischen Carneval. Das zweite Kapitel analysiert die einzelnen tableaux und ihre Funktion im Rahmen der Gesamtstruktur des Textes. Dabei wird untersucht, wie Goethe die Masse, die Maskerade und den Aschermittwoch durch narrative Mittel darstellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit erzähltheoretischen Reflexionen und analysiert Goethes Erzähltechnik im Hinblick auf Allegorie, faktuales Erzählen, die Verwendung von Wiederholungen und die Gestaltung des Raumes.
Schlüsselwörter
Römischer Carneval, Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, Erzähltheorie, Allegorie, commedia dell'arte, Tableau, Figurengruppen, Raumdarstellung, szenisches Erzählen, Massen, Maskerade, Aschermittwoch, Ordnung und Chaos
- Citation du texte
- Elisabeth Monika Hartmann (Auteur), 2018, Erzählstruktur in "Römischer Carneval" von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/963369